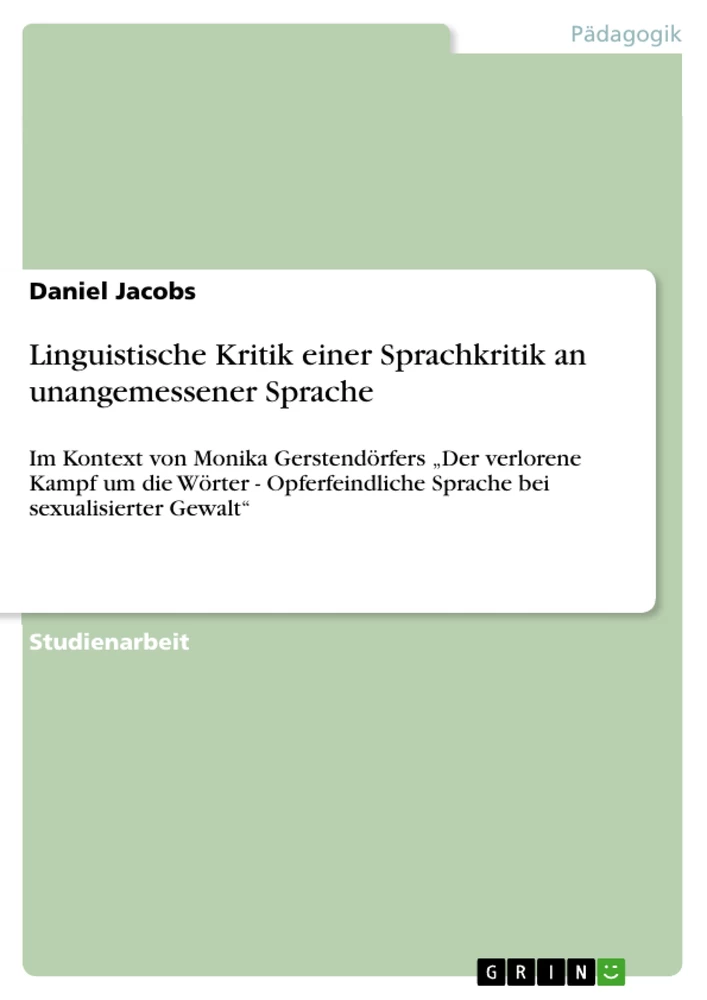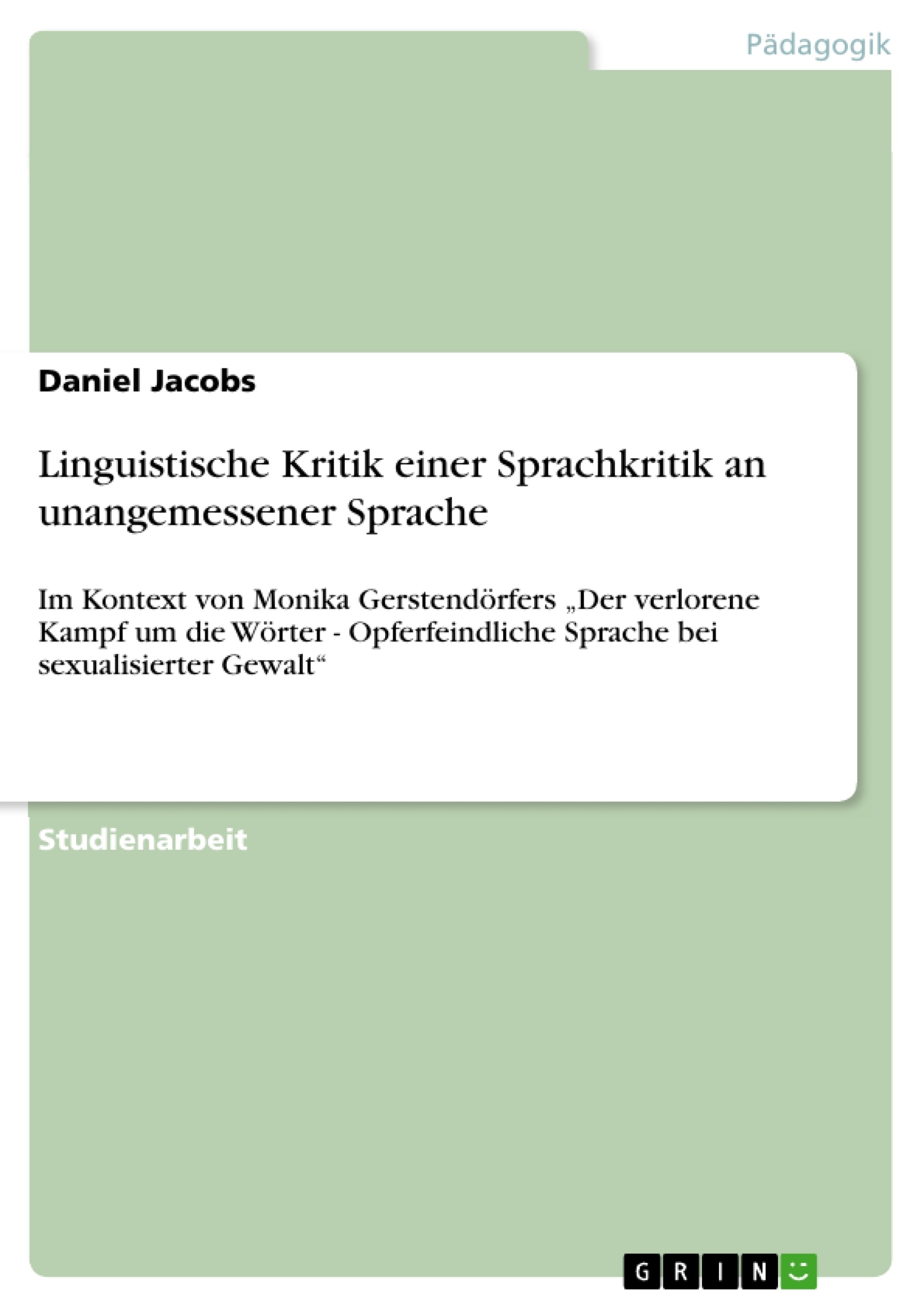Bevor eine Analyse der Aussagen Gerstendörfers durchgeführt werden kann, soll zunächst veranschaulicht werden, was insgesamt beachtet werden muss, wenn man sprachkritisch tätig wird, im Besonderen wenn man linguistisch begründet Sprache kritisieren will. Zu diesem Zweck sollen folgend deshalb die linguistischen Grundlagen, welche für eine Analyse beachtet werden müssen und eine Darstellung der Methodik der linguistischen Sprachkritik durchgeführt werden.
Bei sprachlichen Äußerungen sind immer bestimmte Faktoren beteiligt, welche im Falle einer Behandlung von Sprache und damit auch einer Kritik berücksichtigt werden müssen, da diese das sprachliche Phänomen bedingen. Die pragmatische Herangehensweise gibt eine Perspektive auf Sprache vor, die ohne die konkrete Sprechsituation mit den daran beteiligten Faktoren des Sprechers und Adressaten mit jeweils unterschiedlichem Hintergrundwissen und dem Kontext, in welchen das sprachliche Phänomen eingebettet ist, eine angemessene Untersuchung des Gegenstands Sprache nicht möglich macht. Als Untersuchungsgrundlage der heutigen Linguistik kann weiter der Werkzeugcharakter der Sprache als maßgebende Voraussetzung und Basis betrachtet werden. So wird in der Sprachwissenschaft überwiegend davon ausgegangen, dass sich sprachliche Phänomene als Sprachspiele auffassen lassen, die eingebettet in die eben erwähnten pragmatischen Faktoren, unter gewissen Regeln stattfinden und funktionieren Sprache ist daher als Kommunikationsmittel immer funktional, dient einem Zweck. Unter Berücksichtigung und aufbauend auf dem Organon-Modell von Karl Bühler, welches Sprache drei Grundfunktionen zuspricht und der späteren Erweiterung dieser um drei weitere Funktionen durch Roman Jakobson, kann also eine mögliche linguistische Sprachkritik nur vor diesem Hintergrund gelingen. Um überhaupt kritisieren zu können - als Bedingung der Möglichkeit von Sprachkritik - ist deshalb die von Jakobson zusätzlich eingeführte metasprachliche Funktion in unserem Zusammenhang entscheidend, mit Hilfe derer wir uns erst auf Sprache beziehen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen und Methodik einer linguistischen Sprachkritik
- 2 Monika Gerstendörfers Plädoyer für eine angemessenere Sprachführung
- 2.1 Zentrale Aussagen und sprachtheoretische Prämissen
- 2.2 Linguistische Untersuchung der Thesen
- 3 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Sprachkritik von Monika Gerstendörfer, die in ihrem Werk „Der verlorene Kampf um die Wörter - Opferfeindliche Sprache bei sexualisierter Gewalt" eine Reformulierung des Sprachgebrauchs im Kontext von sexualisierter Gewalt fordert. Die Arbeit untersucht, ob diese Kritik auf linguistischen Grundlagen basiert und ob die von Gerstendörfer vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gerechtfertigt sind.
- Die sprachtheoretischen Grundlagen einer linguistischen Sprachkritik
- Die zentrale These von Gerstendörfer, dass bestimmte Wörter die Wirklichkeit verschleiern und zur Gewalt beitragen
- Die Untersuchung der sprachlichen Prämissen von Gerstendörfers Argumentation
- Die Analyse der Thesen Gerstendörfers aus linguistischer Sicht
- Die Bewertung der Schlussfolgerungen von Gerstendörfer und die Beantwortung der Frage, ob ihre Kritik linguistisch fundiert ist
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Grundlagen und Methodik einer linguistischen Sprachkritik. Es wird erläutert, dass sprachliche Äußerungen immer in bestimmten Kontexten stattfinden und von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Sprache wird als Werkzeug betrachtet, das bestimmten Regeln und Normen folgt. Die Arbeit stellt das Organon-Modell von Karl Bühler und die Erweiterung durch Roman Jakobson vor und betont die Bedeutung der metasprachlichen Funktion für Sprachkritik. Der Abschnitt endet mit einer Darstellung der Methodik der linguistischen Sprachkritik, die auf die Analyse von Sprachnormenkonflikten und deren Auswirkungen auf die Kommunikation fokussiert.
Kapitel 2 stellt die zentralen Aussagen von Monika Gerstendörfer in ihrem Werk „Der verlorene Kampf um die Wörter" vor. Gerstendörfer kritisiert den Gebrauch bestimmter Wörter im Kontext von sexualisierter Gewalt, die ihrer Meinung nach die Wirklichkeit verschleiern und Opfer verletzen. Sie fordert eine Reformulierung des Sprachgebrauchs und schlägt alternative Begriffe vor, die die Schwere der Taten besser widerspiegeln sollen. Die Arbeit analysiert die sprachtheoretischen Prämissen von Gerstendörfers Argumentation, die auf der Annahme beruhen, dass Wörter bestimmte Assoziationen hervorrufen und untrennbar mit Einstellungen verbunden sind.
Kapitel 2.2 untersucht die Thesen Gerstendörfers aus linguistischer Sicht. Es wird festgestellt, dass Gerstendörfers Kritik als Euphemismen-Kritik betrachtet werden kann, die Teilbereich der Lexikalischen Sprachkritik ist. Die Arbeit diskutiert die ethische Grundlage der politolinguistischen Sprachkritik und analysiert die Argumente von Gerstendörfer im Hinblick auf die moralische Bewertung des Sprachgebrauchs. Es wird betont, dass Wörter an sich unschuldig sind und dass die Kritik an ihnen eher auf die Aussagen zielen sollte, die mit ihnen getroffen werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die linguistische Sprachkritik, die Euphemismen-Kritik, die Lexikalische Sprachkritik, die Politolinguistik, die sprachlichen Prämissen von Monika Gerstendörfer, die sprachliche Konstruktion sozialer Wirklichkeit, die Wirkung von Wörtern, die Bedeutung des Kontexts für Sprachkritik und die Grenzen einer linguistisch begründeten Sprachkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Monika Gerstendörfer in ihrer Sprachkritik?
Sie kritisiert "opferfeindliche" Sprache bei sexualisierter Gewalt und fordert Begriffe, die die Schwere der Taten nicht verschleiern.
Ist Gerstendörfers Kritik linguistisch fundiert?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und hinterfragt, ob Wörter an sich die Wirklichkeit konstruieren oder ob die Kritik eher auf die Sprecher zielen sollte.
Was ist das Organon-Modell?
Ein Modell von Karl Bühler, das Sprache drei Funktionen zuspricht: Ausdruck (Sprecher), Appell (Hörer) und Darstellung (Gegenstände).
Was versteht man unter "metasprachlicher Funktion"?
Die Fähigkeit der Sprache, sich auf sich selbst zu beziehen – eine notwendige Voraussetzung für jede Form der Sprachkritik.
Was ist Euphemismen-Kritik?
Die Kritik an beschönigenden Ausdrücken für unangenehme oder grauenhafte Sachverhalte, ein Teilbereich der lexikalischen Sprachkritik.
- Quote paper
- Daniel Jacobs (Author), 2013, Linguistische Kritik einer Sprachkritik an unangemessener Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265098