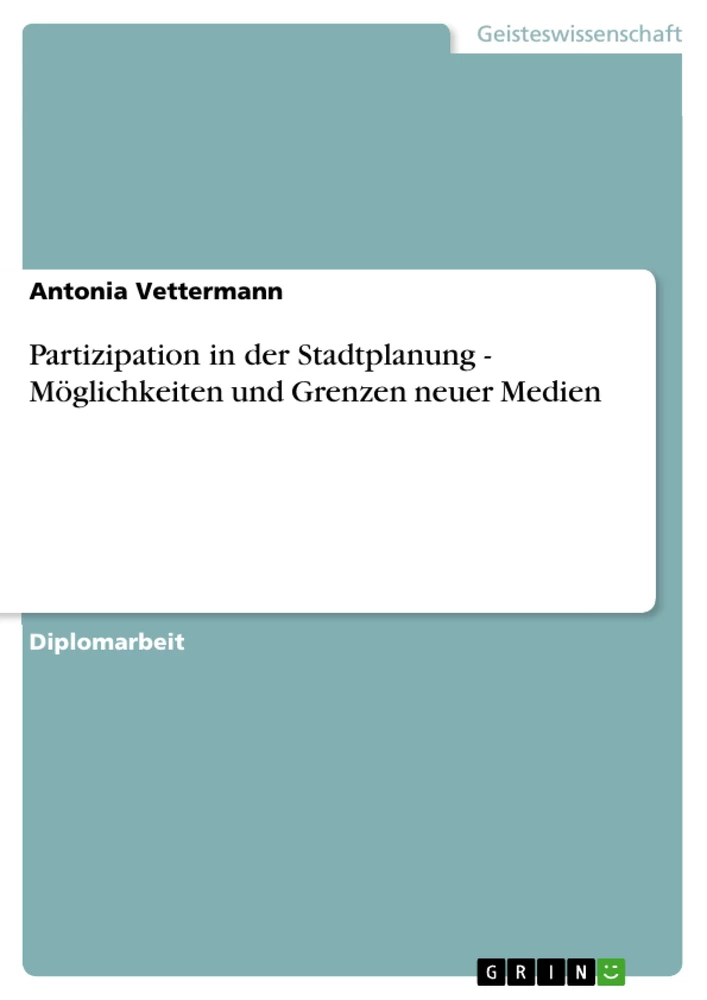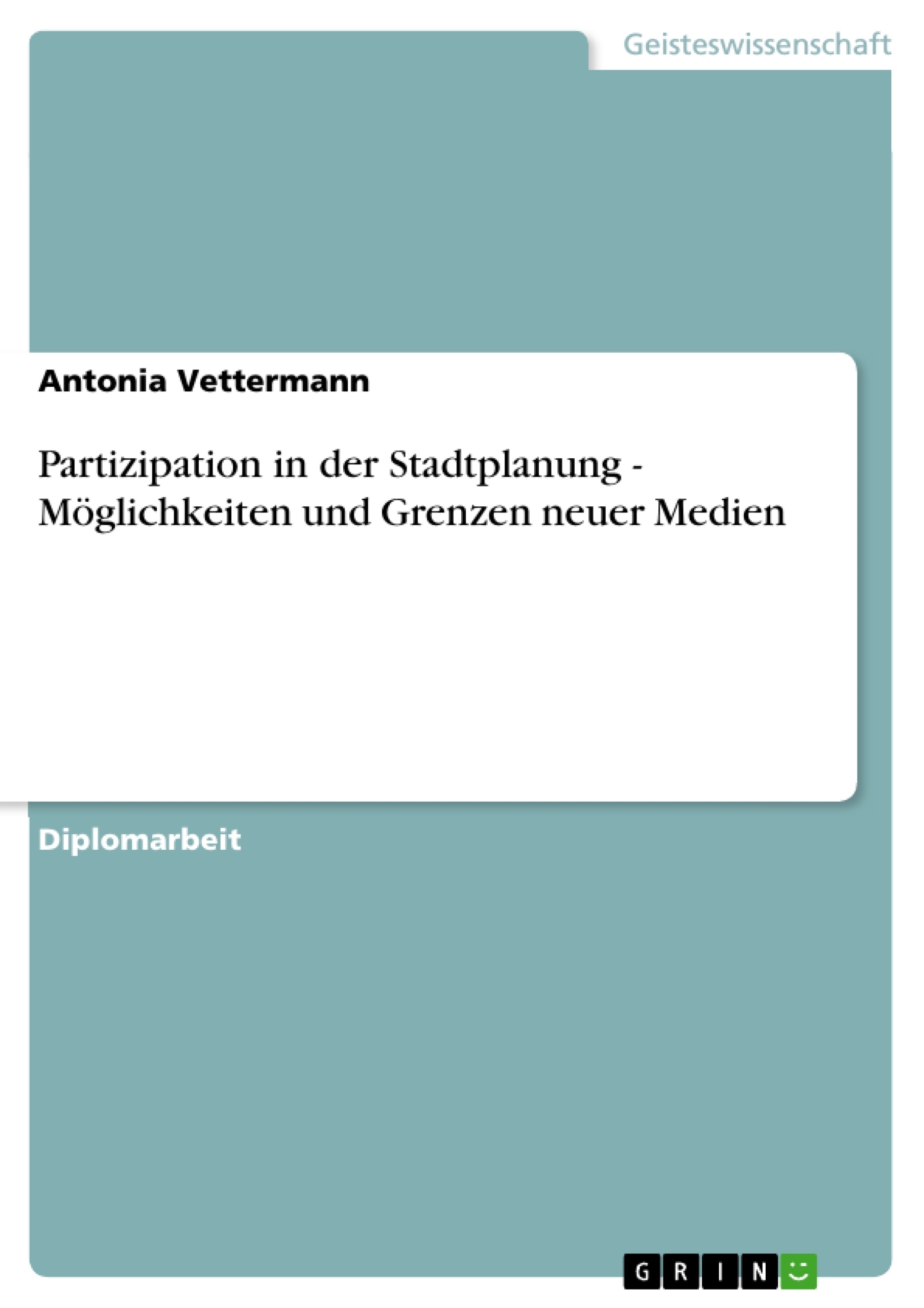Die Digitalisierung ermöglicht Partizipation in hohem Maße. Ziel dieser Arbeit ist es zu analysieren, inwieweit diese Erwartungen realistisch sind. Welche Möglichkeiten und Grenzen ergeben sich für die Beteiligung an der Stadtplanung?
Im ersten Kapitel gehe ich der Frage nach, was unter Partizipation verstanden wird.
Der Begriff stammt aus der Politikwissenschaft, in welcher verschiedene Theorien
zur Partizipation entwickelt worden sind. Einigkeit besteht darin, dass Partizipation
neben Freiheit und Gleichheit eine Grundvoraussetzung von Demokratie und unabdingbar
für die Legitimation demokratischer Entscheidungen ist. Die konkrete Ausgestaltung
von Partizipation ist jedoch vom jeweiligen Demokratieverständnis abhängig.
Da Stadtplanung und Stadtentwicklung nicht unabhängig von der Einbettung
in das jeweilige politische System begriffen werden können, ist es von Bedeutung, die
politischen und zeitgeschichtlichen Rahmenbedingung zu kennen, in denen Beteiligungsprozesse
vollzogen werden.
Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels steht die Partizipation in der Stadtplanung. Um
ein Verständnis für die Praxis von Partizipation zu bekommen, ist es mir wichtig, sie
in den historischen Kontext einordnen zu können. Wie deutlich werden wird, haben
sich sowohl das Aufgabenspektrum der Stadtplanung als auch die Ansprüche und
Realisierung von Beteiligung ständig erweitert. In jüngerer Vergangenheit jedoch sind
durchaus Brüche und gegenläufige Entwicklungen im Hinblick auf die Gewährung
von Partizipation festzustellen. Gleichzeitig kann heute eine Unterscheidung zwischen
formellen Beteiligungsverfahren einerseits und informellen Beteiligungsformen
andererseits getroffen werden, woraus sich sehr unterschiedliche Anforderungen und
Erwartungen an Partizipation ergeben. Zur Bestimmung der Möglichkeiten und
Grenzen von Beteiligung spielen des weiteren Faktoren wie die Entwicklung von
bürgerschaftlichem Engagement und sozialer Ungleichheit eine besondere Rolle.
Auf der Grundlage der ersten beiden Kapitel gehe ich im dritten Kapitel der Frage
nach, inwieweit die Hoffnungen auf verbesserte Partizipationsmöglichkeiten durch
den Einsatz neuer Medien berechtigt sind. Anhand der Thesen einer „elektronischen
Demokratie“ werde ich erste praktische Erfahrungen der Planungsbeteiligung durch
neue Medien auf ihre eventuell verbesserte Teilhabe hin untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Partizipation und Demokratie
- 1.1 Grundlagen der Demokratietheorie
- 1.2 Normatives versus instrumentelles Demokratieverständnis
- 1.2.1 Elitäres Demokratieverständnis
- 1.2.2 Egalitäres Demokratieverständnis
- 1.3 Repräsentative versus direkte Demokratie
- 1.3.1 Direkte Demokratie der Schweiz
- 1.3.2 Repräsentative Demokratie der BRD
- 1.4 Möglichkeiten und Grenzen politischer Partizipation
- 2. Partizipation in der Stadtplanung
- 2.1 Geschichte von Partizipation in der Planung
- 2.1.1 Stadtplanung im Wandel
- 2.1.2 Entwicklung von Partizipation in der Planung
- 2.2 Partizipation in der Planung heute
- 2.2.1 Aufgaben der Planung und formelle Beteiligung
- 2.2.2 Neue Planungsverfahren und informelle Beteiligung
- 2.3 Möglichkeiten und Grenzen informeller Partizipation
- 2.3.1 Erwartungen und Anforderungen an informelle Verfahren
- 2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement in der Zivilgesellschaft
- 2.3.3 Soziale Ungleichheit und Partizipation
- 2.1 Geschichte von Partizipation in der Planung
- 3. Neue Partizipationschancen durch neue Medien?
- 3.1 Neue Medien und „Elektronische Demokratie“
- 3.2 Neue Medien in der Planungsbeteiligung.
- 3.3 Möglichkeiten und Grenzen von Partizipation durch Neue Medien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes neuer Medien im Rahmen von Beteiligungsverfahren in der Stadtplanung. Dabei werden Erwartungen, die mit der verstärkten Verbreitung des Internets als Informations- und Kommunikationsmedium verbunden sind, auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft.
- Verschiedene Demokratieverständnisse und ihre Auswirkungen auf Partizipation
- Historische Entwicklung von Partizipation in der Stadtplanung
- Formelle und informelle Formen der Beteiligung
- Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und sozialer Ungleichheit
- Potenziale und Herausforderungen von „Elektronischer Demokratie“
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Partizipation aus politikwissenschaftlicher Sicht erläutert. Verschiedene Demokratietheorien und ihre implizierten Verständnis von Partizipation werden vorgestellt, und es wird die Entwicklung von der repräsentativen zur direkten Demokratie beleuchtet.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Partizipation in der Stadtplanung. Die historische Entwicklung der Stadtplanung und die sich verändernden Ansprüche und Realisierungsformen von Beteiligung werden dargestellt. Die Unterscheidung zwischen formellen und informellen Beteiligungsverfahren wird erläutert, und es werden die Auswirkungen von bürgerschaftlichem Engagement und sozialer Ungleichheit auf die Partizipation beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Chancen und Herausforderungen der „Elektronischen Demokratie“ im Kontext der Stadtplanung. Es werden Thesen zur Verbesserung von Partizipationsmöglichkeiten durch den Einsatz neuer Medien vorgestellt und anhand von praktischen Beispielen der Planungsbeteiligung durch neue Medien untersucht.
Schlüsselwörter
Partizipation, Demokratie, Stadtplanung, neue Medien, „Elektronische Demokratie“, Bürgerbeteiligung, formelle Beteiligung, informelle Beteiligung, bürgerschaftliches Engagement, soziale Ungleichheit, Informationszugang, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Partizipation in der Stadtplanung?
Partizipation bezeichnet die Einbeziehung von Bürgern in Entscheidungsprozesse der Stadtentwicklung, um demokratische Legitimation und bessere Planungsergebnisse zu erzielen.
Was ist der Unterschied zwischen formeller und informeller Beteiligung?
Formelle Beteiligung ist gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Baugesetzbuch), während informelle Beteiligung freiwillige Verfahren wie Werkstätten oder Online-Foren umfasst.
Welche Chancen bieten neue Medien für die Bürgerbeteiligung?
Neue Medien ermöglichen einen niederschwelligen Informationszugang, zeitunabhängige Kommunikation und erreichen potenziell größere und jüngere Bevölkerungsgruppen.
Wo liegen die Grenzen der "Elektronischen Demokratie" in der Planung?
Grenzen ergeben sich durch soziale Ungleichheit ("Digital Divide"), mangelnde Verbindlichkeit der Ergebnisse und die Gefahr der Manipulation oder Überforderung der Teilnehmer.
Wie beeinflusst soziale Ungleichheit die Partizipation?
Studien zeigen, dass sich oft nur bildungsnahe und wohlhabende Schichten beteiligen, was zu einer verzerrten Repräsentation der Bürgerinteressen führen kann.
Welche Rolle spielt bürgerschaftliches Engagement in der Zivilgesellschaft?
Es ist die Basis für informelle Verfahren und zeigt den Wunsch der Bürger nach aktiver Mitgestaltung jenseits rein repräsentativer Strukturen.
- Quote paper
- Antonia Vettermann (Author), 2002, Partizipation in der Stadtplanung - Möglichkeiten und Grenzen neuer Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26518