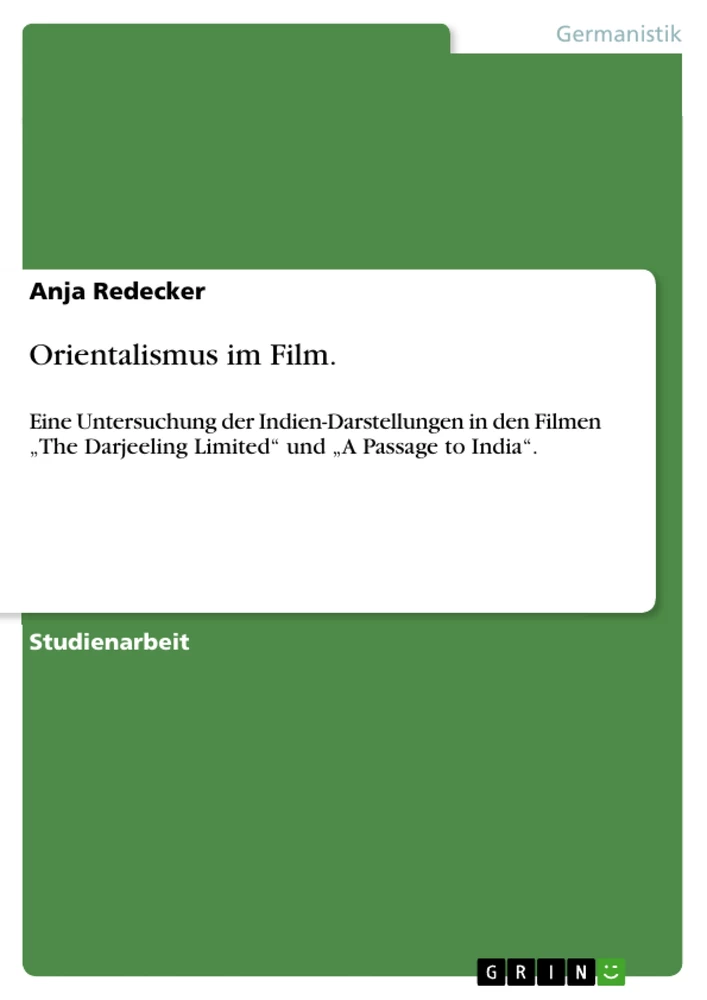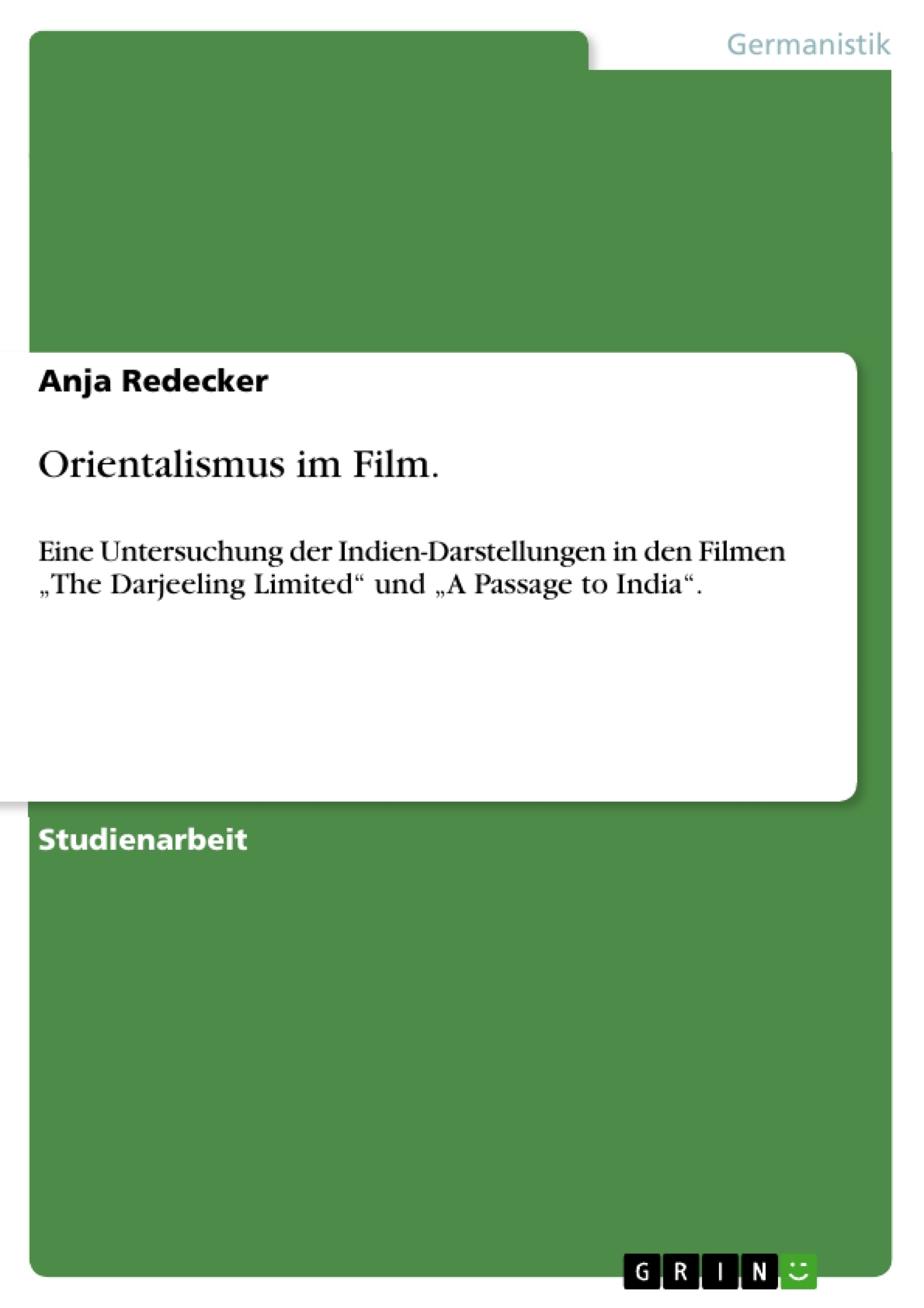1 Einleitung
Mit „Orientalism“ löste Edward Said viele Kontroversen aus. Die Grundthese seiner Arbeit lautet, dass „[t]he Orient […] an integral part of European material civilization and culture“ ist, und „Orientalism that part culturally and even ideologically as a mode of discourse with supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colonial bureaucracies and colonial styles” formuliert und repräsentiert.
Dieser Diskurs wird noch immer fortgesetzt und die ihm inhärenten Vorurteile und Bilder des Orients sind auch in Filmen zu entdecken. Wie diese Verankerung von Klischees in ihnen aussieht und ob es überhaupt möglich ist, ihnen als europäischer oder US-amerikanischer Filmemacher zu entgehen, der sich mit einem nordafrikanischen, oder asiatischen Land beschäftigt, soll diese Arbeit nach einer kurzen Darstellung von Saids Orientalismus-Theorie, mithilfe der Analyse zweier beispielhafter Filme zeigen. „A Passage to India“ von David Lean behandelt explizit das Thema englischer Kolonialherrschaft und Imperalismus in Indien, während Wes Anderson in „The Darjeeling Limited“ ein Familiendrama im selben Land inszeniert. Beide Filme sollen nach dem theoretischen Einstieg untersucht und verglichen werden. Saids Orientalismus-Konzept wird dabei als grober, übergeordneter Rahmen dienen.
Obgleich Said sich in seiner Untersuchung in erster Linie auf die arabischen Länder und kaum auf Indien bezieht, den Schauplatz der Filme, die Gegenstand dieser Arbeit sind, halte ich es für sinnvoll seine Theorie und das so aufgedeckte Denkmuster auch mit diesem Land in Bezug zu setzen, denn: „India has always been and continues to be integral to the West’s imaginative depiction of the mysterious and exotic ‚otherness‘ of the East.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Orientalismus
- Grundzüge der Theorie Edward Saids
- Bilder des Orients
- A Passage to India
- Imperialismuskritik?
- Britische Symmetrie und indischer Staub
- Soziales Mit-'Nebeneinander
- Der indische Protagonist — Dr. Aziz als Vorzeige-Orientale
- Unterwürfigkeit und Bewunderung
- Bedrohung durch Potenz
- Frauenrollen und ihre Funktion
- Das wirkliche Indien
- Das reale Indien westlicher Vorstellung
- Indische Mystik: Der verborgene Tempel und die Lust
- Imperialismuskritik?
- The Darjeeling Limited
- Charakterisierung der indischen
- Weibliche Individualität statt Frauenrolle
- Distanzierte Strenge statt Lüsternheit und Bewunderung
- Parodie westlicher Orient-Imagination
- Infantile Protagonisten: Komische Verballhornung klischeebaladener Westler
- Übertreibung und Hyper-Reality
- Charakterisierung der indischen
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung Indiens in den Filmen „A Passage to India" und „The Darjeeling Limited" im Kontext der Orientalismus-Theorie von Edward Said. Ziel ist es, die inhärenten Vorurteile und Klischees des westlichen Blicks auf den Orient in den Filmen zu analysieren und zu bewerten, sowie die Frage zu untersuchen, ob es überhaupt möglich ist, diesen Klischees als europäischer oder US-amerikanischer Filmemacher zu entgehen, der sich mit einem asiatischen Land beschäftigt.
- Orientalismus als Diskurs und seine Auswirkungen auf die Darstellung des Orients
- Analyse der Indien-Darstellungen in „A Passage to India" und „The Darjeeling Limited"
- Vergleich der beiden Filme hinsichtlich ihrer Verwendung von Orientalismus-Klischees
- Bewertung der Möglichkeiten, den Orientalismus-Diskurs in Filmen über den Orient zu überwinden
- Die Rolle von Komik und Übertreibung in der Parodie westlicher Orient-Imagination
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Orientalismus-Diskurses für die Film- und Literaturwissenschaft. Die Arbeit stellt die beiden Filme „A Passage to India" und „The Darjeeling Limited" als Fallbeispiele vor und verdeutlicht die Notwendigkeit der Analyse von Edward Saids Theorie im Kontext der Indien-Darstellungen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundzügen der Orientalismus-Theorie von Edward Said. Es werden die zentralen Argumente des Autors zusammengefasst, die auf eine konstruierte und von Vorurteilen geprägte westliche Vorstellung vom Orient hinweisen. Das Kapitel skizziert die wichtigsten Bilder des Orients, die Said zufolge durch den Orientalismus-Diskurs geprägt wurden.
Das dritte Kapitel analysiert die Indien-Darstellung in David Leans Film „A Passage to India". Es wird untersucht, wie der Film zwar eine Kritik am englischen Kolonialismus und Imperialismus in Indien anstrebt, aber gleichzeitig in vielerlei Hinsicht die Klischees des Orientalismus reproduziert. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung der indischen Frauen, die Figur des Dr. Aziz und die Frage, ob der Film ein authentisches Bild von Indien vermittelt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit Wes Andersons Film „The Darjeeling Limited". Es wird untersucht, wie Anderson mit den Mitteln der Komik und Übertreibung die westlichen Vorurteile gegenüber Indien parodiert und so einen neuen Blick auf das Land eröffnet. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung der indischen Figuren, die Übertreibung von Symbolen und die Kreation einer „Hyper-Reality", die die Künstlichkeit der westlichen Orient-Imagination aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Orientalismus, die Indien-Darstellung, die Film- und Literaturwissenschaft, die westliche Vorstellung vom Orient, die Klischees des Orientalismus, die Kritik am Imperialismus, die Parodie westlicher Orient-Imagination und die Möglichkeiten, den Orientalismus-Diskurs in Filmen über den Orient zu überwinden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundthese von Edward Saids "Orientalismus"?
Said argumentiert, dass der "Orient" eine westliche Konstruktion ist, die durch Vorurteile und koloniale Ideologien geprägt wurde, um eine westliche Überlegenheit zu legitimieren.
Wie wird Indien im Film "A Passage to India" dargestellt?
Obwohl der Film den Kolonialismus kritisiert, reproduziert er laut Analyse viele orientalistische Klischees, wie die Unterwürfigkeit des indischen Protagonisten.
Wie unterscheidet sich "The Darjeeling Limited" in der Darstellung?
Wes Anderson nutzt Komik und Übertreibung, um westliche Orient-Imaginationen zu parodieren und die Klischees der Protagonisten als infantil darzustellen.
Können westliche Filmemacher dem Orientalismus entgehen?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob es möglich ist, Filme über asiatische oder nordafrikanische Länder zu drehen, ohne in tief verwurzelte Denkmuster zu verfallen.
Was bedeutet "Hyper-Reality" im Kontext von Wes Andersons Film?
Es bezeichnet eine künstlich übersteigerte Darstellung der Realität, die die Künstlichkeit der westlichen Sicht auf den Orient entlarvt.
Welche Rolle spielen Frauenrollen in der orientalistischen Darstellung?
Die Arbeit vergleicht die Funktion von Frauenrollen in beiden Filmen und zeigt, wie sie entweder Klischees bedienen oder diese durch Individualität brechen.
- Quote paper
- Anja Redecker (Author), 2011, Orientalismus im Film., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265278