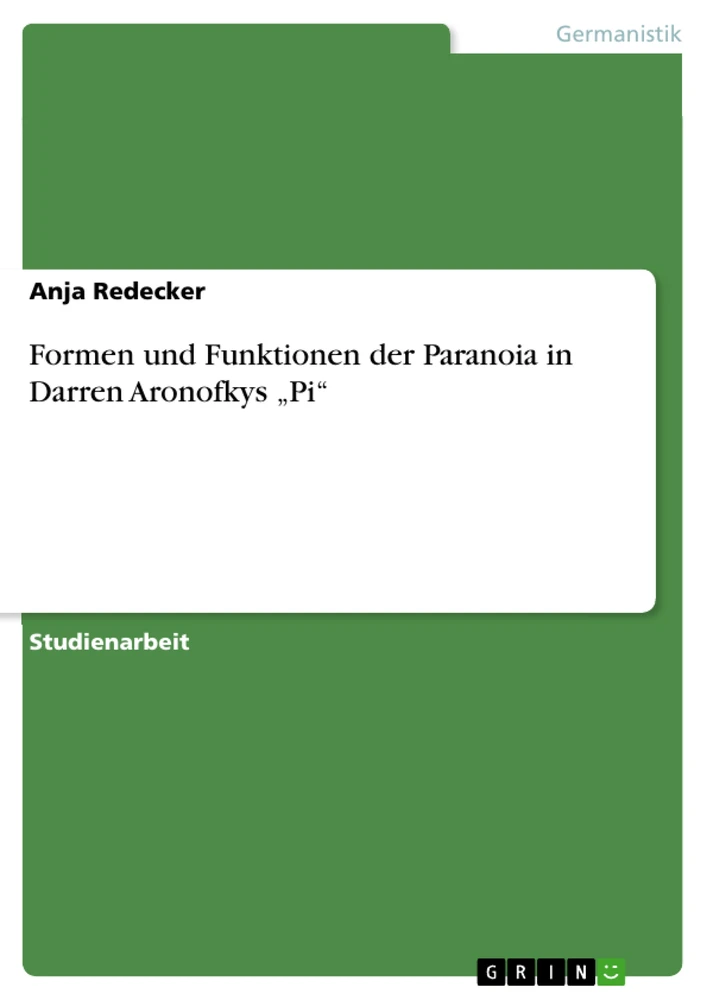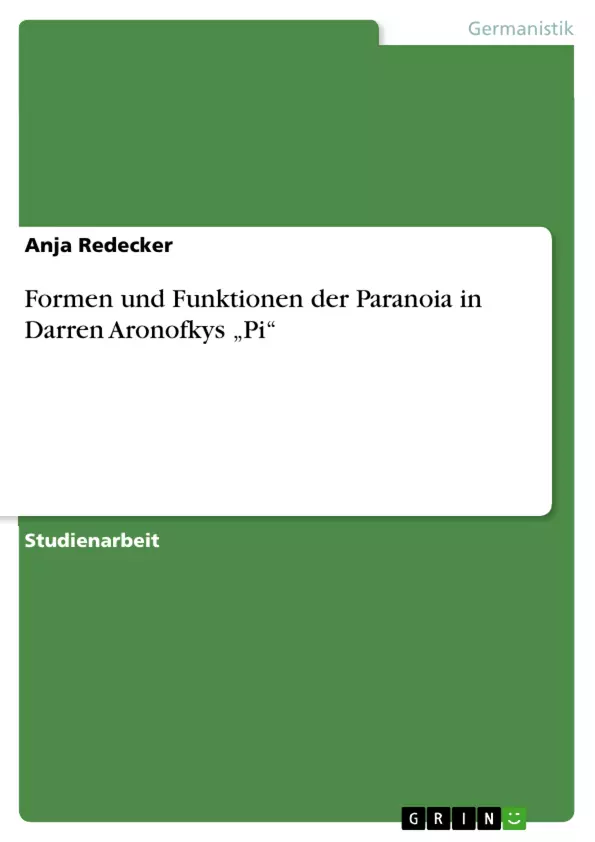1 Einleitung
1998 erschien Darren Aronofskys erster Spielfilm, „π“. Mit einem zusammengesammelten Budget von nur 60.000$ schuf der sich auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnende Regisseur einen beklemmenden Film über einen Mann, der ob seiner Obsession für die Idee ein welterklärendes Muster in Zahlenform zu finden, seine Menschlichkeit und beinahe seinen Verstand verliert. Max Cohen (Sean Gulette) entwickelt im Verlauf des Films immer stärkere paranoisch anmutende Verhaltensmuster und Symptome, die in dieser Arbeit analysiert werden sollen.
Die Untersuchung von „π“ soll zeigen, in welcher Form Paranoia hier medial repräsentiert wird. In gewisser Weise steht Aronofskys Erstling in dieser Hinsicht beispielhaft für den Paranoia-Film der 90er Jahre. Derartige Zusammenhänge sollen nach einer kurzen Einführung in das klinisch-individuelle Krankheitsbild der Paranoia skizziert werden. Anschließend soll „π“ unter verschiedenen Leitfragen untersucht werden, wie z.B.: Wird dem Rezipienten hier bloß ein individueller Krankheitsverlauf geschildert? Wie wird er selbst in das Geschehen einbezogen und mit welchen filmischen Mitteln wird eine solche Verknüpfung zwischen Betrachter und Betrachtetem hergestellt? Verkörpert Max vielleicht mehr als „bloß“ einen Paranoiker im klinisch-psychoanalystischen Sinn? Welche Symptome weist er auf und wie entwickelt sich sein Habitus, sein Charakter?
Es handelt sich bei „π“ um einen extrem durchstilisierten Film. Musik, Geräusche, Einstellungen: Sie bilden zusammen ein vollkommen stimmiges, durchdacht ästhetisches Gefüge, dessen Betrachtung auf einer künstlerischen Ebene allein eine Arbeit wie diese füllen könnte. Daher kann die nachfolgende Untersuchung nicht auf alle Stilelemente und Filmtechniken eingehen, die Aronofsky mit seinem Team entwickelt, gestaltet und verwendet. Stattdessen sollen anhand der Analyse des Protagonisten Max Cohen (Sean Gulette) verschiedene Mittel beispielhaft aufgezeigt und ihre Wirkung dargestellt werden, sofern sie unmittelbar auf das Thema dieser Arbeit Bezug nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Verwendungsweisen des Begriffs der Paranoia
- 2.1 Die klinisch-psychoanalytische Perspektive
- 2.2 Paranoia als kulturelles und filmisches Phänomen
- 3 Auftreten und Funktion der Paranoia in „π“
- 3.1 Verschwörung der Zahlen oder Erlösung durch Mathematik?
- 3.2 Die Subjektivität von Erinnerung – Erleuchtung durch Blendung
- 3.3 Bindeglieder zur Menschlichkeit
- 3.4 Religion und Migräne – Halluzination und Realität
- 3.5 Point of View – Der Sog in Max' Welt
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Paranoia in Darren Aronofskys Film „π“ aus dem Jahr 1998. Ziel ist es, die mediale Repräsentation von Paranoia im Film zu untersuchen und ihren Zusammenhang mit dem Paranoia-Film der 90er Jahre aufzuzeigen. Die Analyse berücksichtigt sowohl klinisch-psychoanalytische Perspektiven auf Paranoia als auch deren kulturelle und filmische Kontexte.
- Mediale Repräsentation von Paranoia in „π“
- Vergleich zwischen klinischer Paranoia und der Darstellung im Film
- Analyse filmischer Mittel zur Herstellung einer Verbindung zwischen Zuschauer und Protagonist
- Entwicklung des Charakters Max Cohen und seiner Paranoia-Symptome
- Die Rolle von Stilmitteln wie Musik, Geräuschen und Einstellungen in der Darstellung der Paranoia
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den Film „π“ von Darren Aronofsky als Fallbeispiel für die Darstellung von Paranoia im Film vor. Sie skizziert die Forschungsfrage, die sich mit der medialen Repräsentation von Paranoia und der Einbindung des Zuschauers beschäftigt, und benennt die methodischen Grenzen der Analyse aufgrund des durchstilisierten Charakters des Films.
2 Verwendungsweisen des Begriffs der Paranoia: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es beleuchtet die klinisch-psychoanalytische Perspektive auf Paranoia, insbesondere Freuds Auseinandersetzung mit dem Thema anhand des Falls Schreber, und erörtert moderne und postmoderne Überlegungen zur Paranoia sowie deren kulturelle Einbettung.
3 Auftreten und Funktion der Paranoia in „π“: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Darstellung von Paranoia im Film „π“. Es untersucht, wie die Paranoia des Protagonisten Max Cohen filmisch inszeniert wird und welche Rolle verschiedene filmische Mittel dabei spielen. Die Analyse berücksichtigt Aspekte wie die Verschwörungstheorie um Zahlen, die Subjektivität von Erinnerung, die Darstellung von menschlichen Beziehungen, die Verbindung von Religion und Halluzination sowie die Perspektive des Zuschauers.
Schlüsselwörter
Paranoia, Film, „π“, Darren Aronofsky, Psychoanalyse, Freud, mediale Repräsentation, filmische Mittel, Charakteranalyse, Verschwörungstheorie, Zahlen, Mathematik, Erinnerung, Subjektivität, Religion, Halluzination, Zuschauerperspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Paranoia in Darren Aronofskys Film "π"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Paranoia im Film "π" (1998) von Darren Aronofsky. Sie untersucht die mediale Repräsentation von Paranoia und ihren Zusammenhang mit dem Paranoia-Film der 90er Jahre, unter Berücksichtigung klinisch-psychoanalytischer und kultureller Perspektiven.
Welche Aspekte der Paranoia werden untersucht?
Die Analyse betrachtet verschiedene Aspekte der Paranoia im Film, darunter die filmische Inszenierung der Paranoia des Protagonisten Max Cohen, der Vergleich zwischen klinischer Paranoia und ihrer filmischen Darstellung, die Rolle filmischer Mittel (Musik, Geräusche, Einstellungen) und die Herstellung einer Verbindung zwischen Zuschauer und Protagonist.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf klinisch-psychoanalytische Perspektiven auf Paranoia, insbesondere Freuds Auseinandersetzung mit dem Thema (Fall Schreber), sowie moderne und postmoderne Überlegungen zur Paranoia und deren kulturelle Einbettung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Verwendung des Paranoia-Begriffs (klinisch-psychoanalytisch und kulturell), ein Hauptkapitel zur Analyse der Paranoia in "π" und ein Fazit. Das Hauptkapitel untersucht verschiedene Facetten der Paranoia im Film, wie die Verschwörungstheorie um Zahlen, die Subjektivität der Erinnerung, die Darstellung menschlicher Beziehungen, die Verbindung von Religion und Halluzination sowie die Perspektive des Zuschauers.
Welche methodischen Grenzen werden genannt?
Die Arbeit erwähnt methodische Grenzen aufgrund des durchstilisierten Charakters des Films "π".
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Paranoia, Film, „π“, Darren Aronofsky, Psychoanalyse, Freud, mediale Repräsentation, filmische Mittel, Charakteranalyse, Verschwörungstheorie, Zahlen, Mathematik, Erinnerung, Subjektivität, Religion, Halluzination, Zuschauerperspektive.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der medialen Repräsentation von Paranoia im Film "π" und die Darstellung ihres Zusammenhangs mit dem Paranoia-Film der 90er Jahre. Es soll analysiert werden, wie die Paranoia filmisch inszeniert wird und wie eine Verbindung zwischen Zuschauer und Protagonist hergestellt wird.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung: Einführung in das Thema und die Forschungsfrage. Verwendungsweisen des Begriffs der Paranoia: Theoretische Grundlagen, klinisch-psychoanalytische und kulturelle Perspektiven. Auftreten und Funktion der Paranoia in „π“: Hauptteil mit Filmanalyse. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Arbeit zitieren
- Anja Redecker (Autor:in), 2011, Formen und Funktionen der Paranoia in Darren Aronofkys „Pi“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265283