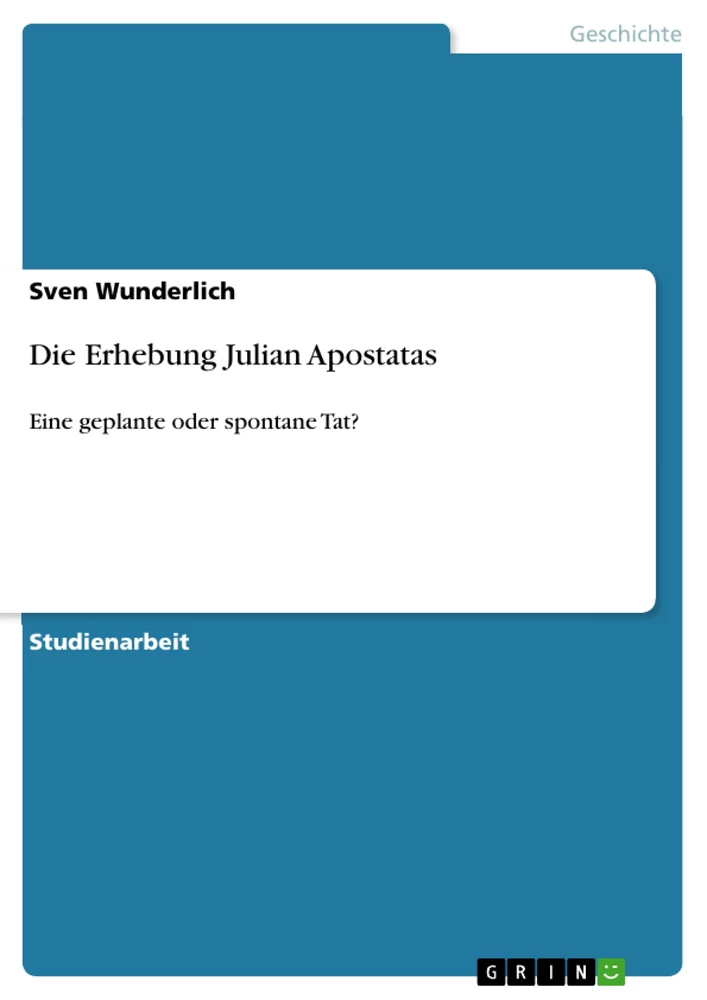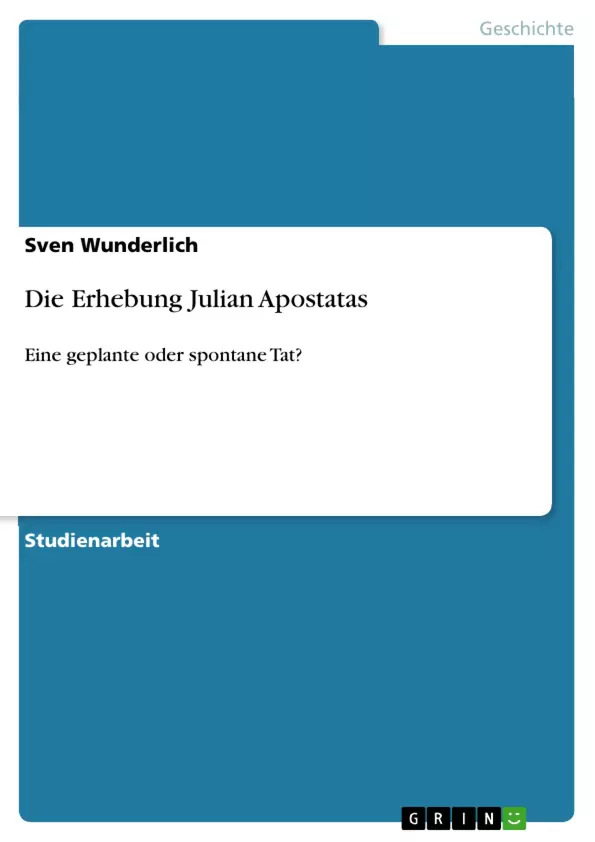Der römische Kaiser Flavius Claudius Julianus, kurz Julian, gehörte zu den spannendsten Figuren der Spätantike und möglicherweise sogar der gesamten Antike. Dieser Umstand hängt nicht mit der Dauer seiner kaiserlichen Regentschaft zusammen. Denn besonders im Vergleich zu Augustus oder Konstantin dem Großen, wirken Julians knappe drei Jahre von 360 – 363 als Kaiser sehr gering. Julian ist aus anderen Gründen eine tragende Figur der Antike geworden. Von kaum einem anderen Kaiser hat sich eine vergleichbare Anzahl an eigenen Schriften erhalten. Julian, seine Zeit und seine Motive können deshalb aus erster Hand erforscht werden. Interessanter als seine Schriften ist jedoch Julians Politik. Denn Julian stand für eine radikale Politik gegen Christen und versuchte deren Stellung in der römischen Gesellschaft zu beschneiden. Diese Politik ist besonders vor dem Hintergrund, dass das Christentum von Konstantin dem Großen und seinen Söhnen in den Jahren vor Julian einen gewaltigen Aufstieg bis hin zur Religion des Kaiserhauses gemacht hatte, bemerkenswert.
Julians antichristliche Politik brachte ihm deshalb den Beinamen Apostata, der Abtrünnige, ein.
Eine besondere Stellung in den zahlreichen Fragestellungen um Julian und seine Politik war schon immer dessen Erhebung zu Augustus, beziehungsweise zum Kaiser. Während die meisten antiken, heidnischen Autoren eine ungeplante Krönung unter besonderen Umständen proklamierten, sahen die antiken, christlichen Autoren in Julians Erhebung den Griff nach der Macht eines Antichristen. Bis heute konnte diese Frage nicht eindeutig geklärt werden. Denn neben den antiken Theorien gesellten sich in der Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts immer weitere Thesen und Theorien hinzu. Es lassen sich jedoch, trotz vieler verschiedener Facetten in den Theorien, zwei wesentliche Auffassungen unterscheiden: Die spontane und die geplante Erhebung.1 Mittlerweile geht die Forschung weitestgehend von der geplanten Erhebung Julians aus. Jedoch konnten bislang nicht alle Punkte restlos ausgeräumt werden.
Dies ist auch das Thema der vorliegenden Arbeit – war die Erhebung Julians zum Augustus eine geplante oder spontane Tat?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Erhebung Julians bei Ammianus Marcellinus
- 2.1. Die Darstellung der Erhebung
- 2.2. Die spontane Erhebung bei Ammianus
- 2.3. Probleme bei Ammianus Darstellung
- 2.3.1. Probleme in der Gesamtdarstellung
- 2.3.2. Weitere Problempunkte
- 3. Die Erhebung Julians in anderen Quellen
- 3.1. Julian
- 3.2. Libanios
- 3.3. Gregor von Nazianz
- 3.4. Eutropius
- 3.5. Eunapios von Sardes
- 4. Julians Erhebung in späteren Quellen
- 4.1. Zosimos
- 4.2. Weitere Quellen
- 5. Schluss
- 6. Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Erhebung des römischen Kaisers Flavius Claudius Julianus, kurz Julian, zum Augustus eine geplante oder spontane Tat war. Die Arbeit untersucht die verschiedenen historiographischen Quellen, die sich mit diesem Thema befassen, und analysiert deren Darstellungen der Erhebung.
- Die Rolle von Ammianus Marcellinus als Hauptquelle für die Erhebung Julians
- Die Analyse von Julians eigenem Brief an die Athener als früheste Quelle über die Erhebung
- Die Untersuchung weiterer zeitnaher Quellen, darunter Reden von Libanios und Gregor von Nazianz sowie die Werke von Eutropius und Eunapios
- Die Berücksichtigung späterer Quellen, wie Zosimos Historia Nova, um die fortschreitende Entwicklung der Darstellung der Erhebung aufzuzeigen
- Die kritische Analyse der verschiedenen Quellen und deren jeweilige Intentionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Einleitung und stellt die Fragestellung der Arbeit dar: War die Erhebung Julians zum Augustus eine geplante oder spontane Tat? Das Kapitel erläutert die historische Bedeutung Julians und seine antichristliche Politik, die ihm den Beinamen Apostata einbrachte.
Das zweite Kapitel analysiert die Darstellung der Erhebung Julians bei Ammianus Marcellinus, der wichtigsten Quelle für die Zeit von Julian. Der Fokus liegt dabei auf den detaillierten Schilderungen Ammianus, die die Erhebung als einen ungeplanten Akt beschreiben, der hauptsächlich von den Soldaten betrieben wurde. Das Kapitel beleuchtet jedoch auch die problematischen Punkte in Ammianus Darstellung, die Zweifel an der spontanen Erhebung aufwerfen.
Das dritte Kapitel untersucht die Erhebung Julians in weiteren Quellen, darunter Julians eigener Brief an die Athener, Reden von Libanios und Gregor von Nazianz sowie die Werke von Eutropius und Eunapios. Das Kapitel analysiert die Darstellungen dieser Quellen und ihre jeweiligen Intentionen, um die Fragestellung der Arbeit zu beantworten.
Das vierte Kapitel widmet sich Julians Erhebung in späteren Quellen, insbesondere Zosimos Historia Nova. Das Kapitel analysiert Zosimos Darstellung der Erhebung und zeigt, wie die verschiedenen Quellen die Erhebung Julians interpretieren.
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und beantwortet die Fragestellung der Arbeit. Es wird argumentiert, dass Julians Erhebung zum Augustus wahrscheinlich nicht den spontanen Charakter hatte, der von den Quellen propagiert wird, sondern eher ein geplanter Akt war, der von Julian selbst initiiert wurde.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erhebung Julians zum Augustus, die antike Geschichtsschreibung, die Analyse historischer Quellen, die Spätantike, das Christentum, die heidnische Religion, die Usurpation, die politische Macht, die Legitimation, die Motivation und die Intentionen historischer Autoren.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Kaiser Julian und warum nannte man ihn "Apostata"?
Julian war ein römischer Kaiser (360–363 n. Chr.), der versuchte, das Christentum zurückzudrängen und die heidnischen Kulte wiederzubeleben, weshalb ihn Christen als "Apostata" (den Abtrünnigen) bezeichneten.
War Julians Erhebung zum Kaiser geplant oder spontan?
Dies ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Während antike Quellen oft eine spontane Ausrufung durch Soldaten schildern, geht die moderne Forschung eher von einem durch Julian geplanten Akt aus.
Welche Rolle spielte Ammianus Marcellinus als historische Quelle?
Ammianus Marcellinus ist die wichtigste zeitgenössische Quelle. Er stellt die Erhebung als ungeplant dar, doch die Arbeit deckt Widersprüche in seiner Schilderung auf.
Was steht in Julians "Brief an die Athener"?
In diesem Brief rechtfertigte Julian seine Machtübernahme gegenüber der Öffentlichkeit und gab seine Sicht auf die Ereignisse in Paris wieder.
Wie unterschieden sich christliche und heidnische Autoren in ihrer Sicht auf Julian?
Heidnische Autoren wie Libanios sahen in ihm einen Retter der Tradition, während christliche Autoren wie Gregor von Nazianz ihn als gotteslästerlichen Usurpator verurteilten.
- Arbeit zitieren
- Sven Wunderlich (Autor:in), 2013, Die Erhebung Julian Apostatas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265574