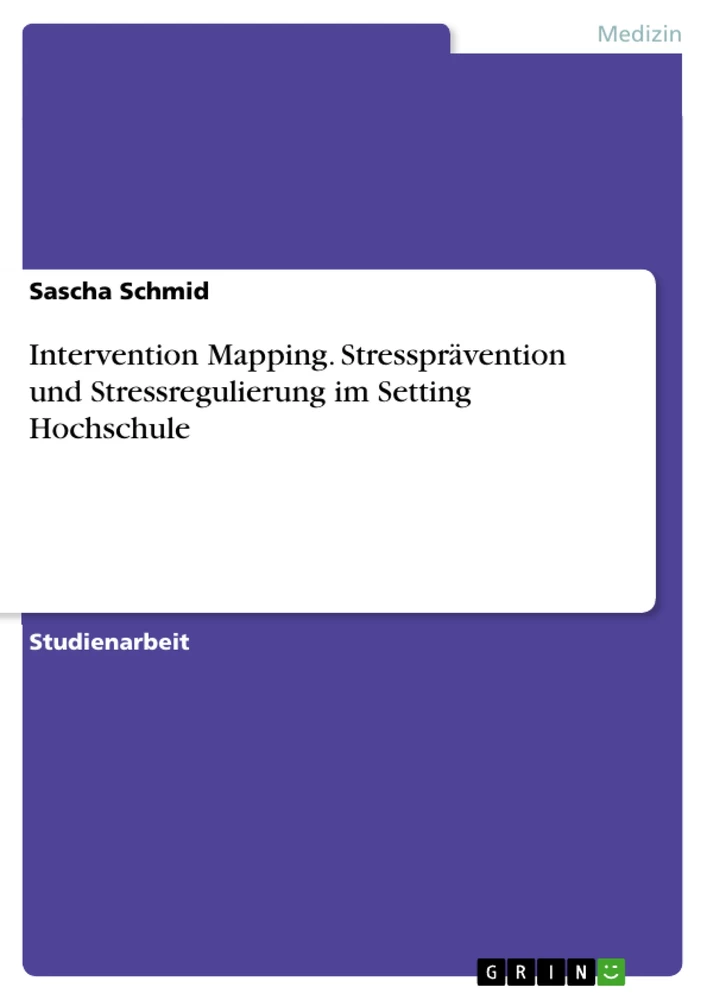„In der Erkenntnis seiner Lage liegt die Chance des Menschen“, verkündete der Philosoph Blaise Pascal, der den Menschen als ein, an die Ketten des Daseins, gebundenes Wesen betrachtete. Wohl wahr, sind wir alle hin- und hergerissen zwischen den Anforderungen des privaten Lebens und den Anforderungen der Arbeit. Die eigenen Erwartungen sollen genauso erfüllt werden, wie die der Familie. Man sollte sich der Karriere uneingeschränkt widmen, gleichzeitig sollen aber auch die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen. Prüfungen und etliche Lerneinheiten im Studium müssen pflichtgemäß und erfolgreich absolviert, aber im gleichen Atemzug müssen noch andere Prioritäten des Lebens erledigt werden. Aufgabe des Individuums ist es nun, eine Balance zwischen den umweltbedingten Anforderungen und den persönlichen Bewältigungsstrategien zu halten. Dies geschieht zunächst einmal in der pascalschen Erkenntnis, dass der Stress im Kopf entsteht. Angesprochen ist damit der transaktionale Ansatz von Richard Lazarus, dessen Stressmodell als theoretische Rahmenkonzeption für diese Arbeit dienen soll. Die Anwendung dieser Theorie und die Auswahl adäquater Stressbewältigungsmaßnahmen für Studierende einer Universität sollen Bestandteil einer fiktiven Intervention sein, die unter dem Titel Students Stress Project firmiert. Die Realisierung dieser Intervention folgt den Schritten des Intervention Mapping Ansatzes, dessen Handlungslogik, sowohl die individuelle als auch die organisationale Ebene berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedürfnisanalyse - Schritt Eins
- Ergebnisse und Implikationen
- Matrizen - Schritt Zwei
- Methoden und Anwendungen - Schritt Drei
- Theoretische Fundierung - Das Elaboration-Likelihood Modell (ELM)
- Akteurzentrierte Methoden und Anwendungen
- Programmentwicklung - Schritt Vier
- Ablauf des Gesundheitsprogramms
- Implementationsplanung - Schritt Fünf
- Evaluationsplanung Schritt Sechs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit entwickelt ein fiktives Interventionsprogramm ("Students Stress Project") zur Stressprävention und -regulierung bei Studierenden. Das Programm basiert auf dem Intervention Mapping Ansatz und dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus. Ziel ist die Konzeptionierung eines Programms, welches sowohl individuelle als auch organisationale Ebenen der Stressbewältigung berücksichtigt.
- Stressbewältigung bei Studierenden
- Anwendung des Intervention Mapping Ansatzes
- Das Elaboration-Likelihood Modell (ELM)
- Hochschulbezogene Gesundheitsförderung
- Analyse von Stressfaktoren im Hochschulkontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert den transaktionalen Ansatz von Lazarus als theoretischen Rahmen für die Arbeit und beschreibt das fiktive "Students Stress Project", das die Schritte des Intervention Mapping Ansatzes zur Stressbewältigung bei Studierenden verfolgt. Sie betont die Bedeutung sowohl individueller als auch organisationaler Faktoren bei der Stressentstehung und -bewältigung und die Verantwortung der Hochschulen für die Schaffung gesundheitsförderlicher Bedingungen. Das Zitat von Pascal unterstreicht die Bedeutung der individuellen Wahrnehmung der Situation im Umgang mit Stress.
Bedürfnisanalyse - Schritt Eins: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung des PRECEDE-Modells zur Analyse der Lebensqualität, gesundheitsbezogenen Risiken und Verhaltensursachen bei Bachelorstudenten. Es erläutert die Zusammensetzung der Planungsgruppe, die Finanzierung der Intervention und die gewählten Instrumente zur Datenerhebung (Mitarbeiter-/Studierendenbefragung, Experteninterviews und Fokusgruppenbefragung). Die Fokusgruppenbefragung wird als besonders effizientes Instrument zur Identifizierung von Problemen und Defiziten hervorgehoben. Mind-Mapping und Core Processes werden als weitere Methoden innerhalb der Planungsgruppe genannt.
Ergebnisse und Implikationen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Bedarfserhebung, visualisiert im PRECEDE-Logic-Modell (Abbildung 1). Es identifiziert Prokrastination, mangelnde Anpassung an neue Situationen und Vermeidung von Symptomen als zentrale Verhaltensweisen der Risikogruppe. Wichtige Stressfaktoren sind Unklarheit, Unstrukturiertheit, hoher Zeitaufwand, familiäre Konflikte und finanzielle Sorgen. Die hohe Prävalenz von Prokrastination (ca. 70%) wird als ein wesentlicher Faktor für die Verschärfung des Stresserlebens hervorgehoben.
Matrizen - Schritt Zwei: (Anmerkung: Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Methoden und Anwendungen - Schritt Drei: Dieses Kapitel beschreibt die theoretische Fundierung des Interventionsprogramms durch das Elaboration-Likelihood Modell (ELM) und präsentiert akteurzentrierte Methoden und Anwendungen. Die genauere Beschreibung der angewandten Methoden fehlt im vorliegenden Textauszug.
Programmentwicklung - Schritt Vier: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Interventionsprogramms, einschließlich des Ablaufs des Gesundheitsprogramms. Konkrete Details zum Ablauf des Programms fehlen im vorliegenden Textauszug.
Implementationsplanung - Schritt Fünf: (Anmerkung: Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Evaluationsplanung Schritt Sechs: (Anmerkung: Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Schlüsselwörter
Stressprävention, Stressregulierung, Studierende, Hochschule, Intervention Mapping, PRECEDE-Modell, Elaboration-Likelihood Modell (ELM), Prokrastination, Gesundheitsförderung, Stressbewältigung, Bedürfnisanalyse.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Students Stress Project"
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit entwickelt ein fiktives Interventionsprogramm namens "Students Stress Project" zur Stressprävention und -regulierung bei Studierenden. Das Programm basiert auf dem Intervention Mapping Ansatz und dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus und berücksichtigt sowohl individuelle als auch organisationale Ebenen der Stressbewältigung.
Welche Methoden werden in der Seminararbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet den Intervention Mapping Ansatz, das PRECEDE-Modell zur Bedürfnisanalyse, das Elaboration-Likelihood Modell (ELM) als theoretische Grundlage und akteurzentrierte Methoden. Zu den Datenerhebungsinstrumenten gehören Mitarbeiter-/Studierendenbefragungen, Experteninterviews und Fokusgruppenbefragungen. Weitere genannte Methoden sind Mind-Mapping und Core Processes innerhalb der Planungsgruppe.
Welche Stressfaktoren werden bei Studierenden untersucht?
Die Bedürfnisanalyse identifiziert Prokrastination, mangelnde Anpassung an neue Situationen, Vermeidung von Symptomen, Unklarheit, Unstrukturiertheit, hoher Zeitaufwand, familiäre Konflikte und finanzielle Sorgen als zentrale Stressfaktoren bei Studierenden. Die hohe Prävalenz von Prokrastination (ca. 70%) wird besonders hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und den theoretischen Rahmen), Bedürfnisanalyse (Anwendung des PRECEDE-Modells), Ergebnisse und Implikationen der Bedürfnisanalyse (Präsentation der Ergebnisse und Schlüsselfaktoren), Matrizen (Kapitel ohne detaillierte Informationen im vorliegenden Text), Methoden und Anwendungen (Beschreibung des ELM und akteurzentrierter Methoden), Programmentwicklung (Entwicklung des Interventionsprogramms), Implementationsplanung (ohne detaillierte Informationen im vorliegenden Text) und Evaluationsplanung (ohne detaillierte Informationen im vorliegenden Text).
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Seminararbeit basiert auf dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus und dem Intervention Mapping Ansatz. Das Elaboration-Likelihood Modell (ELM) dient als theoretische Fundierung des Interventionsprogramms.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Ziel ist die Konzeptionierung eines Interventionsprogramms, das sowohl individuelle als auch organisationale Ebenen der Stressbewältigung bei Studierenden berücksichtigt. Es soll dazu beitragen, Stressprävention und -regulierung an Hochschulen zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Stressprävention, Stressregulierung, Studierende, Hochschule, Intervention Mapping, PRECEDE-Modell, Elaboration-Likelihood Modell (ELM), Prokrastination, Gesundheitsförderung, Stressbewältigung, Bedürfnisanalyse.
- Citation du texte
- Master of Arts Sascha Schmid (Auteur), 2011, Intervention Mapping. Stressprävention und Stressregulierung im Setting Hochschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265614