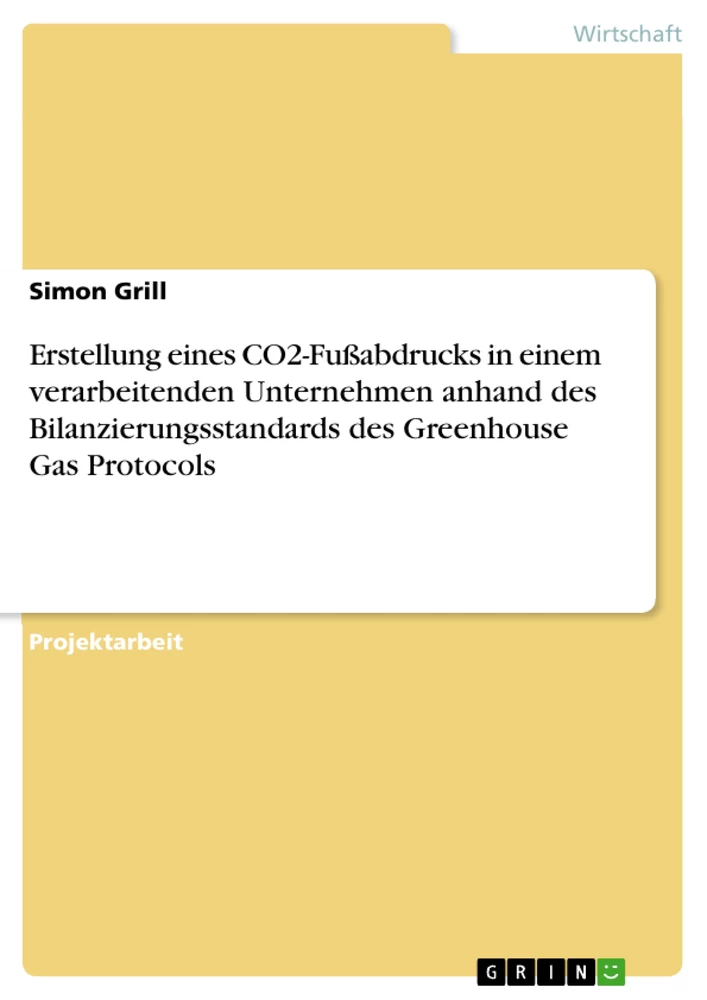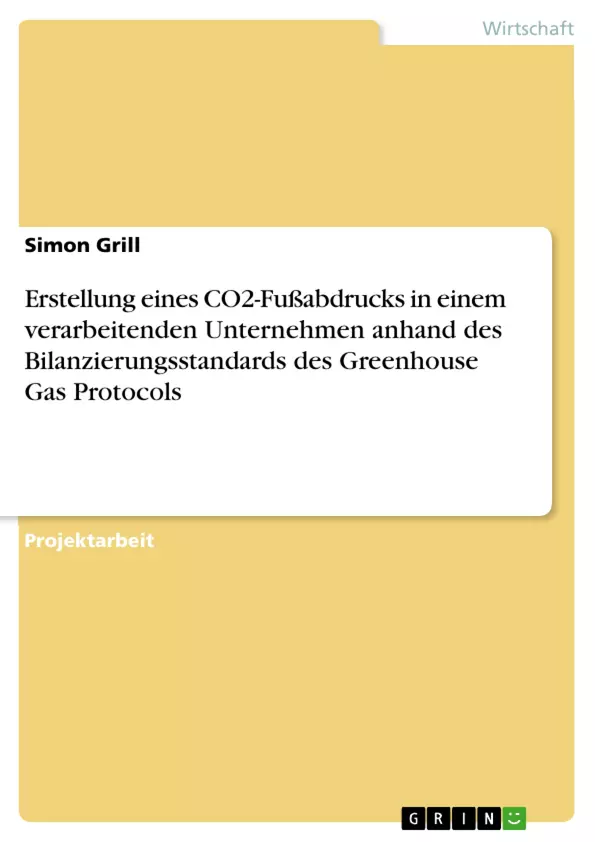In den letzten Jahren haben sich Nachhaltigkeitsberichte mit rasanter Geschwindigkeit zu einem sehr wichtigen Öffentlichkeitsinstrument von Unternehmen entwickelt. Neben den obligatorischen Geschäftsberichten veröffentlichen vor allem immer mehr Großkonzerne diese Berichte. Im Jahr 2002 veröffentlichten ca. 40 % der 250 weltweit größten Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht. Im Jahr 2008 bereits knapp 80 %. Dieser Trend wird zurzeit vor allem von kleinen und mittelständischen Unternehmen aufgegriffen. Insbesondere im Mittelstand bietet eine Fokussierung auf Treibhausgasemissionen eine gute Alternative zu einer umfangreichen Betrachtung, da mit der Erstellung des Carbon Footprints viele Ziele eines umfangreichen Nachhaltigkeitsberichts erreicht werden können und die Bedeutung von klimawirksamen Emissionen ohnehin eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Nachhaltigkeitsstrategien spielt. Vor diesem Hintergrund etabliert sich der Carbon Footprint als modernes zukunftsweisendes Instrument zur Initiierung von Veränderungsprozessen und deren Kommunikation im Unternehmen und in der Öffentlichkeit. Schon Albert Einstein wusste: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unternehmensprofil
- Umweltpolitik in Deutschland
- Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil
- Das Umweltcontrolling
- Funktionen des Umweltcontrollings
- Umweltcontrolling als Chance für Unternehmen
- Carbon Footprint und Greenhouse Gas Protocol
- Grundlagen und Einführung in die C02-Bilanzierung
- Scope 1 — Direkte Emissionen, vom Unternehmen kontrolliert
- C02-Emissionen durch die erdgasbetriebenen Heizungsanlagen
- C02-Emissionen durch den Fuhrpark
- Scope 2 — Indirekte Emissionen, zugekaufter Energie
- C02-Emissionen durch den Stromverbrauch
- C02-Emissionen durch den Druckluftverbrauch
- Scope 3 — Indirekte Emissionen, Beispiele
- C02-Emissionen durch den Mitarbeiterverkehr
- C02-Emissionen durch die Geschäftsreisen
- Darstellung der Ergebnisse
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Erstellung eines Corporate Carbon Footprint (CCF) für ein verarbeitendes Unternehmen, [Unternehmen 1], nach den Bilanzierungsstandards des Greenhouse Gas Protocols. Die Arbeit soll einen Einblick in die C02-Emissionen des Unternehmens geben und gleichzeitig die Bedeutung von Umweltcontrolling und Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil verdeutlichen.
- Die Bedeutung von Umweltcontrolling und Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil
- Die Ermittlung des Corporate Carbon Footprint nach den Standards des Greenhouse Gas Protocols
- Die Analyse der direkten und indirekten C02-Emissionen des Unternehmens
- Die Identifizierung von Handlungsansätzen zur Reduzierung der C02-Emissionen
- Die Darstellung der Ergebnisse und die Ableitung von Empfehlungen für das Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung von Nachhaltigkeitsberichten und die steigende Relevanz des Carbon Footprints als Instrument zur Initiierung von Veränderungsprozessen in Unternehmen.
Das Unternehmensprofil stellt [Unternehmen 1] und seine Geschäftstätigkeit vor.
Das Kapitel „Umweltpolitik in Deutschland" beleuchtet die Bedeutung des Umweltschutzes in Deutschland und die Rolle des Kyoto-Protokolls.
Das Kapitel „Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil" behandelt die Bedeutung von Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor und erklärt das Dreisäulenmodell der Nachhaltigkeit.
Das Kapitel „Das Umweltcontrolling" erläutert die Funktionen und die Bedeutung des Umweltcontrollings für Unternehmen.
Das Kapitel „Carbon Footprint und Greenhouse Gas Protocol" definiert den Corporate Carbon Footprint und den Product Carbon Footprint und stellt das Greenhouse Gas Protocol als Standard zur Ermittlung des CCF vor.
Das Kapitel „Grundlagen und Einführung in die C02-Bilanzierung" beschreibt die Prinzipien des GHG-Protocols und die Einteilung der Emissionen in die drei Scopes.
Die Kapitel „Scope 1 — Direkte Emissionen, vom Unternehmen kontrolliert" und „Scope 2 — Indirekte Emissionen, zugekaufter Energie" analysieren die direkten und indirekten C02-Emissionen des Unternehmens, die aus dem Verbrauch von Erdgas, Strom und Druckluft resultieren.
Das Kapitel „Scope 3 — Indirekte Emissionen, Beispiele" betrachtet die C02-Emissionen aus dem Mitarbeiterverkehr und den Geschäftsreisen.
Das Kapitel „Darstellung der Ergebnisse" fasst die Ergebnisse der C02-Bilanzierung zusammen und stellt die wichtigsten Emissionsquellen des Unternehmens dar.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Corporate Carbon Footprint, das Greenhouse Gas Protocol, die C02-Bilanzierung, Umweltcontrolling, Nachhaltigkeit, Wettbewerbsvorteil, Energieeffizienz, Mitarbeiterbeteiligung, Umweltschutz und Ressourcenschonung. Die Arbeit analysiert die C02-Emissionen eines verarbeitenden Unternehmens, [Unternehmen 1], und zeigt Handlungsansätze zur Reduzierung der Emissionen auf.
Häufig gestellte Fragen zur Erstellung eines CO2-Fußabdrucks
Was ist ein Corporate Carbon Footprint (CCF)?
Ein CCF ist die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen, die ein Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums direkt oder indirekt verursacht.
Was regelt das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)?
Das GHG Protocol ist der weltweit am weitesten verbreitete Standard zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen und unterteilt diese in Scope 1, 2 und 3.
Was ist der Unterschied zwischen Scope 1, 2 und 3?
Scope 1 umfasst direkte Emissionen (z. B. Heizung, Fuhrpark), Scope 2 indirekte Emissionen aus zugekaufter Energie (Strom) und Scope 3 sonstige indirekte Emissionen (z. B. Geschäftsreisen, Pendelverkehr).
Warum ist Nachhaltigkeit ein Wettbewerbsvorteil?
Unternehmen können durch CO2-Bilanzierung Kosten senken (Energieeffizienz), ihr Image verbessern und gesetzliche Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung frühzeitig erfüllen.
Welche Rolle spielt das Umweltcontrolling?
Das Umweltcontrolling dient als Steuerungs- und Informationsinstrument, um Umweltziele festzulegen, Verbräuche zu überwachen und Reduktionsmaßnahmen einzuleiten.
- Arbeit zitieren
- Simon Grill (Autor:in), 2012, Erstellung eines CO2-Fußabdrucks in einem verarbeitenden Unternehmen anhand des Bilanzierungsstandards des Greenhouse Gas Protocols, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265670