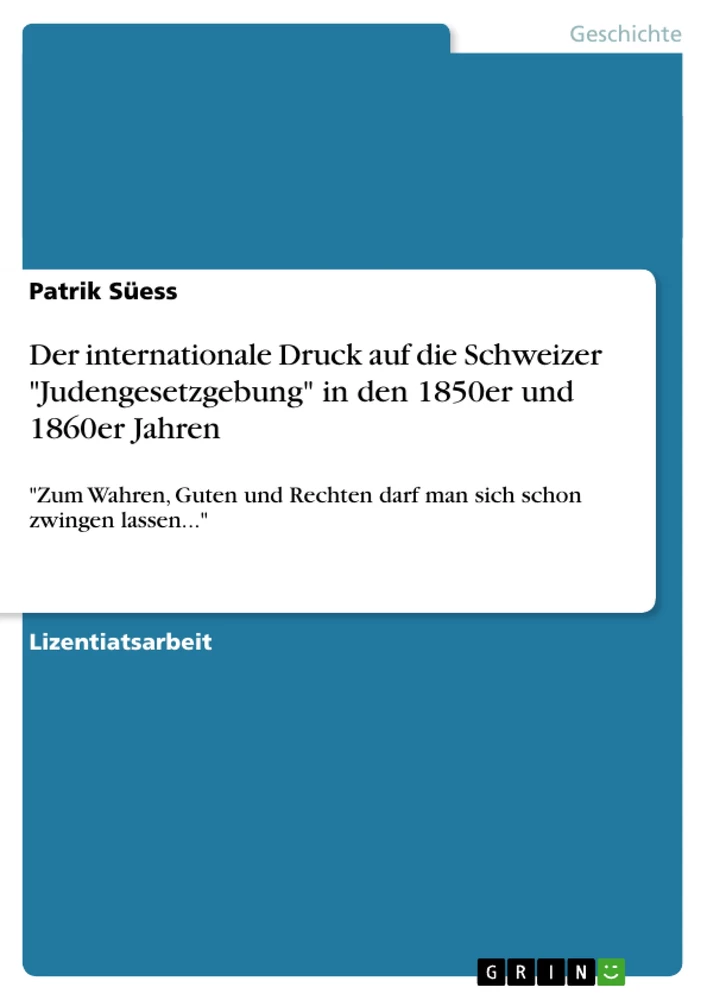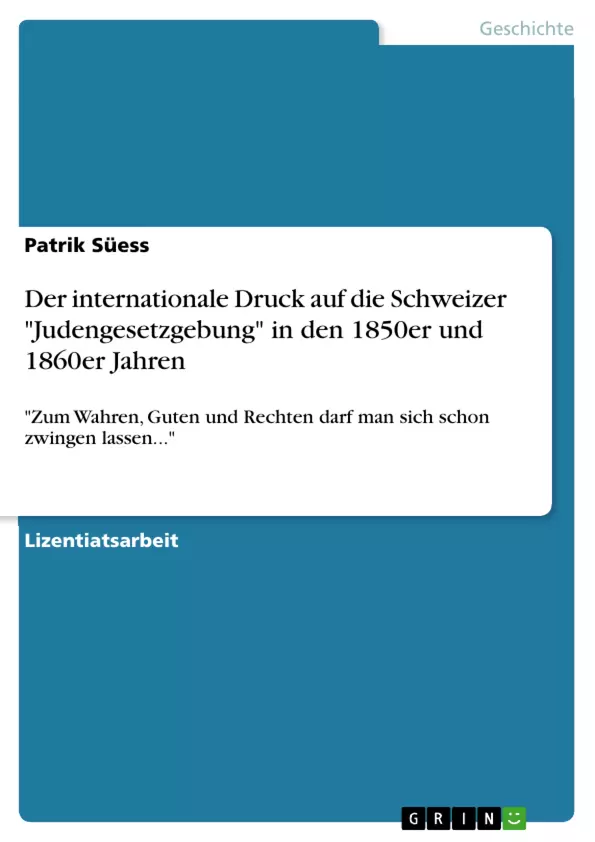Die folgende Arbeit beschäftigt sich, allgemein gesprochen, mit der Geschichte der Emanzipation,
also der bürgerlichen Gleichstellung, der Juden in der Schweiz. Hauptsächlich wird
sich die Analyse auf die Zeit von der Gründung des modernen schweizerischen Bundesstaates
von 1848 bis zur Teilrevision der Bundesverfassung von 1866 erstrecken, als die Sonderbestimmungen
für „Nicht-Christen“ endgültig beseitigt wurden; der Fokus der Arbeit wird auf
den Einfluss des Auslandes auf die Entwicklung der „Judengesetzgebung“ der Eidgenossenschaft
gerichtet sein.
Damit behandelt die Arbeit einen Teilbereich sowohl der Schweizer Geschichte als auch der
jüdischen Geschichte im „Westen“, also dem europäisch-amerikanischen Teil der Welt, der
seit dem 18. Jahrhundert von Aufklärung und Industrialisierung geprägt war. Es ist daher unerlässlich,
einführend erstens die Spezifika der Schweizer nationalen Geschichte im europäischen
Umfeld bis zur Bundesstaatsgründung zu thematisieren, wie auch, zweitens, den Gang
der Emanzipation der Juden in Europa zu behandeln. Hierzu gehört sowohl eine Analyse der
zu diesem Themenkomplex geführten gelehrten Diskussionen, als auch die Thematisierung
der diese Diskussion ständig begleitenden Judenfeindschaft. Ihre Beharrungskraft, aber auch
ihre Transformation und Neuformulierung im Verlaufe des Zeitalters der Aufklärung und des
19. Jahrhunderts wird untersucht werden.
Diese zwei einleitenden Themenbereiche werden mich zu meinen Fragen und Thesen führen.
Im ersten Einleitungskapitel werde ich die spezifisch schweizerische Entwicklung des Nationsgedankens
verfolgen, der spätestens mit der Gründung des Bundesstaates zentral wurde
für die Frage, wer als Bürger der Nation in Frage kam und wer nicht. Die Frage zu diesem
Kapitel lautet also: Hatte der Schweizer Nations- und Bürgerbegriff und damit die schweizerische
Praxis der Einbürgerung einen Einfluss auf die anfängliche Ausschliessung der Juden
vom Vollbürgerstatus?
Das zweite Einleitungskapitel wird die seit der Aufklärung in Gang gekommene Diskussion
um den Status der Juden in einer mehrheitlich christlichen Umgebung in Europa knapp skizzieren,
und dabei beide Seiten, die konservative und die bürgerlich-progressive, und ihre jeweiligen
Argumente vorstellen. Die Frage dabei wird lauten: Gab es eine spezifisch liberalbürgerliche
Aversion gegen die Juden bzw. deren Emanzipation, die sich im Schweizer Fall
ab 1848 hatte geltend machen können? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Begriffe , Antijudaismus' und , Antisemitismus'
- Literatur und Quellen
- Ideengeschichtliche Grundlagen I
- Die Schweiz auf dem Weg zur bürgerlichen , Nation' bis 1848
- Vorstellungen von ,Nation' und , Vaterland' in der Schweiz
- Bürgerlichkeit und Souveränität — Individuelle vs. Kollektive Freiheit
- Bürger und Bürgerrecht
- Krise und Nationalismus in den 1840er Jahren
- Ideengeschichtliche Grundlagen 11
- Aufldärung und Judenfeindlichkeit
- Konservativ-traditioneller Antijudaismus
- , Aufgeklärter' Antisemitismus
- Die Juden in der Schweiz — Die Rahmenbedingungen
- Die Rechtsentwicklung bis 1848
- Die Bundesverfassung von 1848
- Erste internationale Verstimmungen nach 1848
- Jüdische Flüchtlinge in der Schweiz 1848/49
- Die französischen Interventionen von 1851/52
- Der Weg zum Bundesbeschluss von 1856
- Die Fälle Luzem und Zürich
- Die Kantone und die , Judenfrage' im Jahre 1855
- Die Handelsverträge der 1850er Jahre — und ihre Folgen
- Der Handelsvertrag mit den USA
- Die Handelsverträge mit Grossbritannien und Belgien
- Die Agitation des amerikanischen Botschafters Theo S. Fay
- Fays Denkschrift von 1859
- Reaktionen auf Fays Denkschrift
- Weitere interne Entwicklungen — Die Emanzipationskämpfe im Kanton Aargau 1861 - 1863
- Politische Voraussetzungen
- Die Debatte im Aargauer Grossen Rat
- Volksproteste und Rücknahme des Emanzipationsgesetzes
- Das Einschreiten der Bundesbehörden
- Die Verträge mit Frankreich I — Die Verhandlungen 1863-64
- Frankreichs Wende zum Freihandel
- Bundesrätliche Sondierungen in der Schweiz
- Auffahme der Verhandlungen in Paris
- Die letzte Verhandlungsphase
- Die Verträge mit Frankreich 11 — Die Diskussionen in den Eidgenössischen Räten 1864
- Die Botschaften und Berichte des Bundesrates und der Bundesversammlung
- Die Debatte im Nationalrat
- Die Debatte im Ständerat
- Grundsätzliche Opposition eines Konservativen: Die Denkschrift Philipp Anton von Segessers
- Die Replik von Bundespräsident Jakob Dubs
- Die Teilrevision der Bundesverfassung von 1866
- Die Reaktionen der Kantone
- Die Haltung des Bundes
- Obstruktion bis zuletzt: Der Fall Basel-Land
- Die Annahme der Verfassungsrevision
- Fazit: Jüdische Emanzipation im freisinnigen Bundesstaat
- Bibliographie
- Literatur
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lizentiatsarbeit analysiert die Geschichte der Emanzipation der Juden in der Schweiz vom 18. Jahrhundert bis zur Teilrevision der Bundesverfassung von 1866, mit einem Schwerpunkt auf den Einfluss des Auslandes auf die Entwicklung der „Judengesetzgebung" der Eidgenossenschaft.
- Die Entwicklung des Schweizer Nationsgedankens und seine Auswirkungen auf die Einbürgerung von Juden
- Die Debatte um den Status der Juden in Europa seit der Aufklärung und ihre Relevanz für die Schweizer Situation
- Die Rolle des strukturkonservativen Föderalismus in der Schweiz und seine Auswirkungen auf die Gleichstellung der Juden
- Der Einfluss von internationalen Verträgen und diplomatischen Interventionen auf die „Judengesetzgebung" der Schweiz
- Die Rolle von antijüdischen Stereotypen und Ressentiments in der Schweizer Gesellschaft und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Geschichte der Emanzipation der Juden in der Schweiz und stellt die wichtigsten Fragen und Thesen der Arbeit vor. Sie untersucht die Entwicklung des Schweizer Nationsgedankens und die Debatte um den Status der Juden in Europa seit der Aufklärung.
Das erste Kapitel beleuchtet die Schweizer nationale Geschichte im europäischen Umfeld bis zur Bundesstaatsgründung und untersucht die Vorstellung von ,Nation' und ,Vaterland' in der Schweiz. Es analysiert die Rolle der traditionellen Freiheitskonzepte und die Bedeutung der Bürgerlichkeit und Souveränität für die Einbürgerungsfrage.
Das zweite Kapitel widmet sich der Diskussion um den Status der Juden in einer mehrheitlich christlichen Umgebung in Europa. Es stellt die Argumente der konservativen und der bürgerlich-progressiven Seite vor und untersucht die Rolle des Antijudaismus in der Aufldärung.
Das dritte Kapitel analysiert die rechtliche Entwicklung der Juden in der Schweiz bis 1848 und untersucht die Auswirkungen der Bundesverfassung von 1848 auf die Gleichstellung der Juden. Es beleuchtet die ersten internationalen Verstimmungen nach 1848, insbesondere die Situation der jüdischen Flüchtlinge und die diplomatischen Interventionen Frankreichs.
Das vierte Kapitel untersucht den Weg zum Bundesbeschluss von 1856 und analysiert die Fälle Luzern und Zürich. Es beschreibt die Situation der Kantone im Hinblick auf die „Judenfrage" im Jahre 1855 und die Interpretation der Bundesverfassung durch den Bundesrat.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Handelsverträgen der 1850er Jahre und untersucht den Einfluss des Handelsvertrages mit den USA auf die „Judengesetzgebung" der Schweiz. Es beleuchtet die Agitation des amerikanischen Botschafters Theo S. Fay und seine Denkschrift von 1859, sowie die Reaktionen auf diese Schrift.
Das sechste Kapitel analysiert die Emanzipationskämpfe im Kanton Aargau von 1861 bis 1863 und untersucht die politischen Voraussetzungen, die Debatte im Grossen Rat, die Volksproteste und das Einschreiten der Bundesbehörden.
Das siebte Kapitel beleuchtet die Verhandlungen über den Handelsvertrag mit Frankreich von 1863 bis 1864 und untersucht die Wende Frankreichs zum Freihandel, die bundesrätlichen Sondierungen in der Schweiz, die Aufnahme der Verhandlungen in Paris und die letzte Verhandlungsphase.
Das achte Kapitel analysiert die Diskussionen in den eidgenössischen Räten über die Verträge mit Frankreich im Jahre 1864. Es untersucht die Botschaften und Berichte des Bundesrates und der Bundesversammlung, die Debatten im Nationalrat und im Ständerat, sowie die grundsätzliche Opposition eines Konservativen und die Replik von Bundespräsident Jakob Dubs.
Das neunte Kapitel beleuchtet die Teilrevision der Bundesverfassung von 1866 und untersucht die Reaktionen der Kantone, die Haltung des Bundes, die Obstruktion im Fall Basel-Land und die Annahme der Verfassungsrevision.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Emanzipation der Juden in der Schweiz, die „Judengesetzgebung", den Einfluss des Auslandes, den Schweizer Nationsgedanken, die Debatte um den Status der Juden in Europa seit der Aufklärung, den strukturkonservativen Föderalismus, internationale Verträge, diplomatische Interventionen, antijüdische Stereotypen, Ressentiments, die Rolle des Liberalismus und die Entwicklung der Schweizer Gesellschaft und Politik im 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wann erhielten Juden in der Schweiz die volle Gleichstellung?
Die rechtliche Gleichstellung wurde schrittweise erreicht, ein entscheidender Meilenstein war die Teilrevision der Bundesverfassung von 1866.
Welchen Einfluss hatte das Ausland auf die Schweizer Judengesetzgebung?
Internationaler Druck, insbesondere durch Handelsverträge mit Frankreich, den USA und Großbritannien, zwang die Schweiz zur Beseitigung diskriminierender Sonderbestimmungen.
Warum wehrten sich viele Kantone gegen die jüdische Emanzipation?
Gründe waren tief verwurzelter Antijudaismus, wirtschaftliche Ängste und das Festhalten an einem christlich geprägten Bürgerbegriff.
Was war die Bedeutung der Denkschrift von Theo S. Fay?
Der amerikanische Botschafter Fay agitierte 1859 massiv gegen die Benachteiligung amerikanisch-jüdischer Bürger in der Schweiz und löste damit wichtige interne Debatten aus.
Wie unterschied sich "aufgeklärter" Antisemitismus vom traditionellen Antijudaismus?
Während der traditionelle Antijudaismus religiös motiviert war, nutzte der "aufgeklärte" Antisemitismus bürgerlich-progressive Argumente zur Ausgrenzung.
- Citar trabajo
- Patrik Süess (Autor), 2013, Der internationale Druck auf die Schweizer "Judengesetzgebung" in den 1850er und 1860er Jahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265858