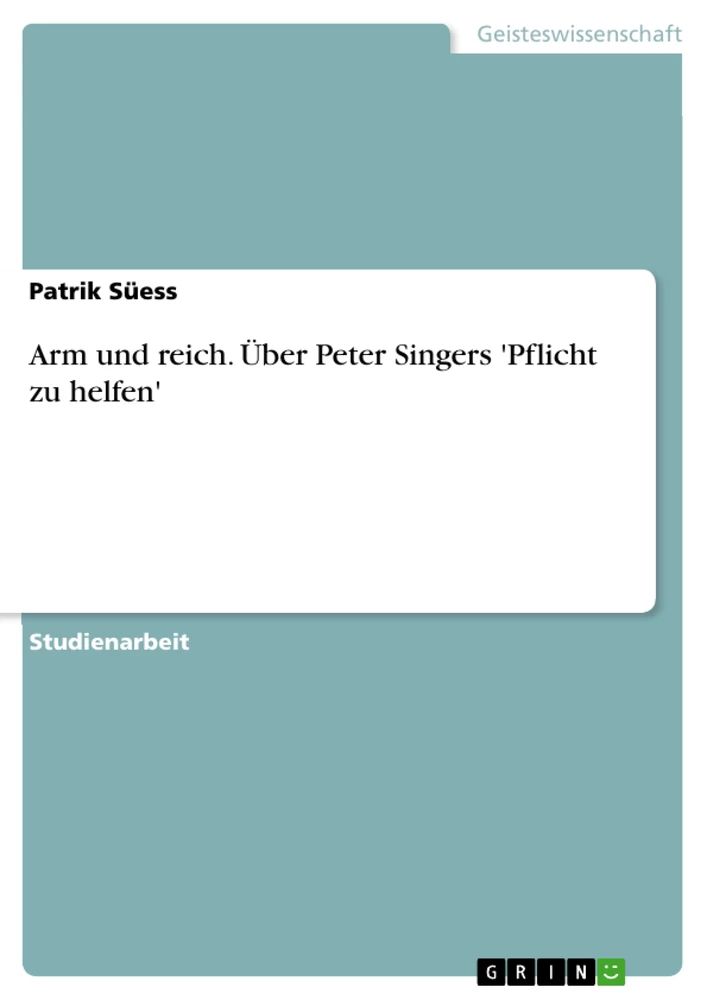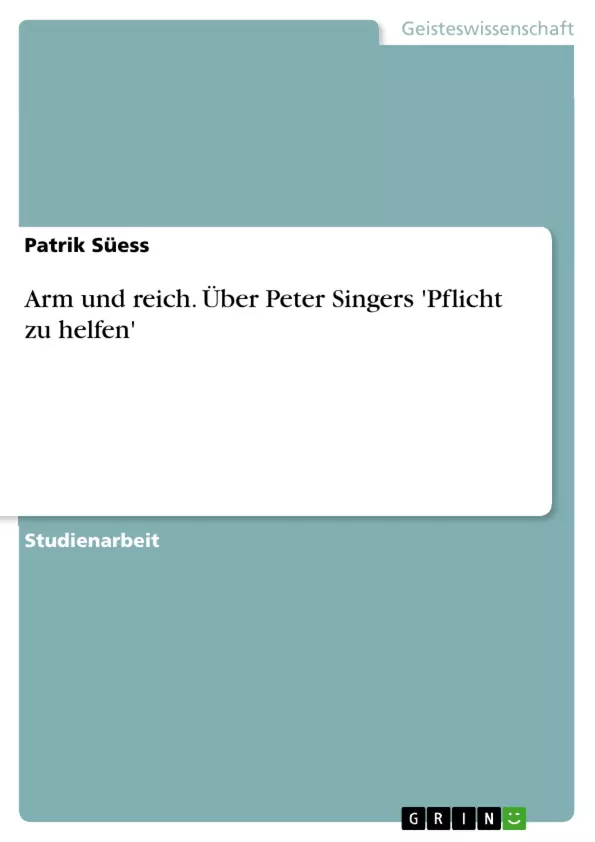Singer wartet im Kapitel „Arm und Reich“ seiner Praktischen Ethik mit Fakten auf, die im Grunde jedem bekannt sind, und deren schreckliche Realität und Dringlichkeit kaum bestritten werden dürften: es gibt in der Welt ein drastisches Wohlstandsgefälle, und zwar eines, das die Menschen auf der untersten Stufe der Verteilungsskala in unbeschreiblichem Elend dahinvegetieren lässt – ein Zustand, den Singer (mit dem ehemaligen Chef der Weltbank McNamarra) als „absolute Armut“ bezeichnet. Absolute Armut verhindert ein Leben, das den bescheidensten Ansprüchen von Menschenwürde entsprechen könnte. So ist das Problem der absoluten Armut zuallererst noch kein Problem der Wohlstandsdifferenzen an sich bzw. kein Problem der Verteilungsgerechtigkeit, sondern ein Problem des akuten Notfalls, ein Problem der Ersten Hilfe sozusagen. Es geht um die Rettung von Millionen Menschen vor nichts weniger als dem Hungertod.
Inhaltsverzeichnis
- Das Problem
- Singers Lösungsvorschlag
- Singers Antworten auf mögliche Kritikpunkte
- Singers Konklusion
- Singers Thesen im Lichte der grossen Moraltheorien
- Utilitarismus und Deontologie — mögliche Verbündete?
- Rekonstruktiv vs. Revisionistisch — Tugendethik und Kasuistik
- Zur Tugendethik
- Zur Kasuistik
- „Pflicht zu helfen" im Utilitarismus?
- Ein praktisches Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Peter Singers Argumentation in seinem Essay „Arm und Reich" aus dem Buch „Praktische Ethik". Die Arbeit analysiert Singers Lösungsvorschläge zur Bekämpfung extremer Armut und setzt diese in den Kontext verschiedener ethischer Theorien, um deren Stärken und Schwächen zu beleuchten.
- Die moralische Pflicht zur Hilfeleistung bei extremer Armut
- Singers utilitaristische Argumentation
- Kritik an Singers Ansichten und deren ethische Fundierung
- Die Rolle von Tugendethik und Kasuistik
- Die Grenzen des Utilitarismus bei der Lösung globaler Probleme
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Problem der extremen Armut in der Welt dar und zeigt auf, dass Millionen von Menschen an Hunger und Krankheit sterben. Singer argumentiert, dass wir, die in Wohlstandsgesellschaften leben, eine moralische Pflicht haben, diesen Menschen zu helfen, da wir über Ressourcen verfügen, die wir für Luxusgüter ausgeben könnten.
Im zweiten Kapitel präsentiert Singer seinen Lösungsvorschlag: Wir sollten einen erheblichen Teil unseres Einkommens, das wir nicht für unsere Grundbedürfnisse benötigen, an Hilfsorganisationen spenden, um die Not der Armen zu lindern. Er argumentiert, dass diese Verpflichtung absolut ist und nicht an Bedingungen geknüpft ist, wie z.B. Nähe oder Verwandtschaft.
Singers Argumentation wird im dritten Kapitel im Lichte verschiedener ethischer Theorien beleuchtet. Dabei wird deutlich, dass sowohl utilitaristische als auch deontologische Theorien eine absolute Hilfspflicht beinhalten können. Allerdings wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Utilitarismus mit seiner Fokussierung auf den Gesamtnutzen tatsächlich in der Lage ist, absolute Pflichten zu begründen.
Im vierten Kapitel werden die Grenzen von Singers Theorie aufgezeigt. Es wird argumentiert, dass seine Argumentation die Komplexität des Problems der Armut in der Welt vereinfacht und die Rolle von Politik und Wirtschaft vernachlässigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die absolute Armut, die moralische Pflicht zu helfen, den Utilitarismus, die Tugendethik, die Kasuistik, die Kritik an Singers Ansichten und die Grenzen des Utilitarismus bei der Lösung globaler Probleme. Der Text analysiert Singers Argumentation in Bezug auf die ethische Fundierung seiner Forderungen und setzt diese in den Kontext verschiedener ethischer Theorien.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Peter Singer unter „absoluter Armut“?
Absolute Armut bezeichnet einen Zustand unbeschreiblichen Elends, der ein Leben nach bescheidensten Ansprüchen der Menschenwürde unmöglich macht und zum Hungertod führt.
Warum haben wir laut Singer eine „Pflicht zu helfen“?
Singer argumentiert utilitaristisch: Wenn wir etwas Schreckliches verhindern können, ohne etwas von vergleichbarer moralischer Bedeutung zu opfern, sind wir moralisch dazu verpflichtet.
Wie viel sollte man laut Singer spenden?
Er schlägt vor, dass Menschen in Wohlstandsgesellschaften einen erheblichen Teil ihres Einkommens, den sie nicht für Grundbedürfnisse benötigen, für die Rettung von Menschenleben geben sollten.
Was ist die utilitaristische Basis seiner Argumentation?
Der Utilitarismus zielt auf die Maximierung des Gesamtnutzens ab. Da Geld für einen Armen lebensrettend ist, für einen Reichen aber nur Luxus bedeutet, ist die Umverteilung moralisch geboten.
Welche Kritik wird an Singers Thesen geübt?
Kritiker bemängeln, dass seine Forderungen zu radikal seien, die Komplexität globaler Politik vernachlässigen und die individuelle Freiheit übermäßig einschränken könnten.
- Arbeit zitieren
- Patrik Süess (Autor:in), 2010, Arm und reich. Über Peter Singers 'Pflicht zu helfen', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265908