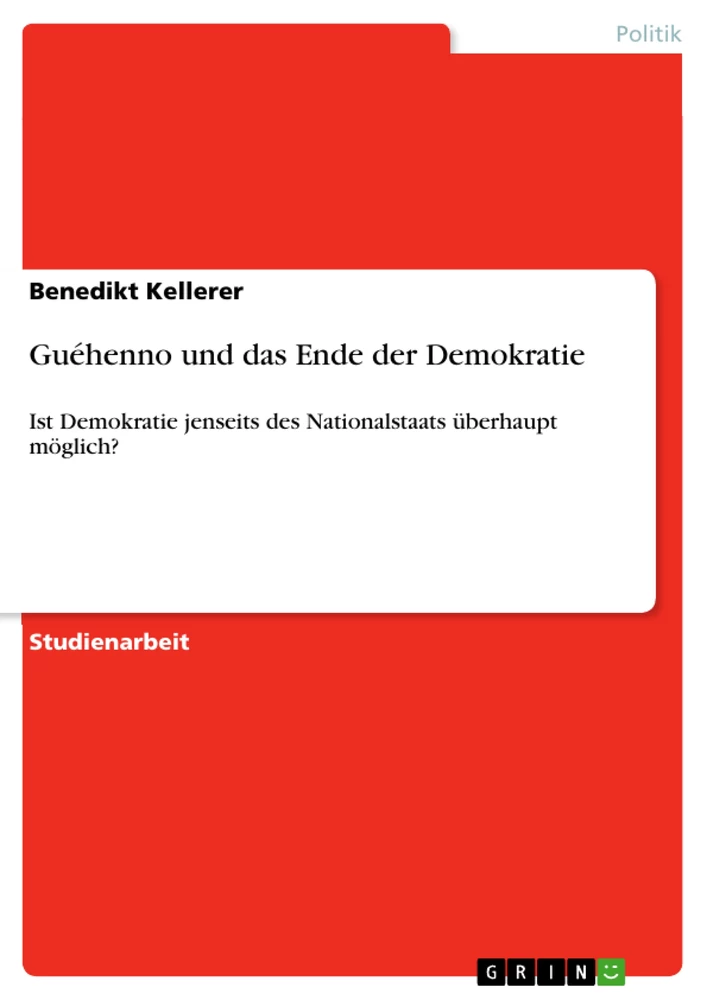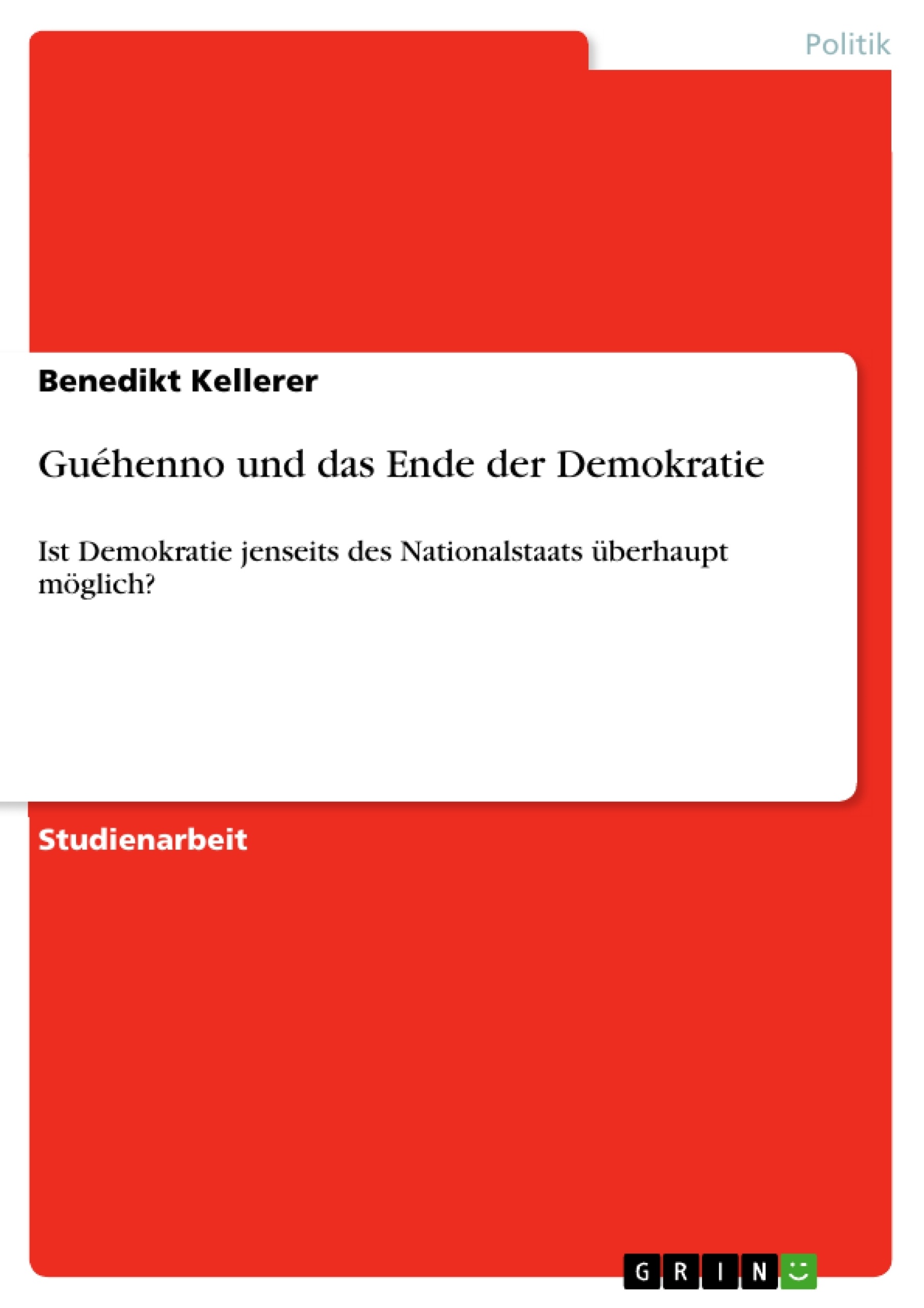„Demokratie ist ein umfassendes Ziel, ein immanenter Anspruch auf Rechte der Bürger und Menschen, und von Anfang an ist sie gefährdet“. Die Anfänge der Demokratie reichen mehr als zweitausend Jahre zurück. Nach einer langen Epoche zumeist antidemokratischer Herrschaftsformen breiteten sich Ende des 16. Jahrhunderts immer mehr demokratische Gedanken in Europa aus. Obwohl sich die Demokratie in Frankreich vorerst nicht durchsetzen konnte, schritt die Demokratisierung Europas weiter voran. In Deutschland wurde 1849 in der Paulskirche in Frankfurt die erste demokratische Verfassung ausgerufen, deren Umsetzung jedoch scheiterte.
Nach Ende des Ersten Weltkrieges trat auch in Deutschland zum ersten Mal eine demokratische Verfassung in Kraft, die sich jedoch als nicht standhaft gegenüber der nationalsozialistischen Diktatur erwies. Nicht nur in Deutschland sondern weltweit war die Zahl der demokratischen Staaten in dieser Zeit rückläufig. Dies änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als auch in Deutschland das Grundgesetz eingeführt wurde. Seit diesem Zeitpunkt steigt die Zahl der demokratisch regierten Staaten stetig. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 setzte sich die Demokratie als Herrschaftsform auch in den meisten Staaten des Ostblocks durch. Heute zählt die Organisation Freedom House weltweit 116 Wahldemokratien, von denen sie jedoch nur 93 als komplett freie Staaten betrachtet.
„Das Bewusstsein, eine genau definierte, geographisch abgegrenzte Gemeinschaft zu bilden, die sich auf Dauer behauptet, hat sehr dazu beigetragen, dass die demokratische Antwort sich immer mehr durchsetzte“. Doch ist eine nationalstaatliche Demokratie überhaupt noch zeitgemäß? Ist Demokratie jenseits des Nationalstaats überhaupt möglich? Schließlich wurden die demokratischen Gedanken in einer Zeit geboren, in der sich die Staaten deutlich voneinander abgrenzten und unterschieden. Schreitet mit der weltweiten Vernetzung der Menschen und der zunehmenden Probleme, die nicht mehr nur auf nationalstaatlicher Ebene behandelt wer-den können, nicht auch die Erosion der Demokratie im herkömmlichen Sinne weiter voran? Diesen Fragen und der Zukunftsvision von Jean-Marie Guéhenno, für den das Ende der De-mokratie bereits gekommen ist, wird in dieser Arbeit auf den Grund gegangen. Dafür ist je-doch zuerst notwendig, den traditionellen Begriff der Demokratie und des Nationalstaats kurz zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Die Anfinge der Demokratie
- Demokratie und Nationalstaat
- Das Ende der Demokratie
- Das Ende der Nationen
- Das Ende der Politik
- Dus imperiale Zeitalter
- Demokratie im Zeichen der Denationalisierung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die These von Jean-Marie Guéhenno vom Ende der Demokratie im Kontext der Denationalisierung und der Herausforderungen, die sich für demokratische Systeme im Zuge der Globalisierung stellen. Dabei wird die traditionelle Verbindung von Demokratie und Nationalstaat beleuchtet und die Frage aufgeworfen, ob Demokratie jenseits des Nationalstaats überhaupt noch möglich ist.
- Die Erosion der Demokratie im herkömmlichen Sinne
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf die nationale Souveränität
- Die Rolle von transnationalen Akteuren in der Gestaltung der Weltordnung
- Die Herausforderungen der Demokratisierung jenseits des Nationalstaats
- Die Zukunft der Demokratie im Zeitalter der Denationalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Anfänge der Demokratie und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte. Es werden die wichtigsten Meilensteine der Demokratisierung in Europa und weltweit skizziert, beginnend mit der attischen Demokratie bis hin zur Ausbreitung demokratischer Ideen im 18. Jahrhundert und der Demokratisierungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der traditionellen Verbindung von Demokratie und Nationalstaat. Es werden die wichtigsten Merkmale und Prinzipien beider Konzepte erläutert, wie die Volkssouveränität, die territoriale Abgrenzung, die Gewaltenteilung und das Gewaltmonopol des Staates.
Das dritte Kapitel stellt die Thesen von Jean-Marie Guéhenno vom Ende der Demokratie dar. Guéhenno argumentiert, dass die Globalisierung und die zunehmende Vernetzung der Menschen das Ende der Nation und damit auch das Ende der Politik im herkömmlichen Sinne bewirken. Er beschreibt eine neue Weltordnung, die er als "imperiales Zeitalter" bezeichnet, in der die Macht diffuser und die Grenzen zwischen den Staaten verschwimmen.
Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen der Denationalisierung auf die Demokratie. Es werden die Herausforderungen für demokratische Systeme im Zuge der Globalisierung beleuchtet, wie die Kongruenz- und Gemeinsinnbedingung, die zunehmende Autonomie der politischen Klasse und die wachsende Bedeutung transnationaler Akteure.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Demokratie, Nationalstaat, Denationalisierung, Globalisierung, Jean-Marie Guéhenno, transnationale Akteure, Demokratiedefizit, Mehrebenensysteme, politische Kultur, Weltordnung, Demokratisierung, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Souveränität, "imperiales Zeitalter".
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Jean-Marie Guéhennos These zum Ende der Demokratie?
Guéhenno argumentiert, dass die Globalisierung den Nationalstaat schwächt und damit die traditionelle Basis der Demokratie erodiert, was zu einem „imperialen Zeitalter“ führt.
Warum ist die Demokratie eng mit dem Nationalstaat verknüpft?
Klassische Demokratiekonzepte basieren auf einer klar abgegrenzten Gemeinschaft, Volkssouveränität und einem staatlichen Gewaltmonopol innerhalb fester Grenzen.
Was bedeutet "Denationalisierung" in diesem Kontext?
Denationalisierung beschreibt den Prozess, in dem politische Macht und Entscheidungen von der nationalen Ebene auf transnationale Akteure und globale Netzwerke übergehen.
Was versteht Guéhenno unter dem "imperialen Zeitalter"?
Es ist eine Weltordnung ohne klare Zentren oder Grenzen, in der Macht diffuser verteilt ist und die klassische Politik an Bedeutung verliert.
Kann Demokratie jenseits des Nationalstaats existieren?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und beleuchtet das wachsende Demokratiedefizit in einer vernetzten Welt, in der nationale Souveränität schwindet.
- Arbeit zitieren
- Benedikt Kellerer (Autor:in), 2011, Guéhenno und das Ende der Demokratie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266002