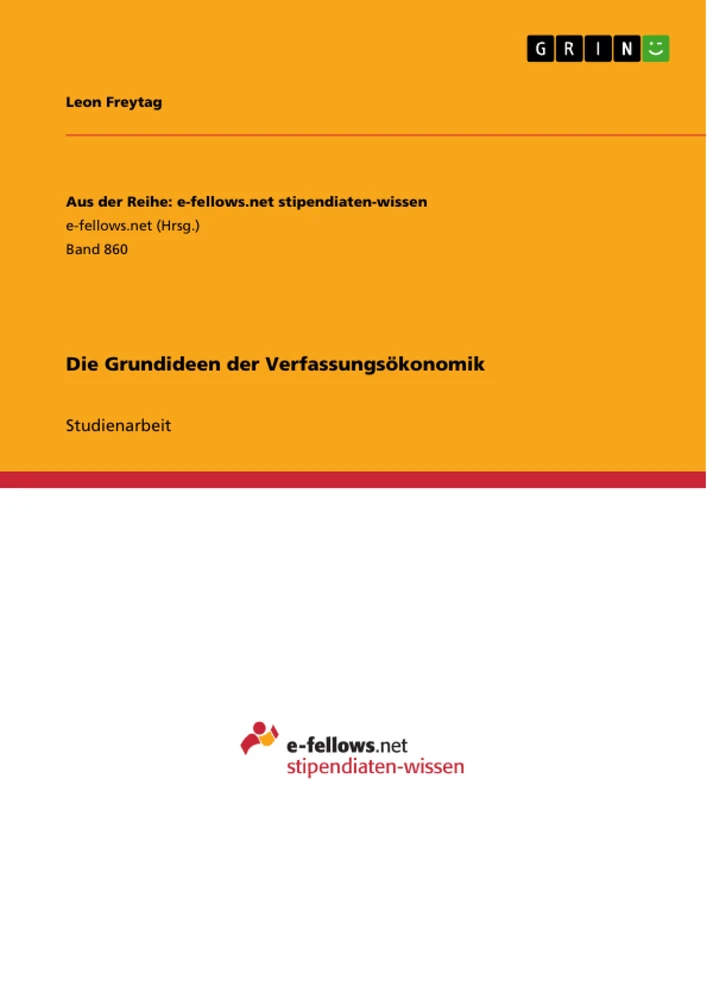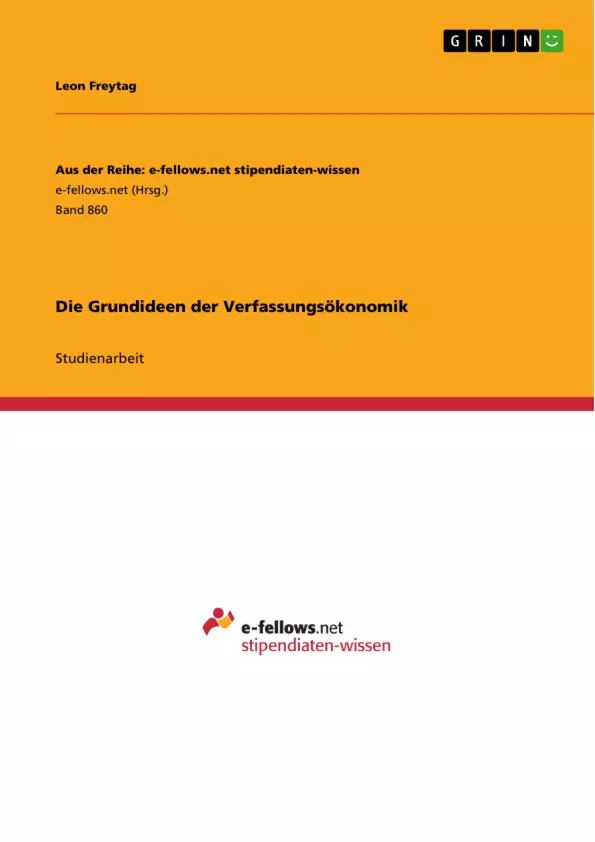Diese Arbeit beschäftigt sich mit den wichtigsten Grundideen der Verfassungsökonomik. Die Verfassung kann hierbei wie die Spielregeln gesehen werden, nach denen sich der Verlauf des Spiels, also des Wirtschaftsprozesses, richtet. Ich werde darlegen, wie die Verfassungsökonomik die Wünschenswertbarkeit von Regeln definiert. Auf welche Weise können die wünschenswertesten Regeln gefunden werden und von wem sollten sie beschlossen werden. Dabei ist besonders wichtig, dass die Verfassungsökonomik nicht auf potentielle Endergebnisse dieser Regeln schielt, sondern daran interessiert ist, wie sich die Regeln auf die Wirtschaftsprozesse auswirken. Buchanan, der bedeutendste Vertreter der Verfassungsökonomik, überträgt die Ideen systematisch auch auf die Politikebene.
Die Verfassungsökonomik steht einerseits der Wohlfahrtsökonomik als Kontrast gegenüber. Andererseits wird diese Arbeit sie mit der ihr von einigen Grundideen ähnlicheren Ordnungstheorie vergleichen, doch auch hier Unterschiede darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Verfassungsökonomik und die Spielregeln.
- Die wichtigsten Ideen und Kriterien der Verfassungsökonomik..
- Das Konsenskriterium: Normative und angewandte Verfassungsökonomik..
- Wahl-Individualismus der Verfassungsökonomik vs Nutzen-Individualismus der Wohlfahrtsökonomik..
- Verfassungsökonomik und das Paradigma der „gains from trade“.
- Konsumentensouveränität auf dem Markt...
- Bürgersouveränität in der Politik.
- Probleme der Regelaufstellung..
- Das Interessen-Problem…......
- Das Theorien-Problem.……....
- Lernen aus Erfahrungen....
- Vergleich mit der Ordnungstheorie..
- Affinitäten....
- Unterschiede
- Abschließender Gedanke: Finden wir die perfekte Regelordnung?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den wichtigsten Grundideen der Verfassungsökonomik. Sie untersucht, wie die Verfassungsökonomik die Wünschenswertbarkeit von Regeln definiert und auf welche Weise die wünschenswertesten Regeln gefunden werden können. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wer diese Regeln beschließen sollte und wie sich die Regeln auf Wirtschaftsprozesse auswirken. Die Arbeit stellt die Verfassungsökonomik als Kontrast zur Wohlfahrtsökonomik dar und vergleicht sie mit der ihr von einigen Grundideen ähnlicheren Ordnungstheorie.
- Das Konsenskriterium als Grundlage für die Legitimität von Regeln
- Der Vergleich von Wahl-Individualismus in der Verfassungsökonomik mit dem Nutzen-Individualismus in der Wohlfahrtsökonomik
- Die Rolle des "gains from trade"-Paradigmas in der Verfassungsökonomik
- Die Bedeutung von Konsumentensouveränität im Markt und Bürgersouveränität in der Politik
- Probleme bei der Festlegung von Regeln, wie Interessenkonflikte und theoretische Unsicherheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Verfassungsökonomik anhand des Gefangenendilemmas und der Theorie des Gesellschaftsvertrags vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Spielregeln und Verträgen für die Gestaltung von Wirtschaftsprozessen und zeigt die Abgrenzung der Verfassungsökonomik zu anderen ökonomischen Denkschulen auf.
Das zweite Kapitel widmet sich den wichtigsten Ideen und Kriterien der Verfassungsökonomik. Es erörtert das Konsenskriterium als zentralen Maßstab für die Legitimität von Regelwerken und vergleicht den Wahl-Individualismus der Verfassungsökonomik mit dem Nutzen-Individualismus der Wohlfahrtsökonomik. Außerdem werden das "gains from trade"-Paradigma, die Konsumentensouveränität im Markt und die Bürgersouveränität in der Politik behandelt.
Schlüsselwörter
Verfassungsökonomik, Spielregeln, Konsens, Wahl-Individualismus, Nutzen-Individualismus, gains from trade, Konsumentensouveränität, Bürgersouveränität, Regelaufstellung, Ordnungstheorie.
Häufig gestellte Fragen zur Verfassungsökonomik
Was sind die Grundideen der Verfassungsökonomik?
Die Verfassungsökonomik betrachtet Regeln als „Spielregeln“ des Wirtschaftsprozesses und untersucht, wie diese Regeln legitimiert und gestaltet werden sollten.
Was besagt das Konsenskriterium?
Es dient als Maßstab für die Wünschenswertbarkeit von Regeln: Nur Regeln, denen alle Beteiligten zustimmen könnten, gelten als legitim und wohlfahrtssteigernd.
Wie unterscheiden sich Wahl-Individualismus und Nutzen-Individualismus?
Die Verfassungsökonomik (Wahl-Individualismus) betont die Freiheit der Wahl von Regeln, während die Wohlfahrtsökonomik (Nutzen-Individualismus) auf die Maximierung von Endergebnissen zielt.
Was ist Bürgersouveränität in der Politik?
Analog zur Konsumentensouveränität im Markt fordert die Verfassungsökonomik, dass Bürger die Regeln ihrer politischen Ordnung selbst bestimmen und kontrollieren.
Wer ist James M. Buchanan in diesem Kontext?
Buchanan ist der bedeutendste Vertreter der Verfassungsökonomik; er übertrug ökonomische Prinzipien systematisch auf die Analyse politischer Verfassungen.
- Citar trabajo
- Leon Freytag (Autor), 2013, Die Grundideen der Verfassungsökonomik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266005