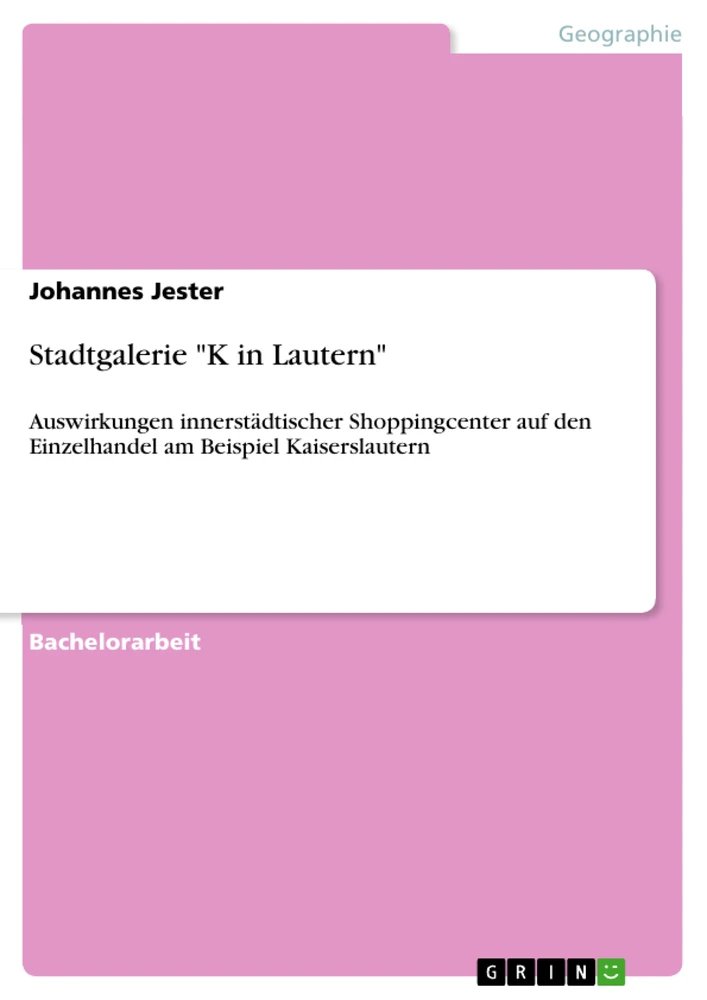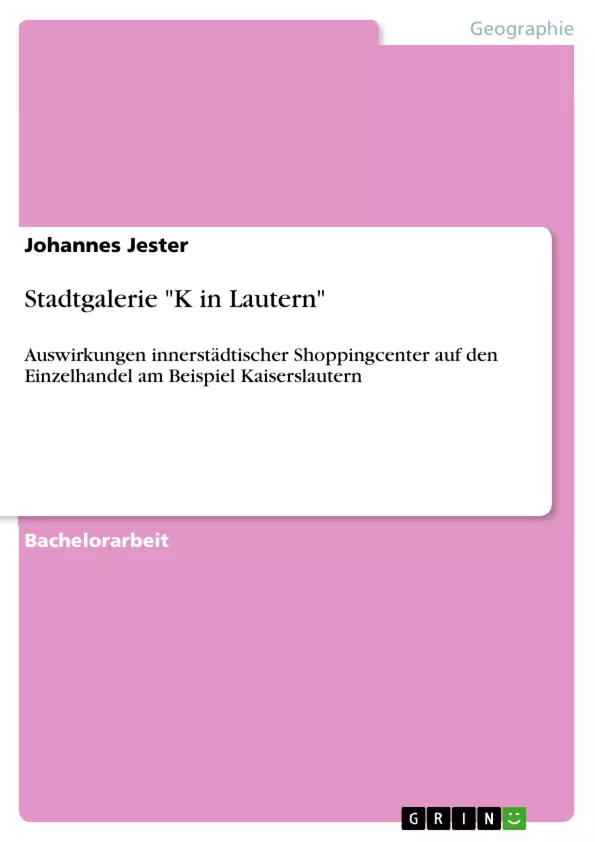Nachdem sich die Betreiber und Investoren von Shoppingcentern wie „ECE“ oder „mfi“ in den 90er Jahren hauptsächlich darauf konzentriert hatten neue Malls auf der „grünen Wiese“ am Rande der Stadt zu errichten, rückten in den letzten Jahren zunehmend die Innenstadtstandorte wieder in ihr Interesse. Da der innerstädtische Einzelhandel für die Zentralität und Urbanität der Städte ausschlaggeben ist und die wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft der Stadtkerne nach wie vor eine anziehende Wirkung haben, ist diese Entwicklung durchaus nachvollziehbar. Durch die vorherige Ansiedlung von Einkaufscentern in der Peripherie entstand für den innerstädtischen Einzelhandel jedoch eine starke Konkurrenz, was negative Auswirkungen auf die Innenstadt zur Folge hatte. Durch das Ausbleiben der Kundschaft mussten viele Einzelhändler ihr Geschäft aufgeben. Es kam zu Leerständen sowie zu einer Veränderung von Geschäften mit einem hochwertigen Sortimentangebot hin zu Billiganbietern wie „1-Euro-Läden“ oder Spiel-hallen. Diese „Trading-Down“-Prozesse führen zu einem Imageverlust der Innenstädte und verlaufen in einem Teufelskreis, da die Prozesse durch den Imageverlust weiter verstärkt werden.
Wie oben bereits erwähnt, drängen die Betreiber von Shoppingcenter inzwischen vermehrt in die Innenstadt. Um die „Trading-Down“-Prozesse zu stoppen und wieder mehr Kaufkraft in die Innenstädte zu locken, versucht auch die Kommunalpolitik mit Hilfe der Investoren Einkaufscenter in den Innenstädten anzusiedeln. Diese versprechen eine schnelle und effiziente Lösung des Problems zu sein. So wird die Zentralität und Urbanität schlagartig gesteigert und somit wieder mehr Kaufkraft in die Stadt gelenkt. Hinzu kommen mehr Gewerbesteuereinnahmen für die oft klammen Haushaltskassen der Städte sowie neu geschaffene Arbeitsplätze. Anfangs war dieser Trend nur in Metropolen festzustellen. Inzwischen befinden sich auch Mittelstädte wie Kaiserslautern im Fokus der Shoppingcenter-Betreiber.
Doch die bisherigen Erfahrungen aus vielen Städten zeigten, dass das Hauptziel, die Innenstadt zu stärken, um damit die Qualität des städtischen Lebens zu verbessern, oft nicht erreicht wird. In vielen Fällen verlagerte sich die Wertschöpfung in den Städten von den vielen Geschäften außerhalb der Shoppingcenter nur in das Center hinein. Dies führt dazu, dass die bereits begonnen „Trading-Down“-Prozesse weiter verstärkt werden.......
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Themeneinführung
- 1.2. Zielsetzung der Arbeit
- 1.3. Vorgehensweise und Methodik der Untersuchung
- 2. Shoppingcenter
- 2.1. Definition
- 2.2. Entwicklungsgeschichte
- 2.3. Entwicklungsphasen in Deutschland
- 3. Innerstädtische Einkaufscenter
- 3.1. ECE Projektmanagement GmbH. & Co. KG
- 3.2. Typologie
- 3.3. Regionale Auswirkungen
- 3.4. Kriterien und Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche und verträgliche Integration von Shoppingcentern in der Innenstadt
- 3.4.1. Größe
- 3.4.2. Lage
- 3.4.3. Bauform
- 3.4.4. Branchenvollständigkeit und Nutzung
- 3.4.5. Stellplätze
- 3.5. Kriterien zur Ermittlung der Ansiedlungsfolgen
- 3.5.1. Lagestrukturveränderung
- 3.5.2. Einzelhandelsmietpreis
- 3.5.3. Filialisierungsgrad
- 3.5.4. Passantenfrequenz
- 3.5.5. Umsatzkennziffer
- 3.5.6. Zentralitätskennziffer
- 3.6. Beispiel „City Galerie“ in Siegen
- 3.6.1. Innerstädtische Einzelhandelsstruktur in Siegen
- 3.6.2. Untersuchungsrelevante Rahmenkriterien
- 3.6.3. Vergleich der Kriterien für eine erfolgreiche und verträgliche Integration von Shoppingcentern in der Innenstadt mit den Eigenschaften der „City Galerie“ Siegen
- 3.6.4. Wirkungsanalyse und Folgen der Centeransiedlung
- 4. Stadtgalerie – K in Lautern
- 4.1. Innerstädtische Einzelhandelsstruktur in Kaiserslautern
- 4.2. Projekt „Neue Mitte“
- 4.3. Untersuchungsrelevante Rahmenkriterien
- 4.4. Vergleich der Kriterien für eine erfolgreiche und verträgliche Integration von Shoppingcentern in der Innenstadt mit den Eigenschaften des Einkaufscenters „K in Lautern“
- 4.5. Einschätzungen über die zukünftigen Auswirkungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Stadtgalerie „K in Lautern“ auf den innerstädtischen Einzelhandel in Kaiserslautern. Ziel ist es, die zu erwartenden Folgen dieser Ansiedlung zu analysieren und darzustellen, inwiefern die Integration des Shoppingcenters den bestehenden Einzelhandel beeinflusst. Die Arbeit betrachtet sowohl allgemeine Aspekte von Shoppingcentern als auch spezifische Kriterien für eine erfolgreiche Innenstadtintegration.
- Auswirkungen innerstädtischer Shoppingcenter auf den Einzelhandel
- Kriterien für eine erfolgreiche Integration von Shoppingcentern in Innenstädte
- Vergleich verschiedener Städte und deren Erfahrungen mit innerstädtischen Shoppingcentern
- Analyse der Situation in Kaiserslautern vor dem Bau der Stadtgalerie „K in Lautern“
- Prognose der zukünftigen Auswirkungen der Stadtgalerie „K in Lautern“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik innerstädtischer Shoppingcenter und deren Auswirkungen auf den Einzelhandel ein. Sie beschreibt den Wandel von der Ansiedlung von Shoppingcentern an der Stadtrandlage hin zu innerstädtischen Standorten und die damit verbundenen Herausforderungen für den traditionellen Einzelhandel. Der "Trading-Down"-Prozess, der durch die Konkurrenz zu Billiganbietern entsteht, wird als ein zentrales Problem identifiziert. Die Arbeit erläutert den Hintergrund des Projekts „Neue Mitte“ in Kaiserslautern und die damit verbundene Errichtung der Stadtgalerie „K in Lautern“ als Versuch, die Innenstadt zu revitalisieren. Die Zielsetzung der Arbeit, die zu erwartenden Auswirkungen der Stadtgalerie auf den Einzelhandel zu analysieren, wird klar definiert.
2. Shoppingcenter: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Shoppingcenter. Es beginnt mit der Definition des Begriffs und beleuchtet die Entwicklungsgeschichte, inklusive der verschiedenen Entwicklungsphasen in Deutschland. Die Entwicklung von der „grünen Wiese“ hin zu innerstädtischen Lagen wird im Detail beschrieben. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der komplexen Dynamik von Shoppingcentern und ihrer Integration in das städtische Gefüge.
3. Innerstädtische Einkaufscenter: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Aspekte innerstädtischer Shoppingcenter. Es analysiert die Rolle von Unternehmen wie der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, untersucht verschiedene Typologien und betrachtet die regionalen Auswirkungen solcher Center. Ein wichtiger Teil des Kapitels befasst sich mit Kriterien und Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Integration in die Innenstadt, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Lage, Bauform, Branchenvielfalt und Parkplatzsituation. Der Vergleich mit der „City Galerie“ in Siegen dient als Fallstudie zur Illustrierung der dargestellten Kriterien und deren Auswirkungen.
4. Stadtgalerie – K in Lautern: Das Kapitel widmet sich der Stadtgalerie „K in Lautern“ in Kaiserslautern. Es analysiert die innerstädtische Einzelhandelsstruktur der Stadt vor dem Bau des Centers und beschreibt das Projekt „Neue Mitte“ als umfassenderes städtebauliches Konzept. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der relevanten Kriterien für eine erfolgreiche Integration und einem Vergleich mit den Eigenschaften des „K in Lautern“. Abschließend werden Einschätzungen zu den zukünftigen Auswirkungen des Centers gegeben, ohne jedoch konkrete Schlussfolgerungen zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Shoppingcenter, innerstädtischer Einzelhandel, Stadtentwicklung, „Trading-Down“, ECE, Kaiserslautern, Stadtgalerie „K in Lautern“, Projekt „Neue Mitte“, Ansiedlungsfolgen, Wirtschaftskraft, Zentralität, Urbanität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Auswirkungen innerstädtischer Shoppingcenter am Beispiel der Stadtgalerie "K in Lautern"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Ansiedlung innerstädtischer Shoppingcenter auf den traditionellen Einzelhandel, insbesondere am Beispiel der Stadtgalerie "K in Lautern" in Kaiserslautern. Es wird analysiert, wie sich die Integration eines solchen Centers in die bestehende Handelsstruktur auswirkt und welche Kriterien für eine erfolgreiche und verträgliche Integration entscheidend sind.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte von Shoppingcentern, von ihrer allgemeinen Definition und Entwicklungsgeschichte bis hin zu spezifischen Kriterien für eine erfolgreiche Innenstadtintegration. Es werden Fallstudien der "City Galerie" in Siegen und der "K in Lautern" in Kaiserslautern durchgeführt, um die theoretischen Überlegungen anhand konkreter Beispiele zu illustrieren. Die Analyse umfasst die Auswirkungen auf die Lagestruktur, Mietpreise, Filialisierung, Passantenfrequenz, Umsatz und Zentralität. Die Arbeit beleuchtet auch das Projekt "Neue Mitte" in Kaiserslautern und dessen Zusammenhang mit der Stadtgalerie.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methodik. Es werden verschiedene Datenquellen herangezogen, um die Auswirkungen der Shoppingcenter zu untersuchen. Die Fallstudien basieren auf dem Vergleich von Kriterien für eine erfolgreiche Innenstadtintegration mit den Eigenschaften der untersuchten Shoppingcenter. Es werden quantitative und qualitative Daten analysiert, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der zu erwartenden Folgen der Ansiedlung der Stadtgalerie "K in Lautern" auf den innerstädtischen Einzelhandel in Kaiserslautern. Es soll dargestellt werden, inwieweit die Integration des Shoppingcenters den bestehenden Einzelhandel beeinflusst und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die Arbeit zielt darauf ab, Erkenntnisse für eine erfolgreiche und verträgliche Integration von Shoppingcentern in Innenstädten zu liefern.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Shoppingcenter, innerstädtischer Einzelhandel, Stadtentwicklung, „Trading-Down“, ECE, Kaiserslautern, Stadtgalerie „K in Lautern“, Projekt „Neue Mitte“, Ansiedlungsfolgen, Wirtschaftskraft, Zentralität, Urbanität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung (mit Themeneinführung, Zielsetzung und Methodik), 2. Shoppingcenter (Definition, Entwicklungsgeschichte), 3. Innerstädtische Einkaufscenter (Typologie, regionale Auswirkungen, Kriterien für erfolgreiche Integration, Fallstudie "City Galerie" Siegen), 4. Stadtgalerie – K in Lautern (Einzelhandelsstruktur Kaiserslautern, Projekt "Neue Mitte", Vergleich mit Integrationskriterien, zukünftige Auswirkungen), 5. Fazit.
Wie werden die Auswirkungen der Stadtgalerie "K in Lautern" bewertet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Stadtgalerie "K in Lautern" anhand verschiedener Kriterien wie Veränderungen der Lagestruktur, Mietpreise, Filialisierungsgrad, Passantenfrequenz, Umsatz und Zentralität. Ein direktes Urteil über positive oder negative Auswirkungen wird jedoch erst im Fazit gezogen, nachdem alle analysierten Daten berücksichtigt wurden.
Welche Rolle spielt die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG?
Die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG wird im Kontext der Typologie und des Projektmanagements innerstädtischer Shoppingcenter behandelt. Sie dient als Beispiel für ein Unternehmen, das maßgeblich an der Planung und Umsetzung solcher Projekte beteiligt ist.
Was ist der "Trading-Down"-Prozess?
Der "Trading-Down"-Prozess beschreibt den Prozess, in dem durch die Konkurrenz von Billiganbietern im Einzelhandel die Qualität der angebotenen Waren sinkt.
Welche Bedeutung hat das Projekt "Neue Mitte" in Kaiserslautern?
Das Projekt "Neue Mitte" in Kaiserslautern ist ein umfassenderes städtebauliches Konzept, in dessen Rahmen die Stadtgalerie "K in Lautern" errichtet wurde. Es wird in der Arbeit als Kontext für die Ansiedlung des Shoppingcenters betrachtet.
- Citation du texte
- Johannes Jester (Auteur), 2013, Stadtgalerie "K in Lautern", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266025