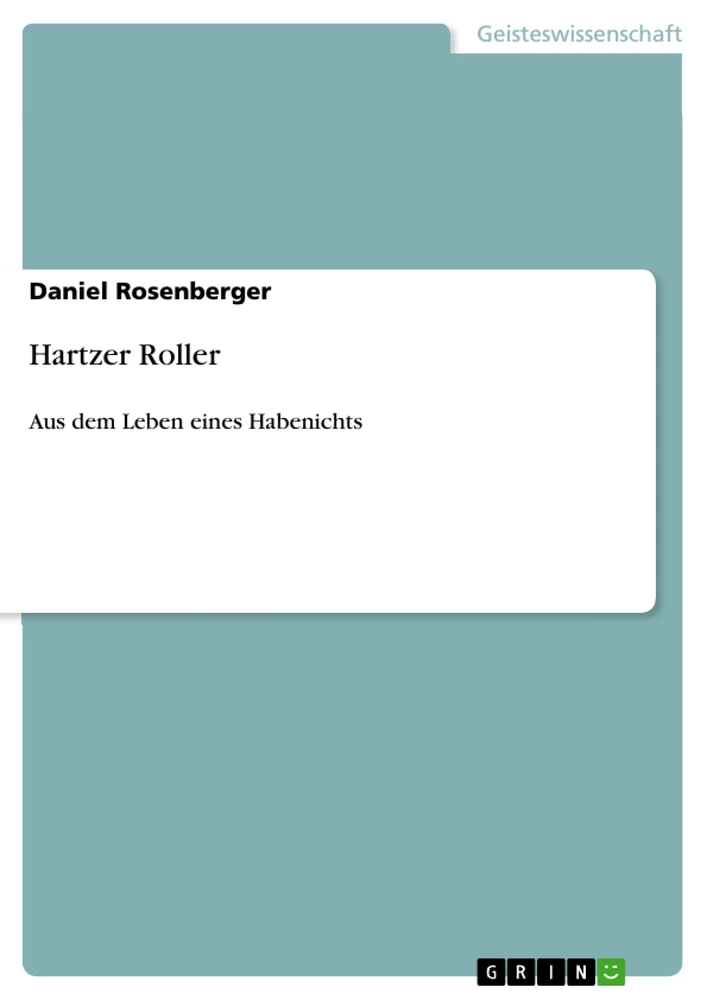Daniel Rosenberger nimmt den Leser in seinen Kurzgeschichten mit auf eine abenteuerliche Reise durch die letzten zehn Jahre seines Lebens. Sein Leben ähnelt immer mehr einer Odyssee, je länger er keine Chance bekommt, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Rosenberger zieht alle Register seines Humors, wenn er beschreibt, wie er immer tiefer in den Sog einer Arbeitslosenverwaltung gerät, die sich längst zu einem eigenen Wirtschaftszweig entwickelt hat. Dabei zeigt sich, dass auch ein gut ausgebildeter Mensch nicht vor solchen Erfahrungen gefeit ist. Meist wissen die Zeitgenossen kaum, was Arbeitslosigkeit bedeutet, solange sie nicht selbst oder über Familie und Freundeskreis damit konfrontiert werden. Rosenbergers Büchlein hat zum Ziel, über die weitgehend unbekannten Seiten der sozialen Marktwirtschaft einmal auf unterhaltsame Weise aufzuklären.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Im Flugsimulator
- „Zu Gast bei Freunden“
- Historiker vom Ententeich
- Einbildung ist auch eine Bildung
- Kunst kommt von können, und Gunst kommt von günstig
- Guter Rat ist nicht immer teuer
- „Kampf der Kulturen“
- Spare in der Zeit, so hast du in der Not
- Erkenne dich selbst
- Das war wohl nix
- Bruchlandung auf dem Planeten Treptow
- Erkenne dich selbst 2
- „Die Geister lasset aufeinanderprallen, aber die Fäuste haltet stille“
- „In the Army Now“
- Das war wohl nix 2
- Wenn einer eine Reise tut, dann tut ihm das nicht immer gut
- Dreiecksbeziehung mit Vertrag
- Mister Doolittle
- Erkenne dich selbst 3
- „Die Welt ist ein Irrenhaus, und hier ist die Zentrale“
- Echt abgehoben
- Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber eben auch
- Alles für umsonst oder alles für die Katz?
- „Unheimliche Begegnungen der dritten Art“
- „Seid bereit!“ „Immer bereit!“
- Auf Knall und Fall
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des Textes ist es, die Erfahrungen und Erlebnisse eines Langzeitarbeitslosen auf humorvolle und nachdenkliche Weise darzustellen. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Absurditäten des deutschen Sozialsystems und die Suche nach Sinn und Orientierung im Kontext von Arbeitslosigkeit.
- Die Absurditäten des deutschen Arbeitslosensystems
- Die Suche nach Identität und Sinn im Kontext von Arbeitslosigkeit
- Der Umgang mit dem Stigma der Arbeitslosigkeit
- Das Ineinandergreifen von persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen
- Die Reflexion über persönliche Erfahrungen im Spiegel literarischer und mythologischer Bezüge
Zusammenfassung der Kapitel
Prolog: Der Prolog beginnt mit einer Beschreibung des Verlagshauses von Axel Springer und der Bronzestatue eines Mannes, der auf einer Mauer balanciert. Diese Szene dient als Metapher für den Balanceakt des Autors als Langzeitarbeitsloser. Er vergleicht seine Situation mit der des "Taugenichts" aus Eichendorffs Novelle, betont aber den Unterschied zwischen der freiwilligen und der unfreiwilligen Lebenssituation. Der Prolog etabliert den zentralen Konflikt des Textes: die Auseinandersetzung mit dem Stigma der Arbeitslosigkeit und der Suche nach einer erfüllten Zukunft.
Im Flugsimulator: Dieses Kapitel beschreibt einen Orientierungs- und Motivationkurs für Langzeitarbeitslose. Der Autor lernt Nicole, eine ehemalige Stewardess, kennen. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihren Lebenslauf grafisch darzustellen. Die Darstellung der Teilnehmer verdeutlicht die unterschiedlichen Gründe für ihre Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen Herausforderungen. Der Autor präsentiert seine Lebensgeschichte als Diagramm, welches seinen beruflichen Werdegang visualisiert – von Höhen und Tiefen bis hin zur aktuellen Stagnation. Das Kapitel illustriert die Kreativität der Kursleiter und den Versuch, die Teilnehmer zu motivieren und ihre Perspektiven zu erweitern.
Schlüsselwörter
Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialsystem, Identitätssuche, Stigma, Humor, Metapher, Mythologie, Selbsterfahrung, Orientierung, Motivation.
Häufig gestellte Fragen zum Text: [Titel des Textes einfügen]
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text schildert humorvoll und nachdenklich die Erfahrungen eines Langzeitarbeitslosen. Er beleuchtet die Herausforderungen und Absurditäten des deutschen Sozialsystems und die Suche nach Sinn und Orientierung in dieser Situation.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Zu den zentralen Themen gehören die Absurditäten des deutschen Arbeitslosensystems, die Suche nach Identität und Sinn im Kontext von Arbeitslosigkeit, der Umgang mit dem Stigma der Arbeitslosigkeit, das Ineinandergreifen von persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen sowie die Reflexion über persönliche Erfahrungen im Spiegel literarischer und mythologischer Bezüge.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text beinhaltet einen Prolog und einen Epilog, sowie Kapitel wie "Im Flugsimulator" (Beschreibung eines Orientierungs- und Motivationkurses für Arbeitslose), "Zu Gast bei Freunden", "Historiker vom Ententeich" und viele weitere Kapitel, die jeweils einzelne Episoden aus dem Leben des Autors als Langzeitarbeitsloser beschreiben. Der Prolog beginnt mit einer Metapher, die den Balanceakt des Autors als Langzeitarbeitsloser darstellt. Die Kapitelzusammenfassungen liefern detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialsystem, Identitätssuche, Stigma, Humor, Metapher, Mythologie, Selbsterfahrung, Orientierung, Motivation.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Form eines Buches aufgebaut mit Prolog, einzelnen Kapiteln und einem Epilog. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, das die Kapitelüberschriften auflistet. Zusätzlich bietet er eine Zusammenfassung der Kapitel sowie eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten.
An wen richtet sich der Text?
Der Text richtet sich an ein breites Publikum, das sich für die Themen Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialsystemkritik und die Suche nach Sinn im Leben interessiert. Aufgrund des humorvollen Ansatzes ist er auch für Leser geeignet, die sich mit dem Thema auf unterhaltsame Weise auseinandersetzen möchten.
Welche Art von Sprache wird verwendet?
Die Sprache ist lebendig, humorvoll und nachdenklich. Der Autor verwendet Metaphern und literarische Bezüge, um seine Erfahrungen auszudrücken.
Wo kann ich den vollständigen Text finden?
[Hier Informationen zur Verfügbarkeit des Textes einfügen, z.B. Verlag, ISBN]
- Quote paper
- Daniel Rosenberger (Author), 2014, Hartzer Roller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266046