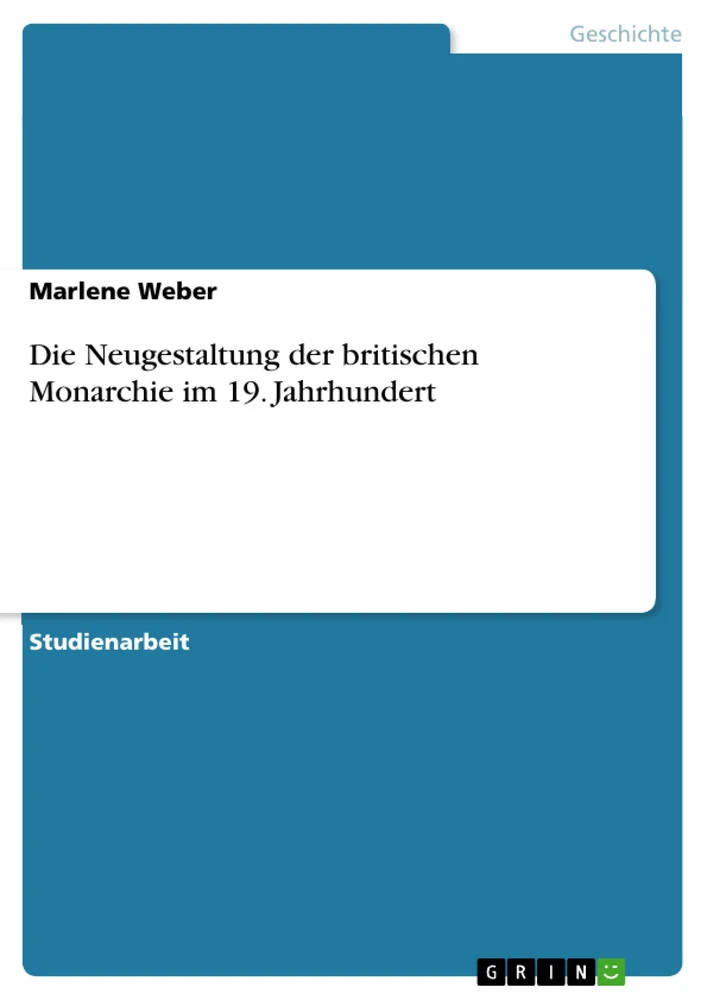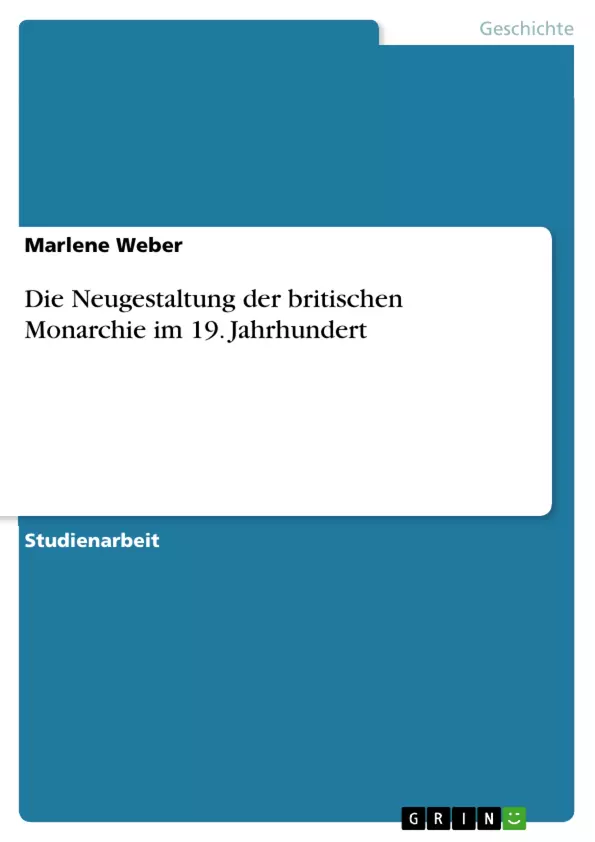Auf den folgenden Seiten geht es um die Frage, wie genau dieses neue Bild der Monarchie aussah, das Viktoria zu vermitteln versuchte. Ebenfalls werfe ich einen kurzen Blick auf die Rolle Alberts darin. Ich konzentriere mich auf den Zeitraum von 1837 bis 1901, also auf die Zeit der Regentschaft Viktorias, sowie auf einige wenige zentrale Ereignisse in diesen Jahren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- 1. Ausgangslage 1837
- 1.1 Situation und Herausforderungen der Monarchie
- 1.2 Die Medienlandschaft in Großbritannien im 19. Jahrhundert
- 2. Der Wandel: Verbesserung des Ansehens der Monarchie mit Hilfe der Medien
- 2.1 Royale Zeremonien und die Medien
- 2.2 Neue Aufgaben: Wohltätigkeit und Reisen
- 3. Integration in die Gesellschaft
- 3.1 Eine bürgerliche Familie auf dem Thron
- 3.2 Eine Frau ist Mutter der Nation
- 1. Ausgangslage 1837
- C. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Neugestaltung der britischen Monarchie im 19. Jahrhundert und untersucht, wie Königin Viktoria I. das Ansehen der Monarchie unter ihrer Regentschaft (1837-1901) verbessern konnte. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der Medien und der öffentlichen Wahrnehmung.
- Die schwierige Ausgangslage der Monarchie im Jahr 1837
- Die Nutzung von Medien und Zeremonien zur Verbesserung des Images
- Die Rolle der königlichen Familie als Vorbild für die Gesellschaft
- Die Bedeutung der Wohltätigkeit und Reisen für die Popularität der Monarchie
- Der Einfluss von Viktorias Rolle als Frau auf die Monarchie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausgangslage 1837
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, vor denen Viktoria stand, als sie die Krone erbte. Es werden die Unbeliebtheit der Monarchie unter ihren Vorgängern, William IV. und Georg IV., sowie die Rolle der Medien in dieser Zeit beleuchtet. Die politischen Veränderungen und die begrenzte politische Macht der Monarchie im 19. Jahrhundert werden ebenfalls thematisiert.
2. Der Wandel: Verbesserung des Ansehens der Monarchie mit Hilfe der Medien
Dieses Kapitel fokussiert auf die Strategien, die Viktoria und Prinz Albert zur Verbesserung des Ansehens der Monarchie einsetzten. Es wird der Einfluss der Medien auf die öffentliche Wahrnehmung und die Rolle von Zeremonien und Reisen beleuchtet. Die neuen Aufgabenfelder der Monarchie, insbesondere die Wohltätigkeit, werden ebenfalls behandelt.
3. Integration in die Gesellschaft
Dieses Kapitel analysiert die Integration der Monarchie in die Gesellschaft und beleuchtet das Bild der bürgerlichen Familie auf dem Thron. Viktorias Rolle als Frau und „Mutter der Nation“ wird ebenfalls untersucht. Die Veränderungen in der Rolle der Monarchie und deren Einfluss auf die Gesellschaft werden in diesem Kontext diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen britische Monarchie, Königin Viktoria I., Prinz Albert, Medien, öffentliche Wahrnehmung, Zeremonien, Wohltätigkeit, Reisen, bürgerliche Familie, gesellschaftliche Integration, Wandel, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte Königin Viktoria das Bild der britischen Monarchie?
Viktoria transformierte die Monarchie von einer politisch umstrittenen Institution hin zu einem moralischen Vorbild, das als 'bürgerliche Familie auf dem Thron' wahrgenommen wurde.
Welche Rolle spielten die Medien im 19. Jahrhundert für die Royals?
Die aufkommende Massenpresse wurde gezielt genutzt, um royale Zeremonien, Reisen und das Familienleben der Königin positiv in der Öffentlichkeit darzustellen.
Was trug Prinz Albert zur Neugestaltung bei?
Prinz Albert förderte die Modernisierung der Monarchie, indem er sie mit Themen wie Wohltätigkeit, Wissenschaft und gesellschaftlichem Fortschritt verknüpfte.
Warum wurde Viktoria als 'Mutter der Nation' bezeichnet?
Ihre Rolle als Mutter zahlreicher Kinder und ihre Beständigkeit über Jahrzehnte hinweg schufen ein Bild der Fürsorge und Einheit, das die Identität Großbritanniens prägte.
Wie war die Ausgangslage der Monarchie 1837?
Zu Beginn von Viktorias Regentschaft war das Ansehen der Krone durch ihre unbeliebten Vorgänger stark beschädigt und die politische Macht schwand zunehmend.
- Arbeit zitieren
- Marlene Weber (Autor:in), 2013, Die Neugestaltung der britischen Monarchie im 19. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266073