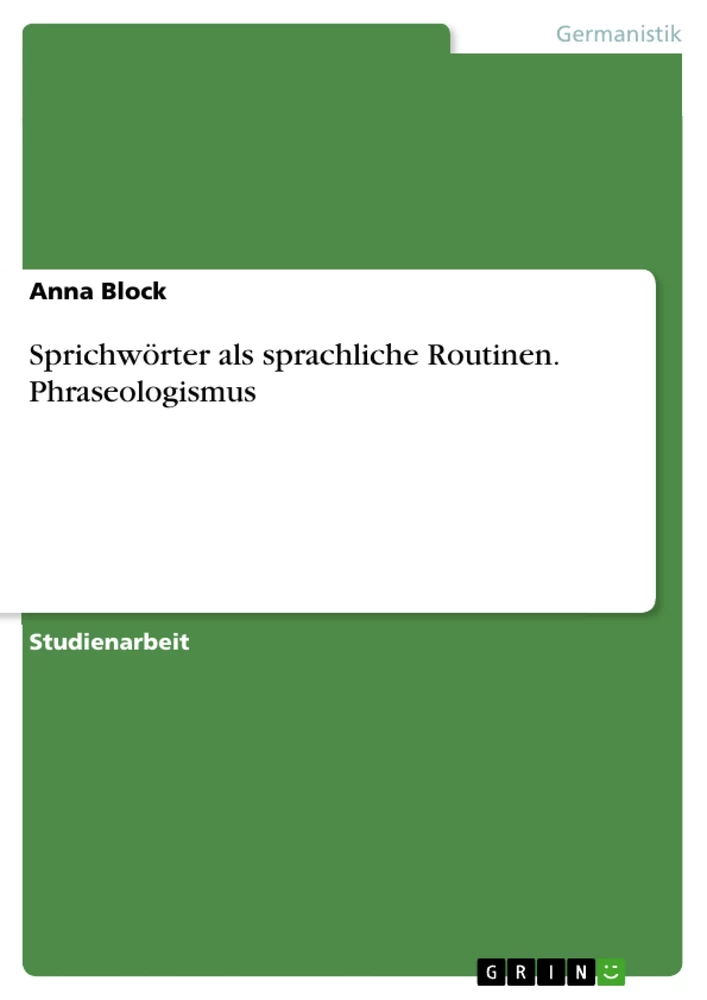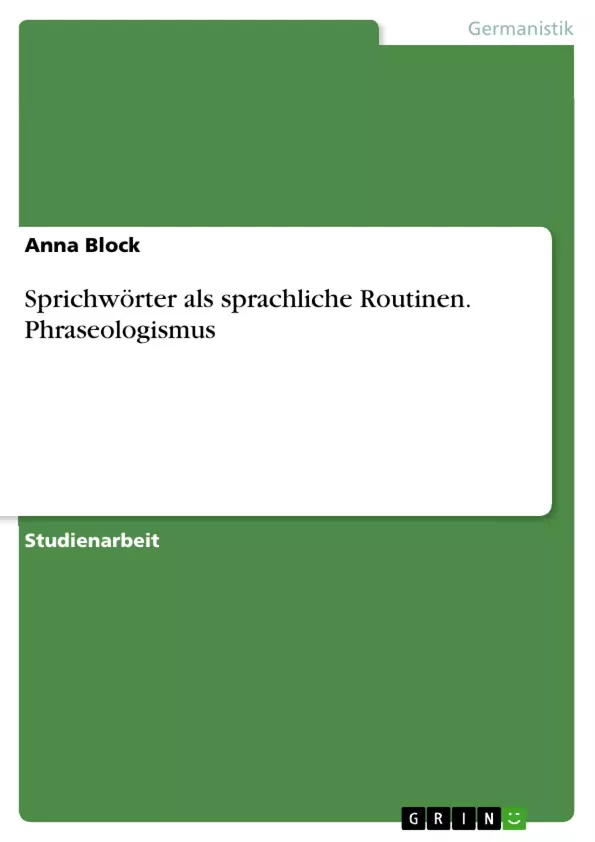Die wissenschaftliche Betrachtung von Sprichwörtern fußt dabei auf dem großen Interesse, dass das Sprichwort als ein Bestandteil des Volkstums und des Volksmunds sowohl bei Fachleuten als auch bei Laien erregt. So wurden im deutschsprachigen Raum lateinische, mundartliche und deutsche Sprichwörter je nach Zeitalter über die Epochen hinweg gesammelt und auch in der Literatur gepflegt. Ziele der Sammlungen waren meistens erzieherischer und schuldidaktischer Art (Dogbeh 2000:157). Einen ernsthaften wissenschaftlichen Charakter erhielt das Sprichwort in der deutschen Sprachwissenschaft erst im 19. Jahrhundert mit der bislang größten Sprichwortsammlung von Wander „Deutsches Sprichwörterlexikon“. Weitere bedeutende Nachschlagewerke sind z.B. Seilers Deutsche Sprichwörter-Kunde, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten von Röhrich (1973) und das Sprichwörterlexikon von H. und A. Beyer (1985) (ebd.).
Diese Betrachtung verdeutlicht, welchen relevanten Stellenwert die Sprichwörter im Kontext des sprachlichen Handelns innehaben. Dementsprechend sollen sie der Gegenstand der vorliegenden Arbeit unter dem Gesichtspunkt der sprachlichen Routinen sein. Zu diesem Zwecke wird im Folgenden zunächst eine Definition von Sprichwörtern erfolgen (Kapitel 2), um diese im Anschluss im Kapitel 3 von anderen ähnlichen sprachlichen Erscheinungen abzugrenzen. Weiterhin werden formale Merkmale des Sprichworts betrachtet (Kapitel 4). Ferner wird die Zugehörigkeit von Sprichwörtern zu Phraseologismen unter den Gesichtspunkten Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität begründet (Kapitel 5), um sie daran anschließend in den Gesamtbereich der Phraseologie einordnen zu können (Kapitel 6). Letztendlich werden die verschiedenen Funktionen des Sprichworts in Kapitel 7 und die heutige Situation des Sprichwortgebrauchs (Kapitel 8) näher beleuchtet. Die Arbeit findet ihren Abschluss im neunten Kapitel, welches in Form eines Fazits die herausgearbeiteten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Sprichwörtern
- Abgrenzung
- Formale Merkmale
- Sprichwörter als Phraseologismen
- Polylexikalität
- Festigkeit
- Idiomatizität
- Klassifikation von Sprichwörtern innerhalb der Phraseologie
- Funktionen von Sprichwörtern
- Aktualität von Sprichwörtern und ihre heutige Verwendung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Sprichwort als sprachlicher Routine im Kontext der Phraseologie. Sie zielt darauf ab, die Definition, Abgrenzung und formalen Merkmale von Sprichwörtern zu beleuchten. Zudem wird die Zugehörigkeit von Sprichwörtern zu den Phraseologismen unter den Gesichtspunkten Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität untersucht. Abschließend werden die Funktionen von Sprichwörtern im Wandel der Zeit sowie ihre aktuelle Verwendung in der heutigen Gesellschaft analysiert.
- Definition und Abgrenzung von Sprichwörtern
- Formale Merkmale von Sprichwörtern
- Sprichwörter als Phraseologismen
- Funktionen von Sprichwörtern
- Aktualität von Sprichwörtern und ihre heutige Verwendung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Routinen ein und stellt die Bedeutung von Sprichwörtern als Teil dieser Routinen heraus. Sie verweist auf die wissenschaftliche Betrachtung von Sprichwörtern in der Phraseologie und Parömiologie und skizziert den Aufbau der vorliegenden Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition von Sprichwörtern. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur vorgestellt und diskutiert, wobei die Schwierigkeit einer einheitlichen und gültigen Definition herausgestellt wird. Die Bedeutung von Bekanntheit und Festgeprägtheit als wichtige Kriterien für die Zugehörigkeit zu sprachlichen Routinen wird betont.
Kapitel drei befasst sich mit der Abgrenzung des Sprichworts von anderen ähnlichen Erscheinungen. Es werden verschiedene sprichwortverwandte Formen wie Bauernregeln, Wellerismen und Antisprichwörter vorgestellt und vom Sprichwort abgegrenzt. Auch die Abgrenzung von sprichwörtlichen Redensarten, Sentenzen, Aphorismen, Maximen, Zitaten und geflügelten Worten wird behandelt. Die Schwierigkeit einer eindeutigen Abgrenzung zwischen diesen Gattungen wird aufgezeigt.
Im vierten Kapitel werden formale Merkmale des Sprichworts beleuchtet. Es werden Merkmale wie Reim, Rhythmus, Parallelismus, Paradoxie und Ironie als wichtige Elemente für die Einprägsamkeit und den ästhetischen Reiz von Sprichwörtern dargestellt.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Zugehörigkeit von Sprichwörtern zu den Phraseologismen. Es wird die Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität von Sprichwörtern als Grundmerkmale von Phraseologismen erläutert. Die relative Festigkeit von Sprichwörtern wird im Kontext der flexiblen Konzeption von Phraseologie betrachtet.
Kapitel sechs ordnet Sprichwörter innerhalb der Phraseologie den referentiellen Phraseologismen und den propositionalen Phraseologismen zu. Es wird die satzwertige Funktion von Sprichwörtern als topische Formen betont. Die Bedeutung von Sprichwörtern als selbstständige „Mikrotexte" wird hervorgehoben.
Kapitel sieben behandelt die Funktionen von Sprichwörtern. Neben der belehrend-moralisierenden Funktion werden spielerische, ironische, satirische und humorvolle Verwendungsmöglichkeiten von Sprichwörtern aufgezeigt. Die soziale und kontextuelle Funktion von Sprichwörtern als Handlungsanweisungen oder -deutungen wird erläutert. Die Veränderung der sozialen Funktion von Sprichwörtern im Laufe der Zeit wird beleuchtet.
Das achte Kapitel beschäftigt sich mit der Aktualität von Sprichwörtern und ihrer heutigen Verwendung. Es wird die anhaltende Beliebtheit von Sprichwörtern in der heutigen Gesellschaft und die Entstehung neuer Formen und Variationen von Sprichwörtern dargestellt. Der spielerische Umgang mit Sprichwörtern in der öffentlichen Sprachverwendung, in den Medien und in der Werbung wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Sprichwörter, Phraseologismen, sprachliche Routinen, Parömiologie, Definition, Abgrenzung, formale Merkmale, Polylexikalität, Festigkeit, Idiomatizität, Klassifikation, Funktionen, Aktualität, heutige Verwendung, soziale Funktion, kontextuelle Funktion, gesellschaftliche Entwicklung, Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Sprichwörter aus sprachwissenschaftlicher Sicht?
Sprichwörter werden als sprachliche Routinen und Teil der Phraseologie betrachtet, die durch Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität gekennzeichnet sind.
Wie grenzen sich Sprichwörter von Redensarten ab?
Im Gegensatz zu Redensarten sind Sprichwörter meist vollständige Sätze mit einer in sich geschlossenen Lehre oder Lebensweisheit.
Welche formalen Merkmale machen Sprichwörter einprägsam?
Häufige Merkmale sind Reim, Rhythmus, Parallelismus, Ironie oder Paradoxie, die den ästhetischen Reiz und die Merkbarkeit erhöhen.
Welche Funktionen erfüllen Sprichwörter heute?
Neben der belehrenden Funktion dienen sie heute oft spielerischen, ironischen oder satirischen Zwecken, besonders in Medien und Werbung.
Was ist das „Deutsche Sprichwörterlexikon“ von Wander?
Es ist die im 19. Jahrhundert entstandene, bislang größte Sammlung deutscher Sprichwörter, die der Parömiologie einen wissenschaftlichen Charakter verlieh.
- Quote paper
- Anna Block (Author), 2012, Sprichwörter als sprachliche Routinen. Phraseologismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266102