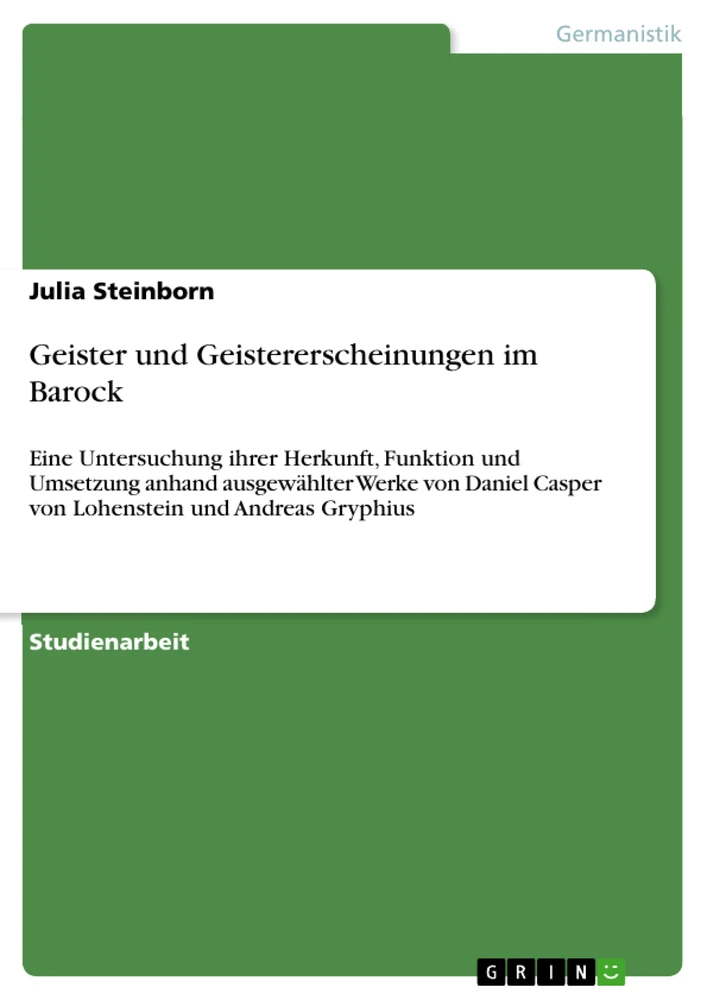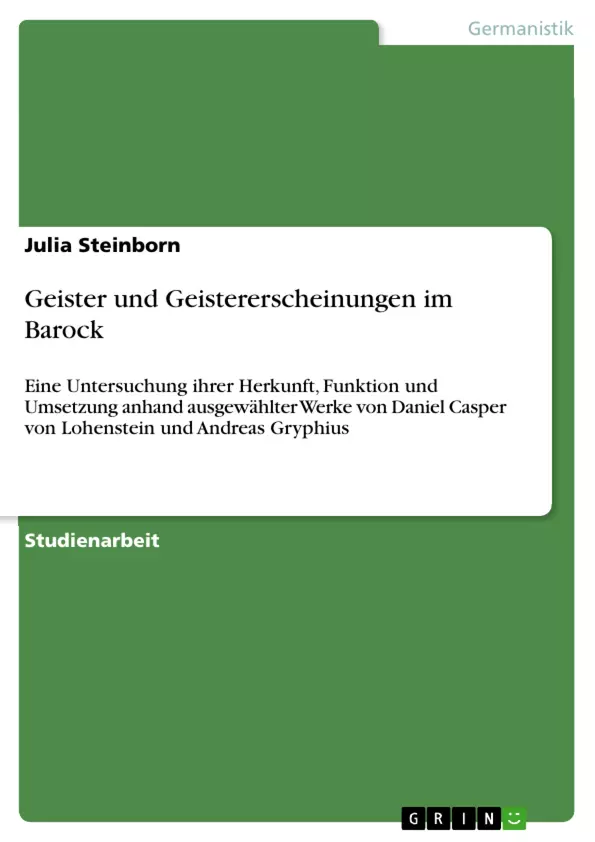Geister und Geistererscheinungen sind seit jeher in literarischen Werken zu finden. Man liest in der Bibel von ihnen, in verschiedenen mittelalterlichen Abhandlungen, in den Hausmärchen der Gebrüder Grimm sowie in Goethes Faust. In den Werken des 20. und 21. Jahrhunderts verbindet man mit ihnen oftmals Gruselgestalten, die Spuk und Unheil bringen. Woher aber stammt die Vorstellung von Geistern? Wie hat sie sich entwickelt? Diese Arbeit wird den Ursprung und die Veränderung des Geisterglaubens herausarbeiten und explizit an zwei deutschen Dramen des Barock aufzeigen. So wird nicht nur erklärt, was die einzelnen Stände und Religionen des 17. Jahrhunderts unter dem Begriff Geist verstanden, sondern ebenfalls, welche Funktion die Jenseitserscheinungen in den Dramen und auf dem Theater hatten. Die herausgearbeiteten Ergebnisse werden schließlich anhand der Werke Cleopatra von Daniel Casper von Lohenstein und Leo Armenius von Andreas Gryphius erklärt. Es wird sich herausstellen, dass die Funktionen der Geistererscheinungen im deutschen Drama des Barock nicht nur vielseitig sind, sondern sich ebenfalls eine Vermischung der verschiedenen Geistervorstellungen erkennen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ursprung und Entwicklung der Geisterszenen
- 3 Geistererscheinungen im barocken Drama
- 3.1 Geister und Gespenster
- 3.2 Träume
- 3.3 Funktionen der Geistererscheinungen
- 4 Geistererscheinungen in den Dramen Lohensteins und Gryphius
- 4.1 Cleopatra
- 4.2 Leo Armenius
- 5 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Geisterglaubens und dessen Darstellung im barocken deutschen Drama. Der Fokus liegt auf der Funktion und Umsetzung von Geistererscheinungen in ausgewählten Werken von Daniel Casper von Lohenstein und Andreas Gryphius. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Einflüsse – antike Traditionen, Volksglaube, Jesuitentheater – und deren Verschmelzung in der barocken Dramaturgie.
- Ursprung und Entwicklung des Geisterglaubens
- Funktion von Geistererscheinungen im barocken Theater
- Einfluss antiker und zeitgenössischer Vorstellungen auf die Darstellung von Geistern
- Vergleichende Analyse der Geisterfiguren bei Lohenstein und Gryphius
- Theatralische Wirkung und Inszenierung von Geisterszenen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert die Forschungsfrage: Woher stammt die Vorstellung von Geistern im Barock und welche Funktion haben sie im Drama? Sie benennt die untersuchten Autoren (Lohenstein und Gryphius) und kündigt den methodischen Ansatz an, der die Analyse ausgewählter Dramen beinhaltet, um die vielseitigen Funktionen und die Vermischung verschiedener Geistervorstellungen aufzuzeigen. Die Zitation aus dem Buch Hiob veranschaulicht die lange Tradition der Geisterdarstellungen in der Literatur und impliziert die zeitlose Faszination und Furcht vor dem Übernatürlichen.
2 Ursprung und Entwicklung der Geisterszenen: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung der Geisterszenen von der Antike über den Renaissance-Humanismus bis zum Einfluss der englischen Komödianten und des Jesuitentheaters. Es wird deutlich, wie sich die Darstellung von Geistern wandelte, von eher philosophisch-literarischen Figuren hin zu agileren, theatralisch wirkungsvollen Elementen, die auch im Dienste der jesuitischen Mission eingesetzt wurden. Die antiken Einflüsse werden beschrieben, jedoch wird betont, wie diese im Laufe der Zeit durch andere, vor allem theatralische und konfessionell geprägte, Aspekte abgelöst wurden.
3 Geistererscheinungen im barocken Drama: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Aspekte von Geistererscheinungen im barocken Drama. Es beleuchtet die unterschiedlichen Arten von Geistern und Gespenstern, die Rolle von Träumen im Kontext von Geistererscheinungen und deren vielseitige Funktionen innerhalb des dramatischen Geschehens. Es legt den Grundstein für die detailliertere Analyse der ausgewählten Dramen im folgenden Kapitel, indem es die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten von Geistererscheinungen aufzeigt und auf die Verschmelzung verschiedener Vorstellungswelten hinweist.
4 Geistererscheinungen in den Dramen Lohensteins und Gryphius: Hier werden die Geistererscheinungen in den Werken von Lohenstein (Cleopatra) und Gryphius (Leo Armenius) im Detail untersucht. Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Funktionen der Geister in den jeweiligen Dramen, berücksichtigt die Einflüsse verschiedener Theatertraditionen, und vergleicht die Ergebnisse mit den vorherigen Kapiteln. Es wird gezeigt, wie die Autoren die Geisterfiguren einsetzen, um die Handlung voranzutreiben, Charaktere zu entwickeln, und bestimmte Botschaften zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der Verschmelzung verschiedener Geistervorstellungen in den ausgewählten Dramen.
Schlüsselwörter
Barockes Drama, Geistererscheinungen, Daniel Casper von Lohenstein, Andreas Gryphius, Geistervorstellungen, Theatralität, Renaissance-Humanismus, Jesuitentheater, Cleopatra, Leo Armenius, Volksglaube, Religion, Funktion der Geister, Dramaturgie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Geistererscheinungen im barocken deutschen Drama
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Ursprung und die Entwicklung von Geistererscheinungen im barocken deutschen Drama, insbesondere deren Funktion und Umsetzung in ausgewählten Werken von Daniel Casper von Lohenstein und Andreas Gryphius. Es wird untersucht, wie antike Traditionen, Volksglaube und das Jesuitentheater die Darstellung von Geistern beeinflusst haben.
Welche Autoren und Werke stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Hauptfokuspunkte sind die Dramen "Cleopatra" von Daniel Casper von Lohenstein und "Leo Armenius" von Andreas Gryphius. Die Analyse konzentriert sich auf die Geisterfiguren in diesen Stücken und deren Funktion innerhalb der jeweiligen Dramaturgie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie den Ursprung und die Entwicklung des Geisterglaubens, die Funktion von Geistererscheinungen im barocken Theater, den Einfluss antiker und zeitgenössischer Vorstellungen auf die Darstellung von Geistern, einen Vergleich der Geisterfiguren bei Lohenstein und Gryphius sowie die theatralische Wirkung und Inszenierung von Geisterszenen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Ursprung und der Entwicklung der Geisterszenen, ein Kapitel zu Geistererscheinungen im barocken Drama allgemein, ein Kapitel zur detaillierten Analyse der Geistererscheinungen in den Dramen von Lohenstein und Gryphius und ein Schlusswort. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Welche Aspekte von Geistererscheinungen werden im barocken Drama untersucht?
Das Kapitel zu Geistererscheinungen im barocken Drama untersucht verschiedene Arten von Geistern und Gespenstern, die Rolle von Träumen im Zusammenhang mit Geistererscheinungen und die vielseitigen Funktionen der Geistererscheinungen innerhalb des dramatischen Geschehens. Es wird auf die Verschmelzung verschiedener Vorstellungswelten hingewiesen.
Wie werden die Geistererscheinungen bei Lohenstein und Gryphius analysiert?
Das Kapitel zu Lohenstein und Gryphius analysiert detailliert die spezifischen Funktionen der Geister in "Cleopatra" und "Leo Armenius", berücksichtigt die Einflüsse verschiedener Theatertraditionen und vergleicht die Ergebnisse mit den vorherigen Kapiteln. Der Fokus liegt auf der Verschmelzung verschiedener Geistervorstellungen in diesen Dramen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Barockes Drama, Geistererscheinungen, Daniel Casper von Lohenstein, Andreas Gryphius, Geistervorstellungen, Theatralität, Renaissance-Humanismus, Jesuitentheater, Cleopatra, Leo Armenius, Volksglaube, Religion, Funktion der Geister, Dramaturgie.
Welche Forschungsfrage wird in der Einleitung gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Woher stammt die Vorstellung von Geistern im Barock und welche Funktion haben sie im Drama?
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse ausgewählter Dramen von Lohenstein und Gryphius, um die vielseitigen Funktionen und die Vermischung verschiedener Geistervorstellungen aufzuzeigen.
Welche Einflüsse auf die Darstellung von Geistern werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt Einflüsse aus der Antike, dem Renaissance-Humanismus, dem englischen Komödiantenspiel und dem Jesuitentheater.
- Arbeit zitieren
- B.A. Julia Steinborn (Autor:in), 2013, Geister und Geistererscheinungen im Barock, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266143