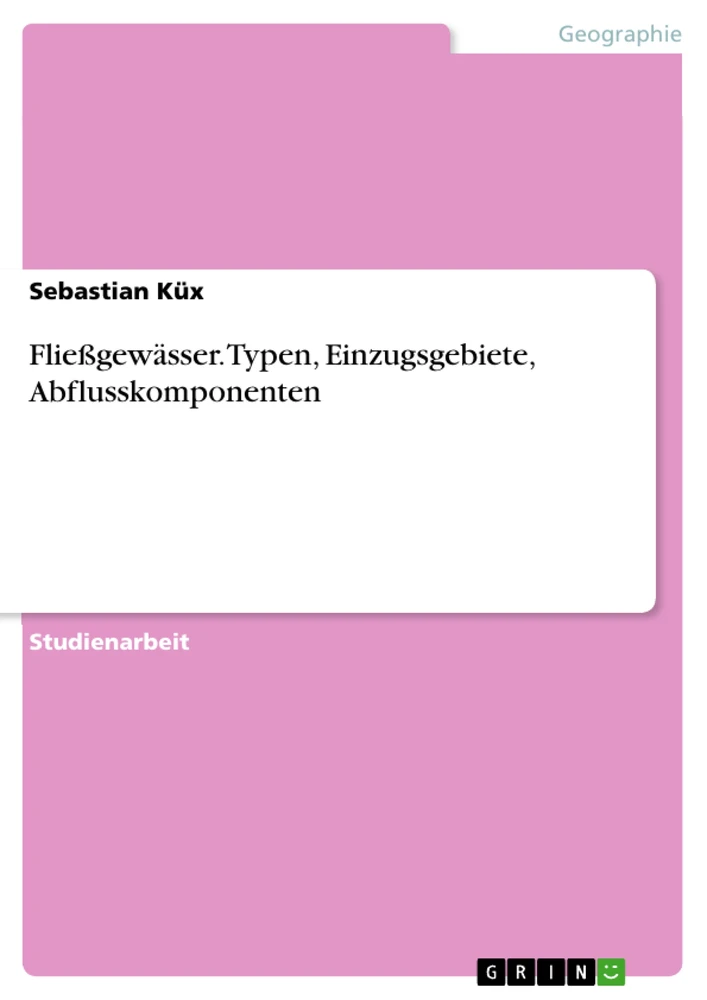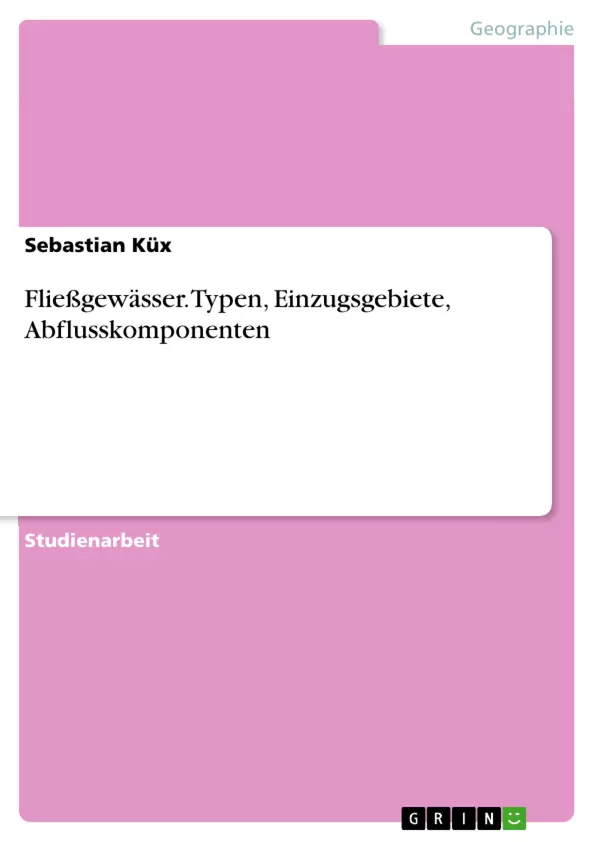Fließgewässer werden u.a. durch die Hydrologie bzw. der Hydrogeographie wissenschaftlich erforscht. Sie bilden den wichtigsten Grundpfeiler für den Transport von z.B. Regenwasser, welches hierdurch grundsätzlich zunächt in gebündelter Form zusammengefasst wird und entlang des Flusslaufs, mit dem Gefälle bis zur Mündung, in das Meer oder ein Binnengewässer fließt.
Fließgewässer sind in ihrer Genese und bei der weiteren Formung ständigen Veränderungsprozessen ausgesetzt, die zu sehr dynamischen, und bedingt durch die vielen natürlichen Wirkungsparameter, zu individuellen Formen führen können. Eine Typisierung ist daher zwingend notwendig, um im wissenschaftlichen Rahmen Zuordnungen und damit Vergleiche vornehmen zu können.
In dieser Arbeit werden die hauptsächlich zur Hydrogeographie gehörenden Aspekte des Fließgewässersystems, also die räumliche Verortung sowie ihre Raumwirksamkeit beleuchtet. Fließgewässertypen werden vorgestellt, ihre Einzugsgebiete sowie die Abflusskomponenten werden thematisiert, weitreichende physikalische Grundaspekte die zur Thematik der Hydrologie gehören, müssen daher aber außer Acht gelassen werden.
Nachdem die Fließgewässertypen vorgestellt werden, sollen die Abflusskomponenten und Einzugsgebiete näher erläutert werden, um hierdurch einen Eindruck über die ihnen zugrunde liegenden Wechselwirkungen zu bekommen. Im Anschluss daran wird im Fazit, eine Bewertung zur Typisierung gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fließgewässertypen
- Einzugsgebiete
- Abflusskomponenten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von Fließgewässern, insbesondere im Rahmen der Hydrologie und Hydrogeographie. Die Arbeit beleuchtet die räumliche Verortung und Raumwirksamkeit von Fließgewässern, indem sie Fließgewässertypen, deren Einzugsgebiete und Abflusskomponenten näher erläutert. Dabei werden wichtige physikalische Grundaspekte der Hydrologie ausgeklammert.
- Typisierung von Fließgewässern
- Charakterisierung von Einzugsgebieten
- Analyse von Abflusskomponenten
- Wechselwirkungen zwischen Fließgewässern, Einzugsgebieten und Abflusskomponenten
- Bewertung der Typisierung von Fließgewässern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Relevanz und Bedeutung von Fließgewässern in der wissenschaftlichen Forschung. Sie betont die dynamischen Prozesse, die die Entstehung und Veränderung von Fließgewässern prägen und die Notwendigkeit einer Typisierung für vergleichende Untersuchungen. Die Arbeit fokussiert auf hydrogeografische Aspekte des Fließgewässersystems.
Fließgewässertypen
Dieses Kapitel präsentiert die aktuelle Fließgewässertypisierung nach Pottgiesser und Sommerhäuser, die auf den Arbeiten von Schmedtje basiert und die 2000 in Kraft getretene EG- Wasserrahmenrichtlinie berücksichtigt. Es werden 25 idealtypische Gewässertypen für Deutschland vorgestellt, die sich in Steckbriefen mit morphologischen Beschreibungen, physiko-chemischen Leitwerten und biozönotischen Charakteristika manifestieren.
Einzugsgebiete
Dieses Kapitel behandelt die Einzugsgebiete von Fließgewässern, die die Bereiche umfassen, aus denen Wasser in den jeweiligen Flusslauf gelangt. Es werden die Faktoren betrachtet, die die Größe und Form von Einzugsgebieten beeinflussen und wie sie sich auf den Abfluss und die hydrologische Dynamik des Flusses auswirken.
Abflusskomponenten
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Abflusskomponenten erläutert, die zum Wasserhaushalt eines Flusses beitragen. Es werden die Quellen des Abflusses, wie z.B. Niederschlag, Schmelzwasser und Grundwasser, sowie die Prozesse, die den Abfluss regulieren, wie z.B. Verdunstung und Infiltration, besprochen.
Schlüsselwörter
Fließgewässer, Typisierung, Einzugsgebiete, Abflusskomponenten, Hydrologie, Hydrogeographie, Wasserrahmenrichtlinie, morphologische Beschreibungen, physiko-chemische Leitwerte, biozönotische Charakterisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eine Typisierung von Fließgewässern notwendig?
Da Fließgewässer sehr dynamisch und individuell sind, ermöglicht eine Typisierung wissenschaftliche Vergleiche und Zuordnungen innerhalb der Hydrologie und Hydrogeographie.
Wie viele Fließgewässertypen gibt es in Deutschland?
Nach dem aktuellen System von Pottgiesser und Sommerhäuser werden 25 idealtypische Gewässertypen für Deutschland unterschieden.
Was versteht man unter dem Einzugsgebiet eines Flusses?
Das Einzugsgebiet umfasst die gesamte Fläche, aus der das Oberflächenwasser und teilweise das Grundwasser dem jeweiligen Fließgewässer zufließt.
Welche Komponenten tragen zum Abfluss eines Gewässers bei?
Wichtige Abflusskomponenten sind unter anderem direkte Niederschläge, Schmelzwasser, Oberflächenabfluss und der Basisabfluss aus dem Grundwasser.
Welche Rolle spielt die EG-Wasserrahmenrichtlinie für die Gewässertypen?
Die Richtlinie aus dem Jahr 2000 bildet den rechtlichen Rahmen für die moderne Typisierung und Bewertung von Gewässern nach morphologischen, physiko-chemischen und biologischen Kriterien.
- Citar trabajo
- Sebastian Küx (Autor), 2013, Fließgewässer. Typen, Einzugsgebiete, Abflusskomponenten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266211