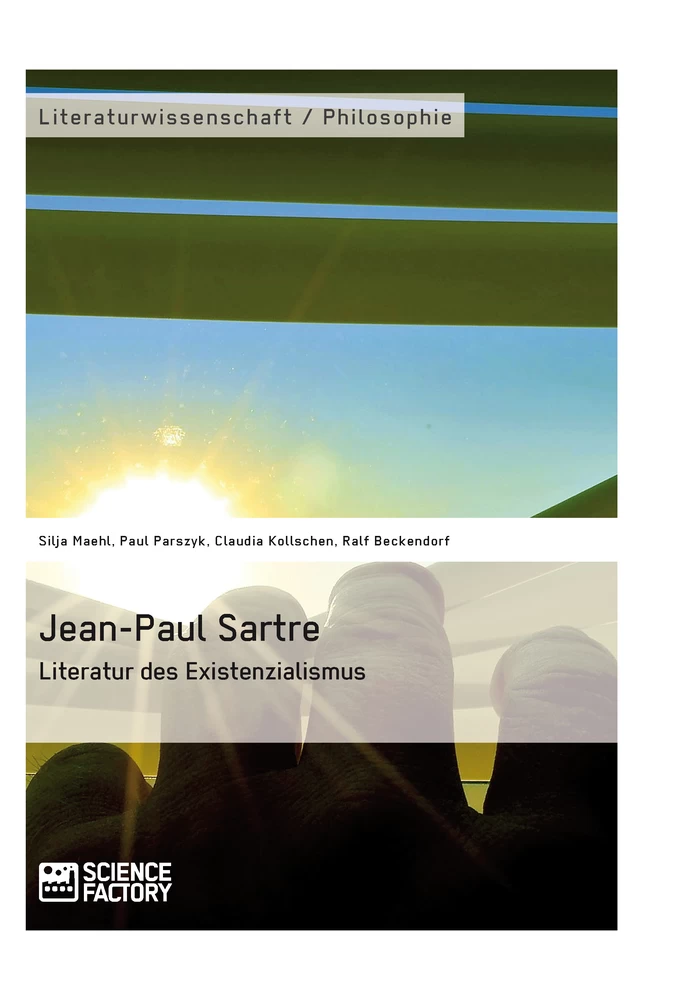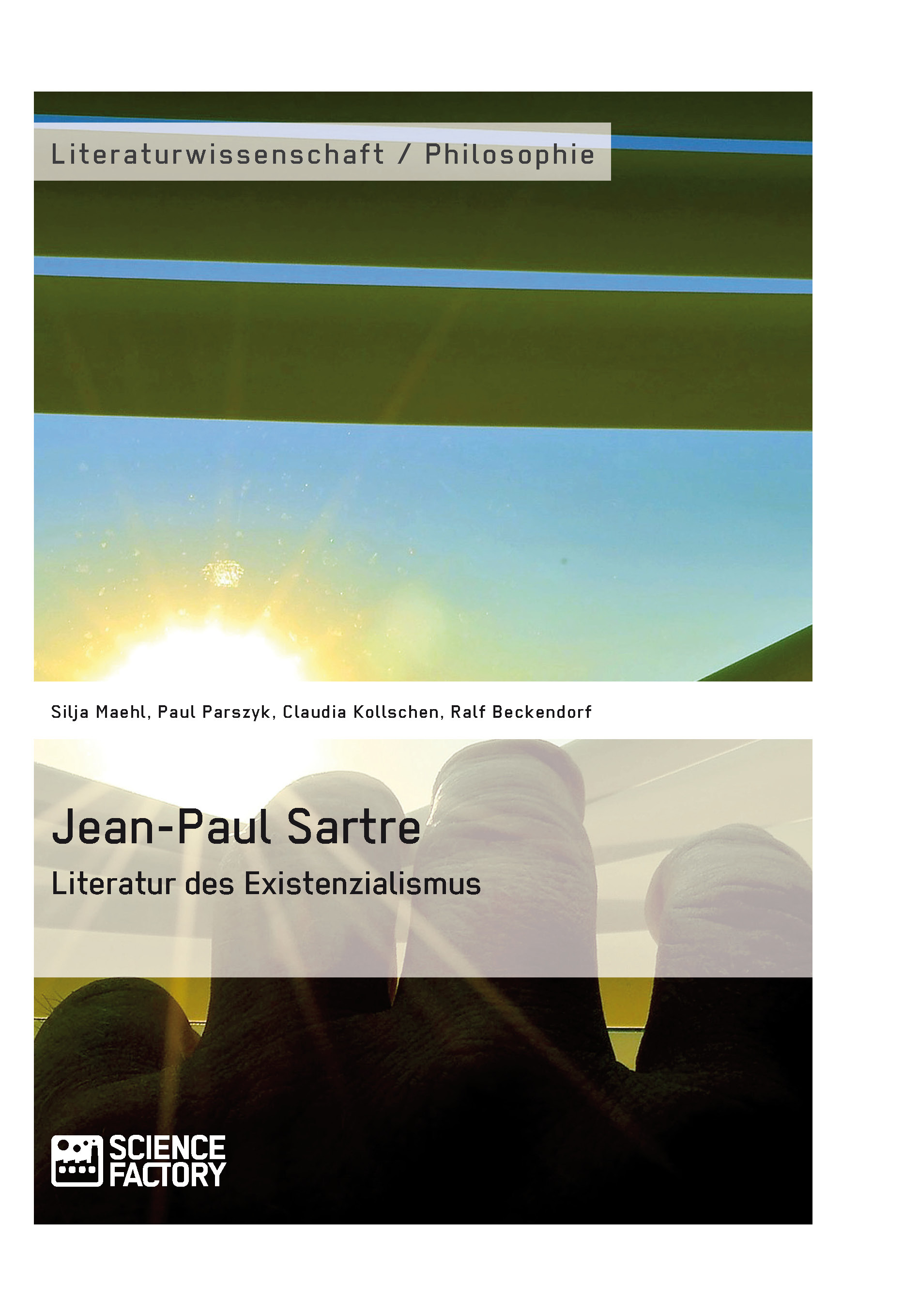„Die Hölle, das sind die anderen“ – wie bei kaum einem anderen Autor ist die schriftstellerische Tätigkeit Jean-Paul Sartres unlösbar mit seiner Philosophie verknüpft, wie sich in seinen literarischen Werken deutlich zeigt.
Dieses Buch stellt in einem einführenden Beitrag Sartres Verständnis von Kunst und Literatur vor. Darüber hinaus ziehen die Autoren Verbindungslinien zwischen der Philosophie des Existenzialismus sowie Sartres Erstlingsroman „Der Ekel“ und dem Drama „Geschlossene Gesellschaft“.
Aus dem Inhalt: Zur Theorie des imaginären Kunstwerks; Sartres Theorie der Intersubjektivität; Unbehagen, Scham und Ekel in „Das Sein und das Nichts“ und „Der Ekel“; Elemente des Existenzialismus in „Geschlossene Gesellschaft“
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PHÄNOMENOLOGIE KUNST — OAS SEMIOTISCHE UNO MATERIALISTISCHE KUNSTVERSTÄNDNIS „
- SARTRES KUNSTVERSUNONIS
- KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT SARTRE „
- FAZIT
- BIBLIOGRAPHIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Kunstverständnis von Jean-Paul Sartre, insbesondere seine Theorie des imaginären Kunstwerks. Trotz der Vielseitigkeit seiner Themenbereiche, wie Phänomenologie, Ontologie, Existenzphilosophie, Politik und Psychologie, widmet sich Sartre in seinen Werken immer wieder der Kunst.
- Das Verhältnis von Phänomenologie und Kunst
- Sartres Abgrenzung vom semiotischen und materialistischen Kunstverständnis
- Sartres Theorie des imaginären Kunstwerks
- Die Rolle des Künstlers und des Rezipienten in Sartres Kunstverständnis
- Kritische Auseinandersetzung mit Sartres Kunsttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung Die Einleitung erläutert das Ziel der Arbeit und stellt die wichtigsten Themenbereiche vor.
- Phänomenologie und Kunst Dieses Kapitel untersucht die These von Lambert Wiesing, dass zwischen Phänomenologie und Kunst eine innere Verwandtschaft besteht. Wiesing argumentiert, dass die Phänomenologie aufgrund ihrer Imaginarität, Synthetizität und Intentionalität dem Wesen der Kunst nahe kommt.
- Das semiotische und materialistische Kunstverständnis Dieses Kapitel stellt die semiotische und materialistische Sichtweise auf Kunst dar, die Sartre ablehnt. Das semiotische Kunstverständnis betrachtet Kunstwerke als Symbole, während das materialistische Kunstverständnis den Fokus auf die Materialität des Werkes legt.
- Sartres Kunstverständnis Dieses Kapitel analysiert Sartres Kunstverständnis, das sich von den semiotischen und materialistischen Ansätzen abhebt. Sartre sieht Kunst als eine Funktion sui generis, die durch die Präsentation von Imagination und indirekte Kommunikation zwischen Künstler und Rezipient entsteht.
- Der Künstler Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Künstlers in Sartres Kunsttheorie. Sartre betont die Subjektivität des Künstlers und die Wichtigkeit seiner Imagination.
- Der Rezipient Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Rezipienten in Sartres Kunstverständnis. Sartre sieht den Rezipienten als den eigentlichen Schöpfer des Sinns im Kunstwerk.
- Kritische Auseinandersetzung mit Sartre Dieses Kapitel stellt kritische Anmerkungen zu Sartres Kunsttheorie dar, insbesondere hinsichtlich seiner Trennung von Wahrnehmung und Vorstellung. Es wird argumentiert, dass Sartre die materialistische Seite der Kunst vernachlässigt und das Kunstwerk zu einer rein imaginären Vorstellung reduziert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
- Quote paper
- Silja Maehl (Author), Paul Parszyk (Author), Claudia Kollschen (Author), Ralf Beckendorf (Author), 2013, Jean-Paul Sartre. Literatur des Existenzialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266232