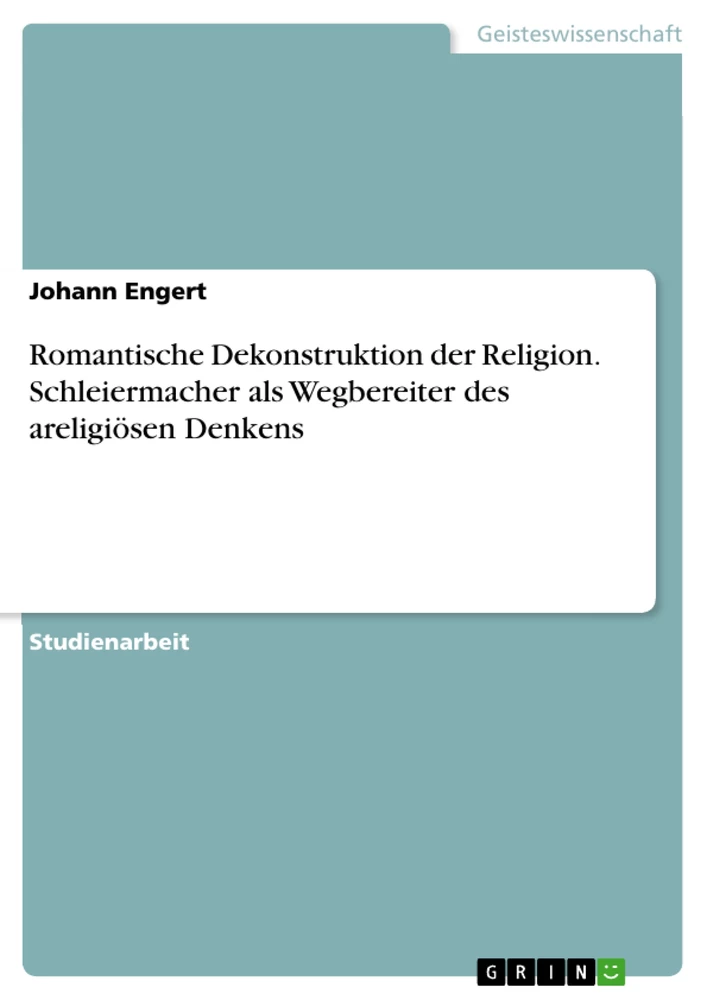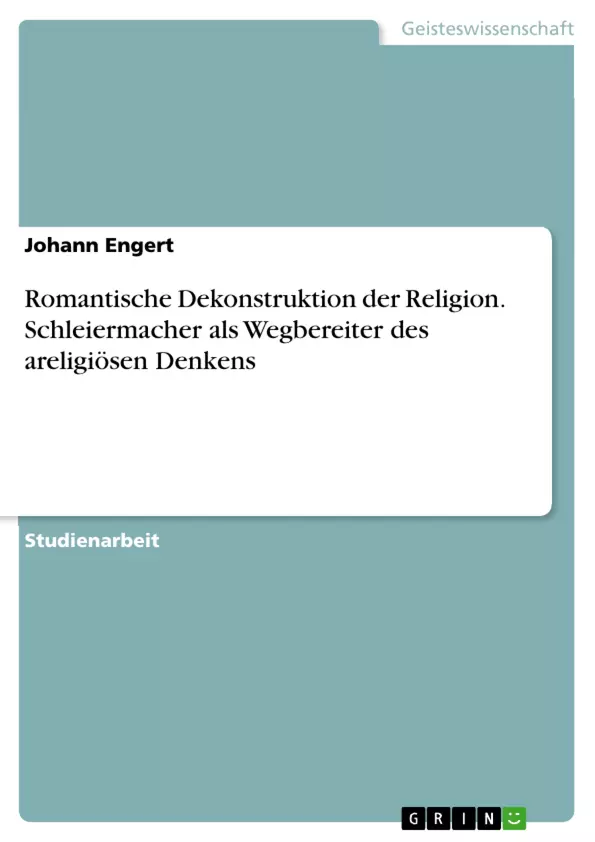Schleiermacher gilt als der Denker, der religiösen Weltentwürfen, Weltsichten, Einstellungen, Lebenshaltungen, aus der Begriffswelt der Romantik heraus eine neue, menschliche Grundlage gegeben hat: das Gefühl. In intensiven, tiefwühlenden Gefühlszustände und -Einstellungen, die Schlegels Ironie und Novalis' Mystik in sich vereinen, sei das Höhere präsent. Nie aber soll dieses Höhere als dogmatischer Ausgangspunkt engherzigen Denkens und Handelns missbraucht werden, vielmehr soll es das Leben begleiten, prägen, führen. Das religiöse Gefühl macht keine Aussage über Götter, Mythologie, Metaphysik und Moral, es ist völlig frei und unbestimmt.
Doch wo Schleiermacher der Religion eine neue Grundlage schaffen will, entzieht er ihr in Wirklichkeit jedes Fundament. Im Spiegel soziologischer und philosophischer Blickwinkel nach Schleiermacher erscheint Religion historisch als System aus Glaubensinhalten und Glaubensregeln, also eben Metaphysik und Moral, von denen Schleiermacher sich lösen will. Die dogmatische Religiosität, die er selbst angreift, fällt zusammen mit dem, was nachromantische Religionskritiker als Religion überhaupt überwinden wollen. Es bleibt das Gefühl, das als solches frei ist, und nie die soziale und politische Funktion einer Religion tragen kann.
Um romantische Religion und Mystik zu verstehen, werden zusätzlich die Standpunkte Schlegels, Tiecks, Wackenroders und Novalis' untersucht. Im Mittelpunkt der darauffolgende Studie über nachromantische Religionskritik stehen Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud. Letztlich, vergleichend, werden uns auch die Positionen Durkheims, Adornos und Horkheimers interessieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil: Romantische Religion, oder: Schleiermachers „Reden" im Kontext der romantischen Konzeptionen von Natur, Universum, Religion
- Schlegel, Romantische Ironie, Weltspieltheorie: Universalpoesie
- Novalis: Romantische Natur- Seins- und Todesmystik
- Tieck, Wackenroder, Mystik des Geheimen und der Verheißung, Kunstreligion
- Schleiermacher, Romantische Religion
- Zweiter Teil: Motive der Religionskritik im 19. und 20. Jahrhundert
- Feuerbach: Marx, sozialphilosophische Religionskritik
- Nietzsche: Experimentalphilosophische Religionskritik
- Freud, Psychoanalytische Religionskritik
- Dritter Teil: Romantische Dekonstruktion der Religion, oder: die „Reden" im Kontext nachromantischer Religionsbitik und soziologischen Religionsbestimmung
- Gemeinsame Angriffspunkte: Metaphysik und Moral
- Durkheim: Versuch einer Definition der Religion
- Schleiermacher, romantische Religionsdekonstruktion
- Drei Einwände
- Romantische Mystik und Religion
- Einleitung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Modulabschlussarbeit befasst sich mit dem Werk Friedrich Schleiermachers „Über die Religion" und analysiert dessen Bedeutung im Kontext der romantischen Religion und der postromantischen Religionskritik. Ziel ist es, Schleiermachers Religionsbild als Quintessenz der romantischen Religion darzustellen und zu untersuchen, wie es vor den theoretischen Angriffen von Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud besteht. Die Arbeit beleuchtet, welche Prinzipien Schleiermachers Religionsbild aufstellt und inwiefern es Zielobjekt oder Unterstützung der Destruktion der Religion ist.
- Romantische Religion und Mystik
- Motive der Religionskritik im 19. und 20. Jahrhundert
- Schleiermachers „Reden" im Kontext der Religionskritik
- Die Rolle der Phantasie in der religiösen Anschauung
- Die Bedeutung des Gefühls für Schleiermachers Religionsbild
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der romantischen Religion und ihren zentralen Denkern, darunter Friedrich Schlegel, Novalis und Ludwig Tieck. In diesem Kontext wird Schleiermachers „Reden über die Religion" als ein zentrales Werk der romantischen Religion vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Schleiermachers Ansatz und den Gedanken der anderen Romantiker, insbesondere in Bezug auf die Rolle der Phantasie, des Gefühls und des Unendlichen in der religiösen Anschauung.
Im zweiten Teil der Arbeit werden die wichtigsten Motive der Religionskritik des 19. und 20. Jahrhunderts untersucht, darunter die sozialphilosophische Religionskritik von Feuerbach und Marx, die experimentalphilosophische Religionskritik von Nietzsche und die psychoanalytische Religionskritik von Freud. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Kritikpunkte dieser Denker und stellt sie in Bezug zu Schleiermachers „Reden".
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern Schleiermachers „Reden" als eine Dekonstruktion der Religion verstanden werden können. Hierzu wird Durkheims Religionsdefinition als Ausgangspunkt für die Analyse verwendet. Die Arbeit zeigt, dass Schleiermachers Religionsbild mit den Kritikpunkten von Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud teilweise übereinstimmt und in einigen Fällen sogar deren Argumentation vorwegzunehmen scheint. Die Arbeit beleuchtet auch die Rolle des Mystischen in Schleiermachers Religionsbild und diskutiert die Bedeutung des Gefühls für die religiöse Anschauung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die romantische Religion, die Religionskritik im 19. und 20. Jahrhundert, Friedrich Schleiermacher, „Über die Religion", Phantasie, Gefühl, Unendliche, Metaphysik, Moral, Durkheim, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Mystik.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Kernansatz verfolgt Schleiermacher in Bezug auf Religion?
Schleiermacher verankert Religion im "Gefühl" und in der "Anschauung des Universums", fernab von dogmatischen Lehren, Metaphysik oder reiner Moral.
Warum wird Schleiermacher als Wegbereiter des areligiösen Denkens gesehen?
Indem er Religion von festen Inhalten (Götter, Dogmen) löst und auf das subjektive Gefühl reduziert, entzieht er ihr gleichzeitig das soziale und politische Fundament, das Kritiker wie Marx oder Nietzsche später angriffen.
Welche Rolle spielt die Phantasie in der Romantik?
Die Phantasie gilt als zentrales Organ zur Erfassung des Unendlichen und des Höheren, was sich in der Universalpoesie von Schlegel oder der Mystik von Novalis widerspiegelt.
Wie stehen Feuerbach und Freud zur Religion?
Feuerbach sieht Religion als Projektion menschlicher Wünsche, während Freud sie als psychoanalytisches Phänomen (Illusion) deutet. Beide Positionen werden Schleiermachers Gefühlsbegriff gegenübergestellt.
Was bedeutet "romantische Dekonstruktion der Religion"?
Es beschreibt den Prozess, bei dem die Romantiker traditionelle religiöse Strukturen auflösen, um sie durch eine ästhetisierte Kunstreligion oder reine Innerlichkeit zu ersetzen.
- Arbeit zitieren
- Johann Engert (Autor:in), 2013, Romantische Dekonstruktion der Religion. Schleiermacher als Wegbereiter des areligiösen Denkens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266318