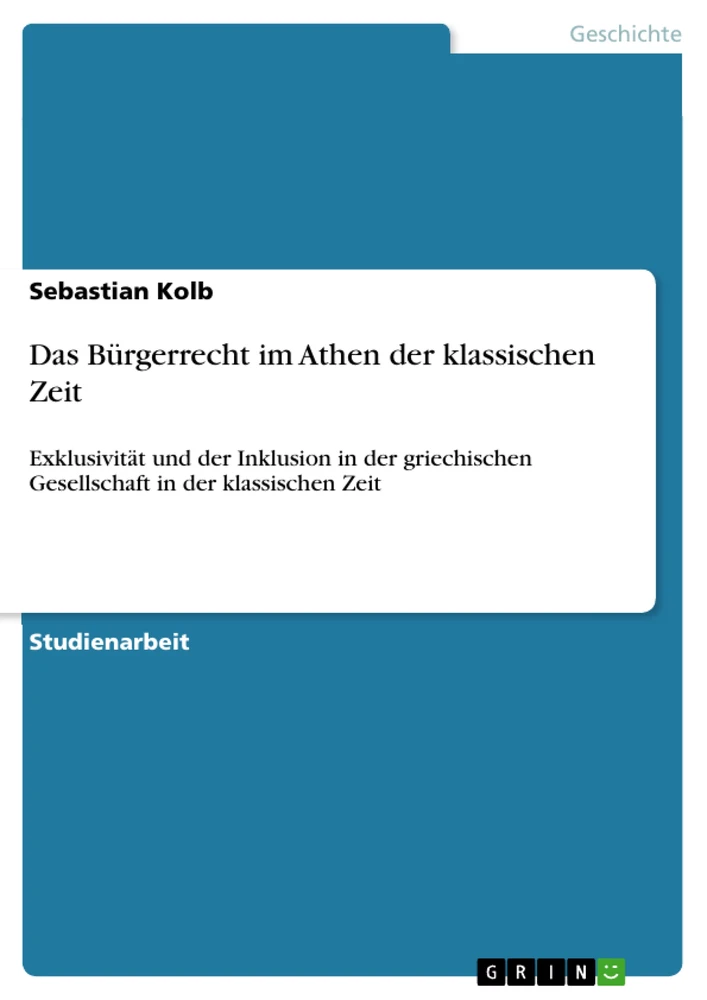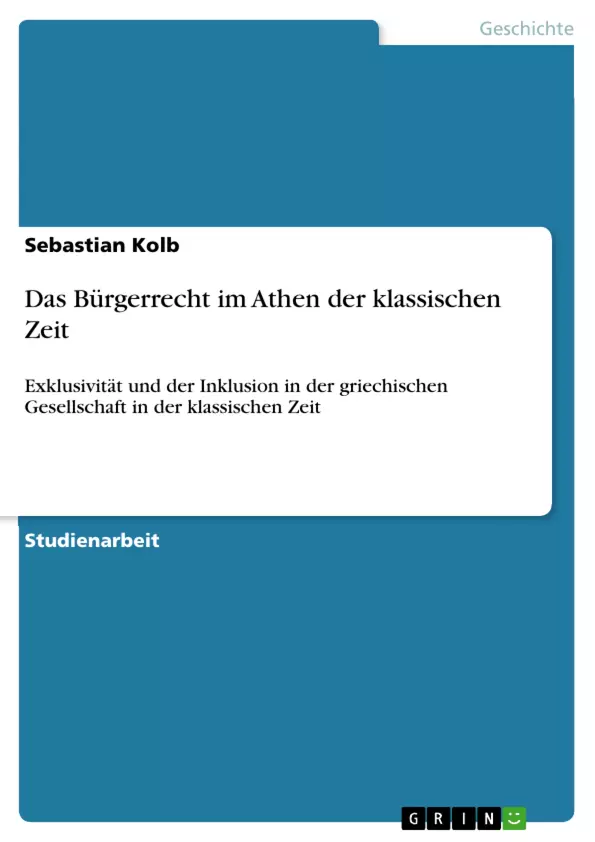„Mit Namen heißt sie, weil die Staatsverwaltung nicht auf wenige, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist, Demokratie “. Diese Worte stammen aus der Leichenrede des Perikles. In dieser Rede, bei der es vornehmlich um die Bestattung der ersten Gefallen des nun seit einem Jahr wütenden Peloponnesischen Krieges geht, beschreibt Perikles die Verfassung und politische Grundlage der Polis Attika und der Stadt Athen als die vorbildlichste ihrer Zeit. Die von ihm angepriesene Macht auf den Schultern der Mehrheit stellt die charakteristische Grundlage der Demokratie in Athen dar.
Es ist davon auszugehen, dass Demokratie ein Begriff ist, welcher erst in jene Zeit des klassischen Griechenlands fällt, genauer zwischen 477 und 462 n. Chr. ensteht. Die Athener sahen sich somit, laut Perikles, in einem politischen System der Volksherrschaft, einem Konstrukt der Macht des Volkes. Diese begründet sich zum einen aus dem Archontat Solons 590 n. Chr. sowie den Reformen der Demen des Kleisthenes 507 n. Chr. und der Entmachtung des Areopags durch Ephialtes 462 n. Chr. Großen Einfluss hatte jedoch auch das Bürgerrechtsgesetz, das von Perikles 451 v. Chr. maßgeblich vorangetrieben wurde.
Jenes Bürgerrechtsgesetz ist die Grundlage der von Perikles beschriebenen Demokratie. Zu dieser Gesetzgebung und deren Auswirkung stelle ich meine Forschungsfrage: „Lässt sich die Attische Demokratie als eine auf dem Bürgerrecht fußende, für einen elitären Kreis der Bewohner zugängliches politisches System erachten, welches keine Möglichkeit der Inklusion von außerhalb ermöglichte und dies auch nicht wollte?“ Hierzu hinterfrage ich anhand von Quellen aus Aristoteles, Thukydides, Pseudo-Xenophons und Plutarchs Werken, wie zugänglich die Politik dieser Zeitepoche war, sowie wie Beteiligte und deren mögliche Ämter, als auch die zwangsläufig Unbeteiligten des politischen Systems zu klassifizieren sind. Außerdem werde ich deren Möglichkeiten der politischen Partizipation analysieren. Gerade die sehr genau durch das Bürgerrecht definierte Gruppe der politisch Beteiligten möchte ich in dieser Ausarbeitung kritisch skizzieren, um die Forschungsfrage und deren Relevanz für die Beschreibung einer Demokratie zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Exklusivität des Bürgerrechts
- Zugang zum Bürgerecht
- Rechte und Pflichten der Bürger
- Der Weg in die Ämter
- Inklusion des Bürgerrechts
- Stellung der Athener Frauen und Kinder
- Status der Metöken
- Status der Sklaven
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bürgerrecht im Athen der klassischen Zeit und analysiert, ob es sich um ein exklusives System handelte, das Inklusion von Nicht-Bürgern verhinderte. Sie befasst sich mit der Frage, wie die politische Teilhabe in Athen geregelt war und welche Rolle die elterliche Herkunft für den Zugang zu Bürgerrechten spielte.
- Exklusivität des Bürgerrechts in Athen
- Zugang zum Bürgerecht und die Rolle der elterlichen Herkunft
- Rechte und Pflichten von Bürgern
- Die Stellung von Frauen, Kindern, Metöken und Sklaven
- Die Rolle des Bürgerrechts für die politische Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einleitung und stellt die Forschungsfrage zur Exklusivität und Inklusion des Bürgerrechts in Athen. Im zweiten Kapitel werden die Exklusionsmechanismen des Bürgerrechts näher betrachtet, einschließlich der Zugangsvoraussetzungen, Rechte und Pflichten sowie dem Weg in die Ämter. Das dritte Kapitel widmet sich der Inklusion des Bürgerrechts und untersucht die Stellung von Frauen, Kindern, Metöken und Sklaven in der athenischen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Bürgerrecht, Athen, klassische Zeit, Demokratie, Exklusivität, Inklusion, politische Teilhabe, Metöken, Sklaven, Frauen, Kinder, elterliche Herkunft.
- Quote paper
- Bachelor of Engíneering Sebastian Kolb (Author), 2013, Das Bürgerrecht im Athen der klassischen Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266323