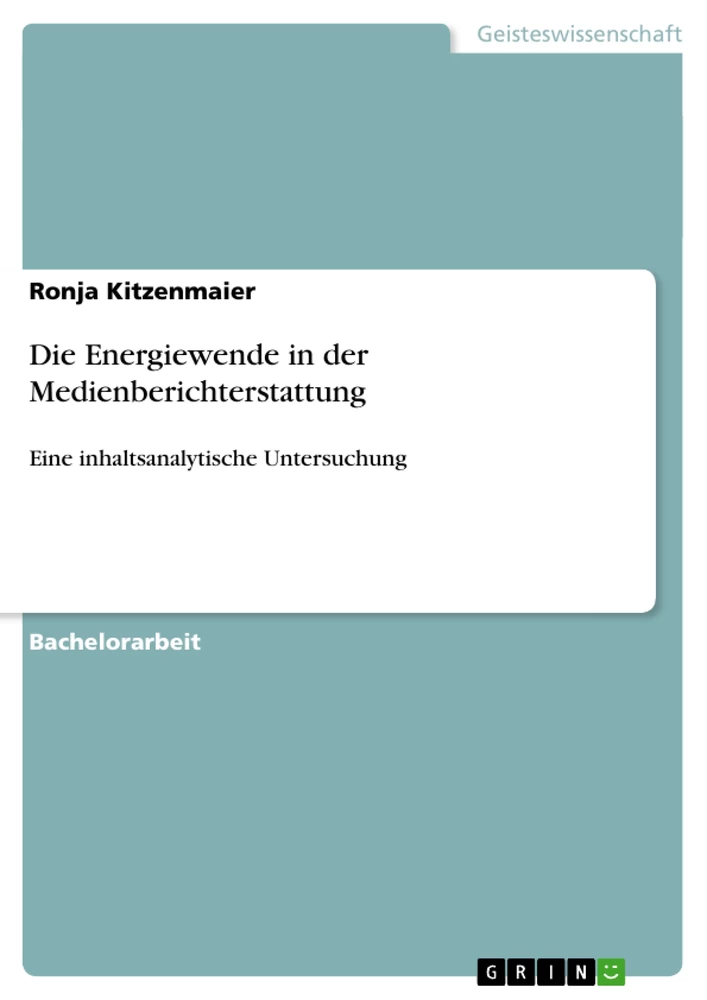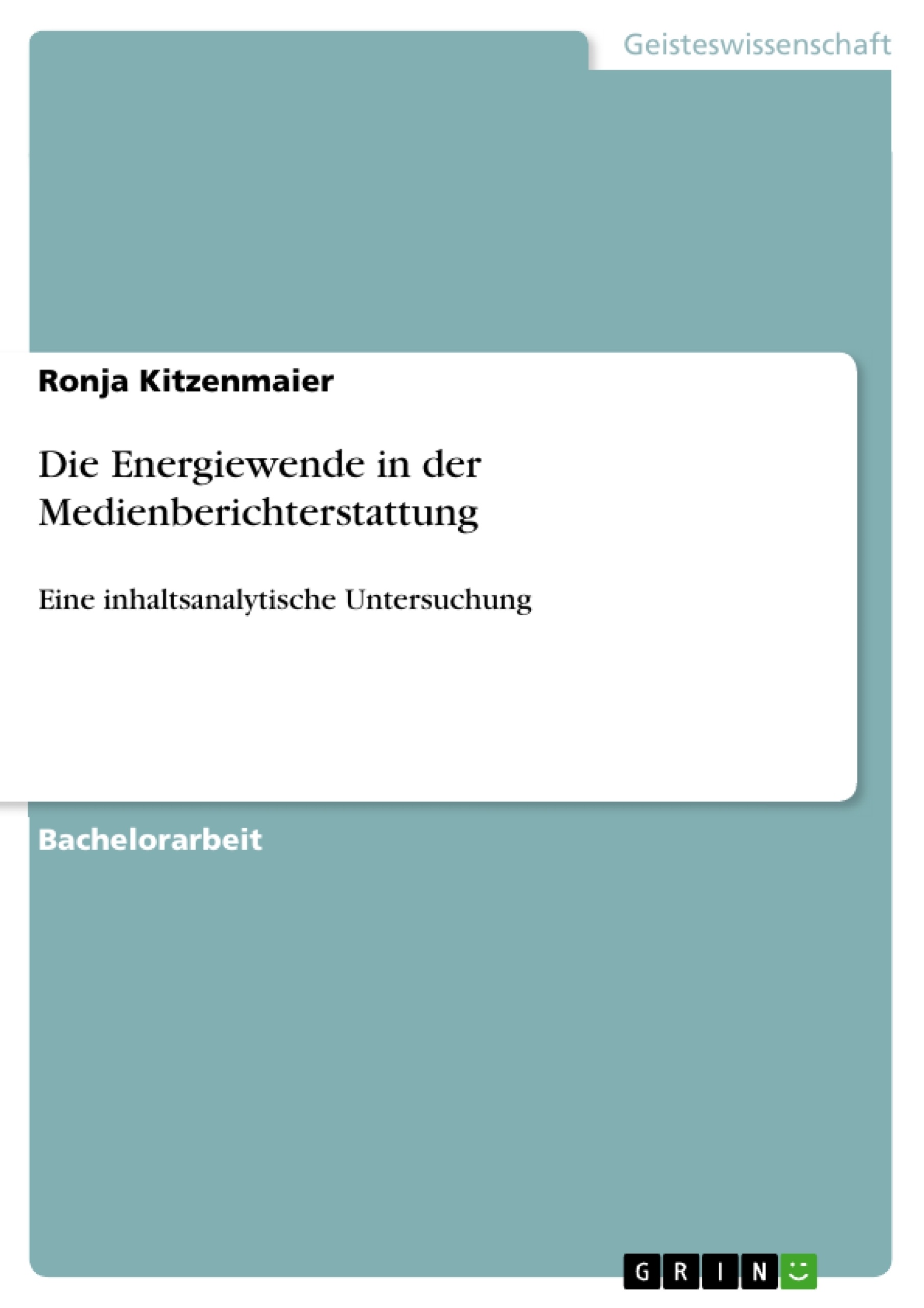Der Strom kommt aus der Steckdose. Für die meisten Verbraucher endet an dieser Stelle die Auseinandersetzung mit der Herkunft der Energie. Doch der Verbrauch in einem Industrieland wie Deutschland ist enorm und die Bedeutung der Verfügbarkeit entsprechend hoch. Nicht nur die gegenwärtigen Generationen, sondern auch Nachfahren
bis in weiter Zukunft werden von der Stromversorgung abhängig sein. Deshalb ist es wichtig die Herkunft und die Art der Energiequellen zu hinterfragen.
Seit der Atomkatastrophe in Fukushima im März 2011 ist das Bewusstsein in der Bevölkerung und der Politik hinsichtlich der Risiken von Kernenergie deutlich gestiegen. Aus einer statistischen Größe wird ein ausgewachsener Super-GAU. Die
Bundesregierung vollzieht eine rasante Kehrtwende in Sachen Atompolitik und beschließt die Energiewende zu beschleunigen. Die Energiewende beinhaltet über den Atomausstieg hinaus, beispielsweise auch den Ausbau regenerativer Energien und Stromnetze. Zahlreiche Maßnahmen werden seitens der Bundesregierung ergriffen, woraus einschlägige Konsequenzen folgen. Die Bevölkerung ist von einigen dieser Neuerungen direkt betroffen und hat das Bedürfnis informiert zu werden.
Die Hauptbezugsquelle der Gesellschaft hinsichtlich politischer Informationen stellen die Medien dar. Denn „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt in der wir leben wissen, wissen wir durch die Massenmedien“ (Luhmann 2009:9). Die Art und Weise der Medienberichterstattung hat demnach einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Meinungsbildung der Gesellschaft (vgl. Luhmann 2009:125f.). Da das
öffentliche Bild der Energiewende durch die Medienberichterstattung zumindest beeinflusst,
wenn nicht sogar bestimmt wird, soll im Folgenden die Medienberichterstattung zum Thema Energiewende untersucht werden. Die Forschungsfrage für die
vorliegende Arbeit lautet daher: „Wie lässt sich die Medienberichterstattung bezüglich der Energiewende beschreiben?“. Ziel der Arbeit ist es, die Art der Berichterstattung im Jahr 2011 zu analysieren und zu interpretieren. Der Fokus liegt hierbei auf der Themenauswahl, sowie der Wertungen der jeweiligen Themen in der Berichterstattung. Untersucht wird, welche Themen in welcher Weise Gegenstand der Berichterstattung sind und welche Wertvorstellungen in den Artikel projiziert werden. Die zeitliche Entwicklung der Berichterstattung gibt Aufschluss über die Verteilung der Artikel in einem Jahr und die Bedeutung von Schlüsselereignissen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Energiewende
- Die zeitliche Entwicklung
- Erneuerbare Energien
- Wasserkraft
- Windkraft
- Photovoltaik
- Solarthermie
- Biomasse
- Staatliche Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende
- Atomausstieg
- Erneuerbare Energien ausbauen
- Netzausbau
- Elektroautos fördern
- Mögliche Konsequenzen der Energiewende
- Forschungsdesign
- Quantitative Inhaltsanalyse
- Online-Forschung
- Formulierung der Hypothesen
- Vollerhebung
- Kategoriensystem
- Formale Kategorien
- Inhaltliche Kategorien
- Probecodierung
- Validitätstest
- ReliabilitätsTest
- Ergebnisse der Untersuchung
- Ergebnisse der formalen Kategorien
- Darstellung der Ergebnisse
- Prüfung der Hypothesen Hl.l und Hl.2
- Ergebnisse der inhaltlichen Kategorien
- Darstellung der Ergebnisse
- Prüfung der Hypothesen H2.1 bis H4.2
- Ergebnisse der formalen Kategorien
- Schlussbetrachtung
- Interpretation der Ergebnisse
- Formale Kategorien
- Inhaltliche Kategorien
- Kritische Reflexion der Untersuchung
- Interpretation der Ergebnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Weiterführende Literatur
- Anhang: Codebuch (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit im Fach Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart untersucht die Medienberichterstattung zur Energiewende im Jahr 2011 anhand einer inhaltsanalytischen Untersuchung. Ziel der Arbeit ist es, die Art der Berichterstattung zu analysieren und zu interpretieren, insbesondere hinsichtlich der Themenauswahl und der Wertungen in den Artikeln. Die Studie konzentriert sich auf zwei überregionale Prestigezeitungen, die Süddeutsche Zeitung und Die Welt, und analysiert deren Online-Angebote.
- Die zeitliche Entwicklung der Berichterstattung im Zusammenhang mit Schlüsselereignissen wie der Atomkatastrophe von Fukushima und dem Beschluss zur Energiewende
- Die Darstellung und Bewertung verschiedener erneuerbarer Energien, wie Windkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Wasserkraft und Biomasse
- Die Berichterstattung über staatliche Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende, darunter der Atomausstieg, der Ausbau erneuerbarer Energien, der Netzausbau und die Förderung von Elektroautos
- Die Darstellung möglicher Konsequenzen der Energiewende, einschließlich Strommangel, Strompreisentwicklung, Auswirkungen auf die Natur, Sicherheitsaspekte, Arbeitsplätze und die Kosten der Umsetzung
- Die Analyse der Personen und Gruppen, die in der Berichterstattung vorkommen, insbesondere Politiker, Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Energiewende in der Medienberichterstattung dar und formuliert die Forschungsfrage: „Wie lässt sich die Medienberichterstattung bezüglich der Energiewende beschreiben?".
Kapitel 2 liefert einen theoretischen Hintergrund zur Energiewende, indem es den Begriff der Energiewende, die zeitliche Entwicklung, die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen, staatliche Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende und mögliche Konsequenzen der Energiewende erläutert.
Kapitel 3 beschreibt das Forschungsdesign der Untersuchung. Es werden die Methode der quantitativen Inhaltsanalyse, die Auswahl der Untersuchungseinheiten (Online-Angebote der Süddeutschen Zeitung und Die Welt), die Formulierung der Hypothesen und die Bildung des Kategoriensystems erläutert. Außerdem werden die Validität und Reliabilität des Kategoriensystems anhand eines Validitätstests und eines ReliabilitätsTests geprüft.
Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar. Es werden die Ergebnisse der formalen Kategorien (z.B. zeitliche Entwicklung der Berichterstattung, Rubriken, Artikelgröße, Darstellungsform) und der inhaltlichen Kategorien (z.B. Themen, Wertungen, Personen, räumliche und zeitliche Dimensionen) präsentiert und die Hypothesen geprüft.
Die Schlussbetrachtung in Kapitel 5 interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung und reflektiert den Forschungsprozess kritisch. Es werden die Stärken und Schwächen der Untersuchung beleuchtet und mögliche zukünftige Forschungsrichtungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Energiewende, die Medienberichterstattung, die Atomkatastrophe von Fukushima, erneuerbare Energien, staatliche Maßnahmen, mögliche Konsequenzen, Inhaltsanalyse, Online-Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Themenauswahl, Wertungen, Personen, räumliche und zeitliche Dimensionen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde die Medienberichterstattung zur Energiewende untersucht?
Die Arbeit nutzt eine quantitative Inhaltsanalyse der Online-Angebote der "Süddeutschen Zeitung" und der "Welt" aus dem Jahr 2011.
Welchen Einfluss hatte Fukushima auf die Berichterstattung?
Die Atomkatastrophe im März 2011 war ein Schlüsselereignis, das zu einer massiven Zunahme der Artikel und einer kritischen Auseinandersetzung mit der Kernenergie führte.
Welche Themen standen im Fokus der Zeitungen?
Im Mittelpunkt standen der Atomausstieg, der Ausbau erneuerbarer Energien (Wind, Solar), der Netzausbau sowie die wirtschaftlichen Konsequenzen wie Strompreise und Kosten.
Welche Akteure kamen in den Medien am häufigsten zu Wort?
Die Berichterstattung wurde primär von Politikern, Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern geprägt, die als Experten oder Entscheidungsträger fungierten.
Gab es Unterschiede zwischen der Süddeutschen Zeitung und der Welt?
Die Studie analysiert die Wertungen der Themen in beiden Zeitungen, um herauszufinden, ob sie die Energiewende eher positiv als Chance oder negativ als Risiko darstellten.
- Quote paper
- Ronja Kitzenmaier (Author), 2013, Die Energiewende in der Medienberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266399