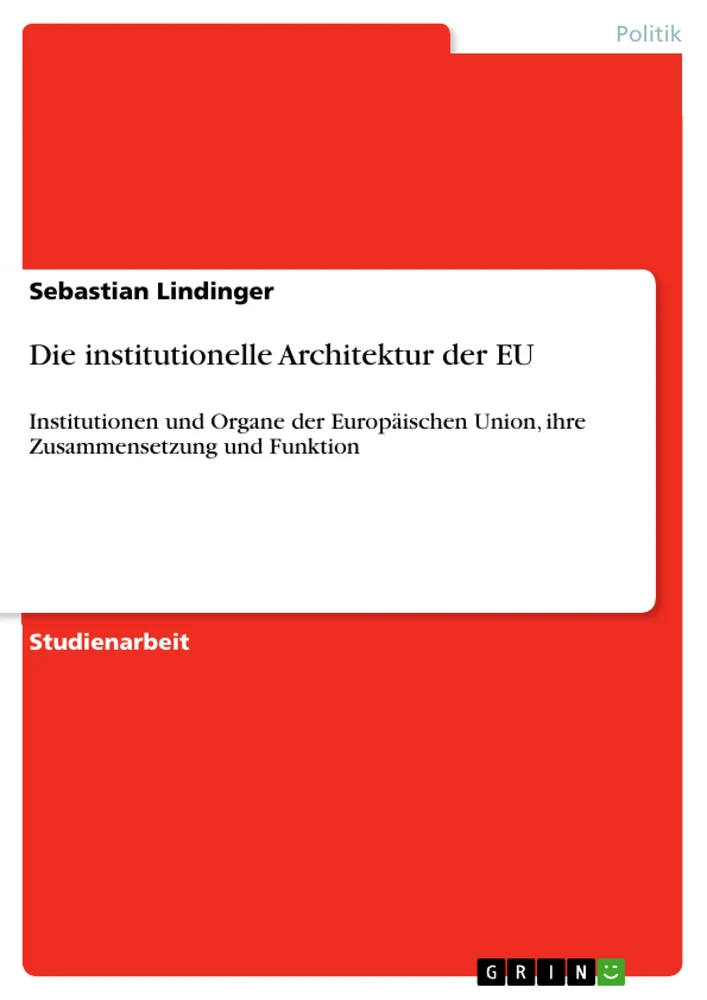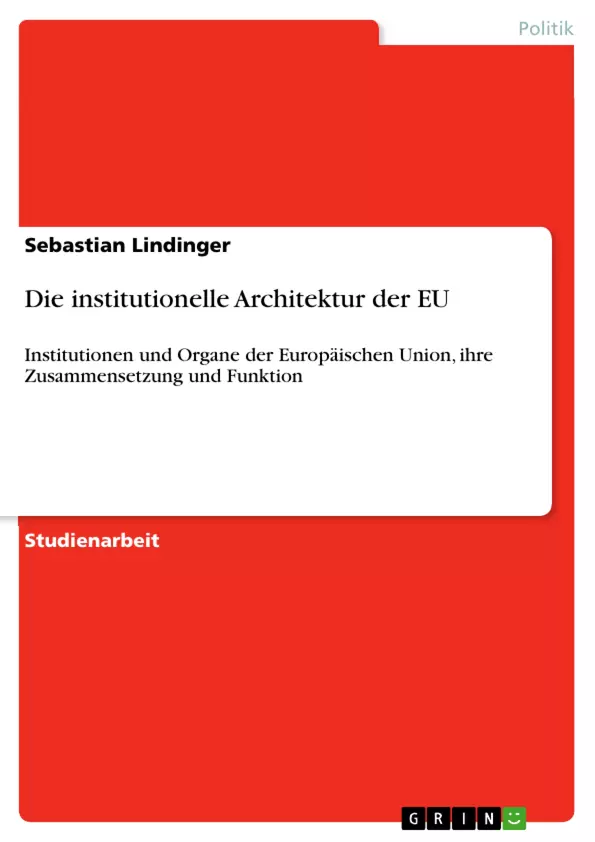Die supranationale Union der EU, die durch den EUV und den AEUV gem. Art 1 EUV als Rechtsnachfolgerin der Europäischen Gemeinschaft erschaffen worden ist, benötigt bestimmte Organe die für sie handeln. Gem. Art. 47 EUV besitzt die Europäische Union eine eigene Rechtspersönlichkeit, und gem. Art. 13 Abs 1 EUV einen institutionellen Rahmen. Der „Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung“ in Art. 5 Abs 1 EUV hat 2 Ausprägungen: Die „Verbandskompetenz“, demnach darf die EU nur dann handeln, wenn die Mitgliedsstaaten ihr für dieses Handeln die Kompetenz übertragen haben gem. Art. 4 und 5 Abs 1 EUV. Die „Organkompetenz“, regelt in Art. 13 Abs 2 EUV, dass sich die Befugnisse der Organe auf jene beschränken, die ihnen in den Verträgen zugeteilt worden sind. Gem. Art. 13 Abs 1 EUV hat die Europäische Union folgende Organe: Den Europäische Rat, den Rat, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und den Rechnungshof. Ergänzend gibt es noch den Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA), den Ausschuss der Regionen (ADR), die gem. Art 13 Abs 4 EUV dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission beratend zur Seite stehen und gem. Art. 282 AEUV das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Zusätzlich gibt es noch die Europäische Investitionsbank gem. Art. 308 AEUV. (vgl. Arndt/Fischer/Fetzer 2010, S. 19) Eine singuläre Regierung der Europäischen Union gibt es nicht. Man spricht hier eher von Regierungsfunktionen, die sich auf die Kommission, den Rat und den Europäischen Rat aufteilen. (vgl. Hartmann 2009, S. 59 f.)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Europäische Rat
- 2.1. Zusammensetzung
- 2.1.1. Der/die Präsidentin des Europäischen Rates
- 2.2. Aufgaben und Befugnisse des Europäischen Rates
- 2.3. Beschlussfassung im Europäischen Rat
- 2.1. Zusammensetzung
- 3. Der Rat
- 3.1. Zusammensetzung
- 3.1.1. Ratsvorsitz
- 3.2. Aufgaben und Befugnisse des Rates
- 3.3. Beschlussfassung im Rat
- 3.1. Zusammensetzung
- 4. Die Kommission
- 4.1. Zusammensetzung
- 4.1.1. Der/die Kommissionspräsidentin
- 4.2. Aufgaben und Befugnisse der Kommission
- 4.3. Beschlussfassung in der Kommission
- 4.1. Zusammensetzung
- 5. Das Europäische Parlament
- 5.1. Zusammensetzung
- 5.1.1. Der/die ParlamentspräsidentIn
- 5.2. Aufgaben und Befugnisse des Parlaments
- 5.3. Beschlussfassung im Parlament
- 5.1. Zusammensetzung
- 6. Der Europäische Gerichtshof
- 6.1. Organisation des Europäischen Gerichtshofs
- 6.1.1. Der Gerichtshof
- 6.1.2. Das Gericht
- 6.1.3. Das Fachgericht
- 6.2. Aufgaben und Zuständigkeitsverteilungen
- 6.2.1. Aufgaben
- 6.2.2. Zuständigkeitsverteilung
- 6.1. Organisation des Europäischen Gerichtshofs
- 7. Die Europäische Zentralbank
- 7.1. Aufgaben der EZB
- 7.2. Entscheidungsgremien der EZB
- 8. Der Europäische Rechnungshof
- 8.1. Aufgaben des Europäischen Rechnungshofes
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der institutionellen Architektur der Europäischen Union (EU) und erläutert die Zusammensetzung und Funktionsweise der wichtigsten Organe und Institutionen der EU.
- Die Rechtsgrundlagen der EU-Institutionen und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit
- Die Aufgaben und Befugnisse der verschiedenen Organe und Institutionen der EU
- Die Entscheidungsprozesse und Entscheidungsfindung innerhalb der EU
- Die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organen und Institutionen
- Die Rolle der EU-Institutionen im Kontext der europäischen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die grundlegende Bedeutung der EU-Institutionen für das Funktionieren der Europäischen Union und ihre Entwicklung aus der Europäischen Gemeinschaft heraushebt. Es wird auch auf die Prinzipien der begrenzten Einzelermächtigung und der Organkompetenz hingewiesen, die die Grundlage für die Organisation und das Zusammenspiel der EU-Organe bilden.
Im zweiten Kapitel werden die Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Europäischen Rates, dem politischen Leitungsorgan der EU, beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Rolle des Präsidenten des Europäischen Rates, der für die Kontinuität und Effizienz der Sitzungen verantwortlich ist.
Im dritten Kapitel wird der Rat der Europäischen Union mit seiner Zusammensetzung, seinen Aufgaben und Befugnissen sowie den Verfahren der Beschlussfassung im Rat untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Ratsvorsitz und seinen verschiedenen Aufgabenbereichen gewidmet.
Das vierte Kapitel analysiert die Europäische Kommission, die als Exekutivorgan der EU mit Vorschlagsrecht für Rechtsakte und der Verwaltung der EU-Politik betraut ist. Es werden die Zusammensetzung der Kommission, die Aufgaben und Befugnisse sowie das Entscheidungsverfahren in der Kommission beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Europäischen Parlament, dem demokratisch gewählten Organ der EU mit Gesetzgebungs- und Haushaltsbefugnissen. Die Zusammensetzung des Parlaments, die Aufgaben und Befugnisse sowie die Verfahren der Beschlussfassung im Parlament werden ausführlich behandelt.
Das sechste Kapitel beleuchtet den Europäischen Gerichtshof als oberstes Gericht der EU mit der Aufgabe, die Einhaltung des EU-Rechts zu gewährleisten. Die Organisation des Gerichtshofs, seine Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die Verfahren der Streitbeilegung werden analysiert.
Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit der Europäischen Zentralbank (EZB), der für die Geldpolitik in der Eurozone zuständigen Institution. Die Aufgaben der EZB, ihre Entscheidungsgremien und die Organisation der Geldpolitik werden dargestellt.
Das achte Kapitel behandelt den Europäischen Rechnungshof, der für die Kontrolle der Finanzverwaltung der EU zuständig ist. Die Aufgaben des Rechnungshofes und die Organisation der Finanzkontrolle werden erläutert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der institutionellen Architektur der Europäischen Union, den Organen und Institutionen der EU, ihren Aufgaben, Befugnissen und Entscheidungsstrukturen. Wichtige Themen sind die Prinzipien der begrenzten Einzelermächtigung und der Organkompetenz, die Gesetzgebungs- und Haushaltsbefugnisse des Europäischen Parlaments, die Exekutivfunktion der Europäischen Kommission, die Leitungsrolle des Europäischen Rates sowie die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Wahrung des EU-Rechts.
Häufig gestellte Fragen
Welche sind die wichtigsten Organe der EU?
Dazu gehören das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat (der EU), die Europäische Kommission, der Gerichtshof der EU, die EZB und der Rechnungshof.
Was ist der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung?
Die EU darf nur in den Bereichen tätig werden, in denen die Mitgliedstaaten ihr durch Verträge ausdrücklich Kompetenzen übertragen haben.
Welche Funktion hat die Europäische Kommission?
Sie ist das Exekutivorgan der EU, hat das alleinige Initiativrecht für Gesetzgebungsvorschläge und überwacht die Einhaltung der Verträge ("Hüterin der Verträge").
Was unterscheidet den Europäischen Rat vom Rat der EU?
Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs und gibt politische Leitlinien vor. Der Rat (Ministerrat) ist zusammen mit dem Parlament Gesetzgeber.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH)?
Der EuGH sorgt für die einheitliche Auslegung und Anwendung des EU-Rechts in allen Mitgliedstaaten.
- Quote paper
- Sebastian Lindinger (Author), 2012, Die institutionelle Architektur der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266429