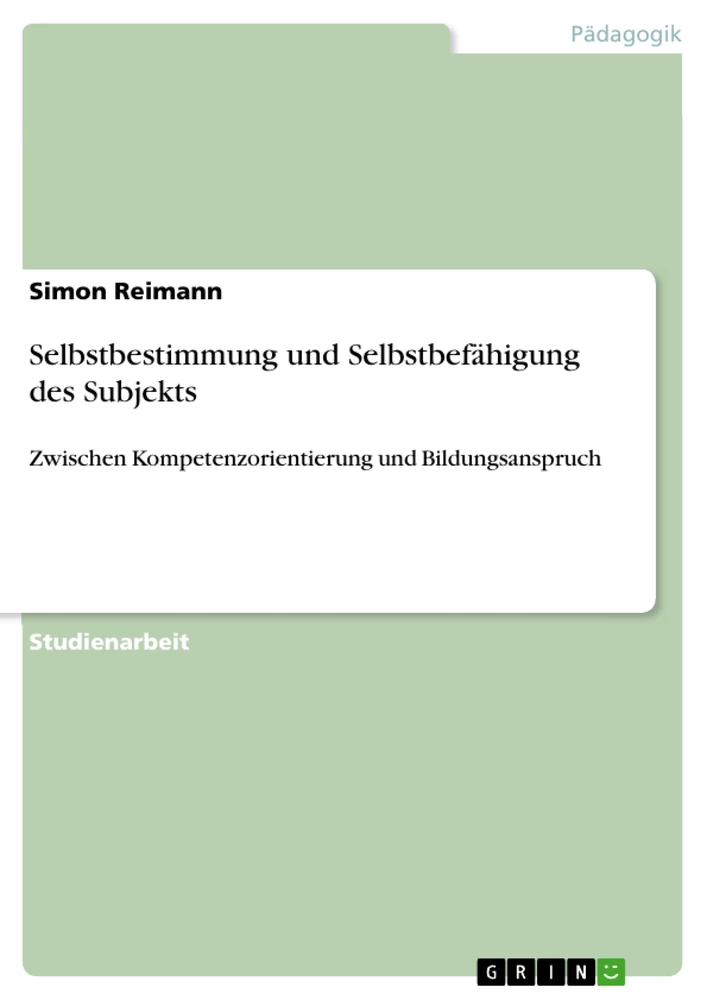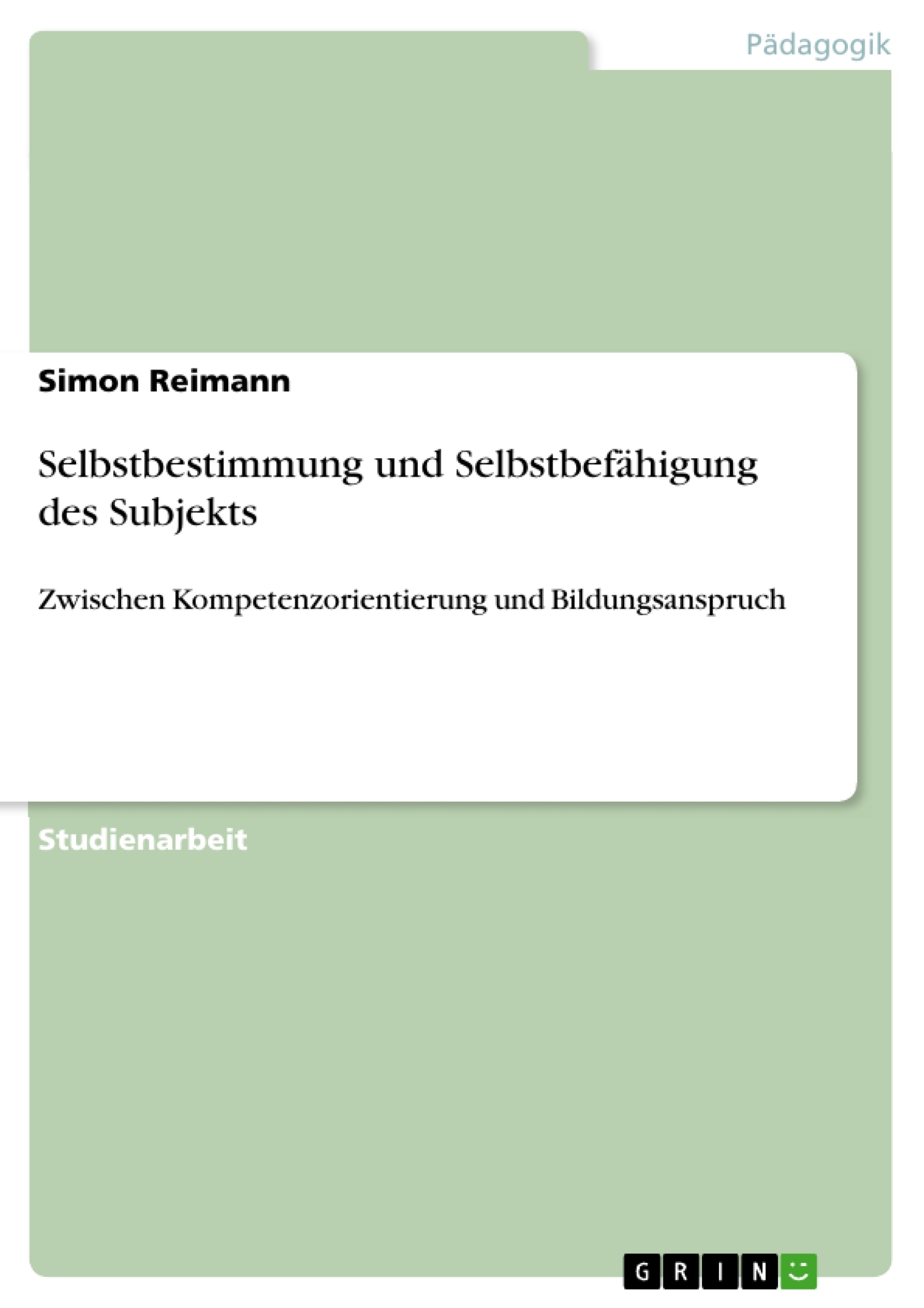Im Verlauf der vorliegenden Arbeit soll auf die Problematik der Kompetenzorientierung in Bildungsdebatte und Schulreform eingegangen werden. Hierbei steht das Subjekt im Mittelpunkt: Wie steht es um Selbstbestimmung und Selbstbefähigung des Subjektes? Welchen neuen Forderungen und Anforderungen muss es sich stellen, was ist die Neuerung in der Sichtweise, mit der es während seiner Zeit im Bildungssystem betrachtet wird? Um dies zu klären, wird zunächst auf die Herkunft des Kompetenzbegriffs und seine Wurzeln in der PISA-Debatte eingegangen, um anschließend die ideellen Wurzeln des Bildungssystems im Bildungsgedanken aufzurufen. Darauf beruhend wird auf die Einwände gegen die Umorientierung zur Kompetenzorientierung eingegangen.
Weiterhin kann in beiden Fällen festgestellt werden, dass die Umsetzung der Grundidee in der praktischen Ausgestaltung oftmals ihre eigenen Ansprüche verfehlte. Im Fall des Bildungsgedankens wurde ein Bildungssystem geschaffen, welches sich auf einen Bildungskanon einigte, dessen umfassende Kenntnis dann mit Bildung verwechselt werden konnte. Im Fall der Kompetenzorientierung wich man vom Gedanken der Mindeststandards ab und erließ im Rahmen der Umsetzung viele Bestimmungen, welche nicht nur dem Klieme- Gutachten zuwider handeln, sondern auch die Grundidee zu konterkarieren drohen. Auf diese Abseiten und Probleme der Debatte soll ebenfalls eingegangen werden, um am Ende zu fragen, ob der Graben zwischen den Positionen notwendigerweise die heutige Tiefe erreicht hat, oder ob diese nicht auch durch Art und Weise der Diskussion und des bildungspolitischen Vorgehens geschaffen wurde. Deshalb soll im letzten Teil gefragt werden, ob sich dem Kompetenzbegriff nicht auch aus Sicht des Bildungsgedankens etwas abgewinnen lässt, zumal eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff aufgrund geschaffener Fakten unvermeidlich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der PISA-Schock. Wie kam der Kompetenzbegriff in die Bildungsdebatte, und was sind die zentralen Forderungen und Neuerungen?
- Die Subjektwerdung als Ziel der Bildung und die Gegenstimmen zur Kompetenzorientierung
- Kompetenzorientierung und Partizipation - wie der Kompetenzbegriff zur Subjektwerdung beitragen kann
- Schluss
- Quellen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich kritisch mit der Kompetenzorientierung im deutschen Bildungssystem, insbesondere im Kontext der PISA-Debatte und der Bildungsreform. Der Fokus liegt auf der Frage, wie der Kompetenzbegriff die Selbstbestimmung und Selbstbefähigung des Subjekts im Bildungsprozess beeinflusst. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des Kompetenzbegriffs und seine Wurzeln in der PISA-Debatte, analysiert die ideellen Wurzeln des Bildungssystems und geht auf Einwände gegen die Kompetenzorientierung ein.
- Die Entstehung des Kompetenzbegriffs im Kontext der PISA-Debatte
- Die ideellen Wurzeln des Bildungssystems und der Bildungsgedanke
- Kritik an der Kompetenzorientierung und der Bildungsreform
- Die Rolle der Subjektwerdung im Bildungsprozess
- Die Bedeutung von Partizipation und selbstbestimmtem Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der Kompetenzorientierung in der Bildungsdebatte und Schulreform vor und lenkt den Fokus auf die Frage der Selbstbestimmung und Selbstbefähigung des Subjekts.
- Der PISA-Schock: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Kompetenzbegriffs im Kontext der PISA-Debatte und analysiert die zentralen Forderungen und Neuerungen, die aus dieser Debatte resultierten. Es wird auf die ökonomische Logik hingewiesen, die zunehmend die Bildungsdiskussion prägt.
- Die Subjektwerdung als Ziel der Bildung und die Gegenstimmen zur Kompetenzorientierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik an der Kompetenzorientierung aus der Perspektive des Bildungsgedankens. Es wird auf die Gefahr der Verengung des Bildungsprozesses auf die Produktion von Humankapital für den Arbeitsmarkt hingewiesen.
- Kompetenzorientierung und Partizipation - wie der Kompetenzbegriff zur Subjektwerdung beitragen kann: Dieses Kapitel untersucht die Möglichkeiten, wie der Kompetenzbegriff zur Selbstbestimmung und Selbstbefähigung des Subjekts beitragen kann. Es wird die Bedeutung von Partizipation und selbstbestimmtem Lernen für die Bildung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Kompetenzbegriff, die Bildungsreform, die PISA-Debatte, die Subjektwerdung, den Bildungsgedanken, die Selbstbestimmung, die Selbstbefähigung, die Partizipation, die Kompetenzorientierung, die Kritik an der Kompetenzorientierung, die ökonomische Logik, die Bildungsrendite, das Humankapital, der Bildungskanon, die Standardisierung, die Individualisierung, die Outputorientierung, die Inputorientierung, die Mindeststandards, die empirische Evaluation, die Unterrichtsmethoden, die Lernwege, die Freiheit des Subjekts, die gesellschaftliche Partizipation und die Selbstbildung.
Häufig gestellte Fragen
Wie kam der Kompetenzbegriff in die deutsche Bildungsdebatte?
Der Begriff gewann durch den sogenannten „PISA-Schock“ an Bedeutung, als man begann, Bildungsergebnisse international vergleichbar und messbar zu machen.
Was ist das Ziel der Subjektwerdung in der Bildung?
Ziel ist die Selbstbestimmung und Selbstbefähigung des Individuums, damit es als freies Subjekt an der Gesellschaft teilhaben kann.
Welche Kritik gibt es an der Kompetenzorientierung?
Kritiker befürchten eine ökonomische Logik in der Bildung, die den Menschen nur noch als „Humankapital“ für den Arbeitsmarkt betrachtet und den klassischen Bildungsgedanken verdrängt.
Kann Kompetenzorientierung auch zur Subjektwerdung beitragen?
Ja, wenn sie als Befähigung zur Partizipation und zum selbstbestimmten Lernen verstanden wird, anstatt nur Mindeststandards abzuprüfen.
Was ist das Problem bei der praktischen Umsetzung von Bildungsreformen?
Oftmals konterkarieren starre Bestimmungen die Grundidee der individuellen Förderung, was zu einer rein outputorientierten Standardisierung führt.
- Quote paper
- M. A. Simon Reimann (Author), 2012, Selbstbestimmung und Selbstbefähigung des Subjekts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266506