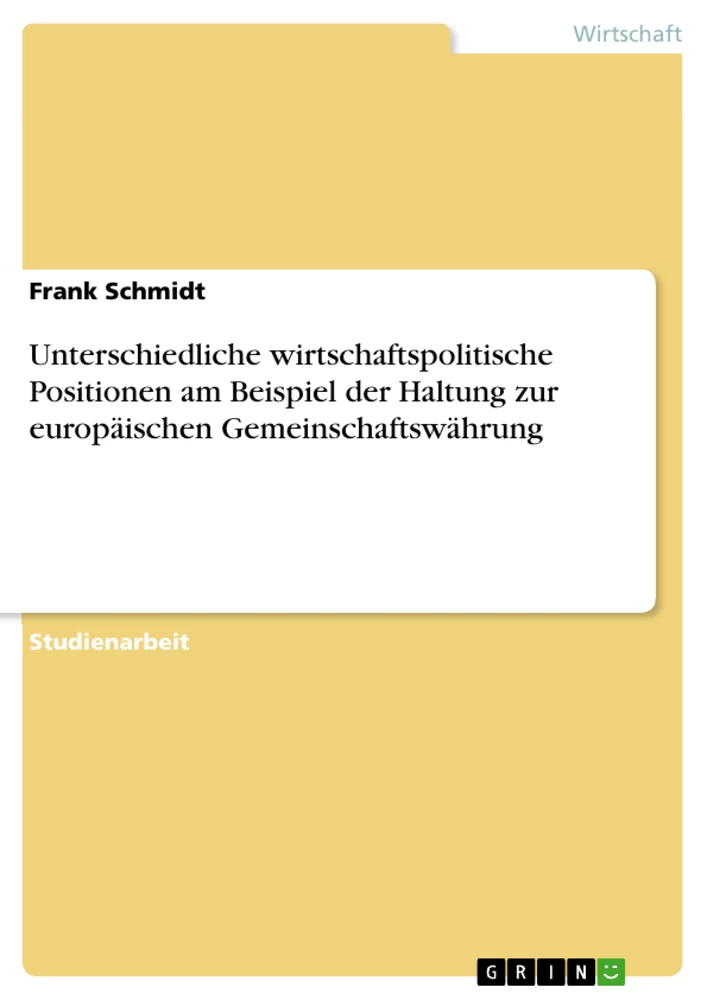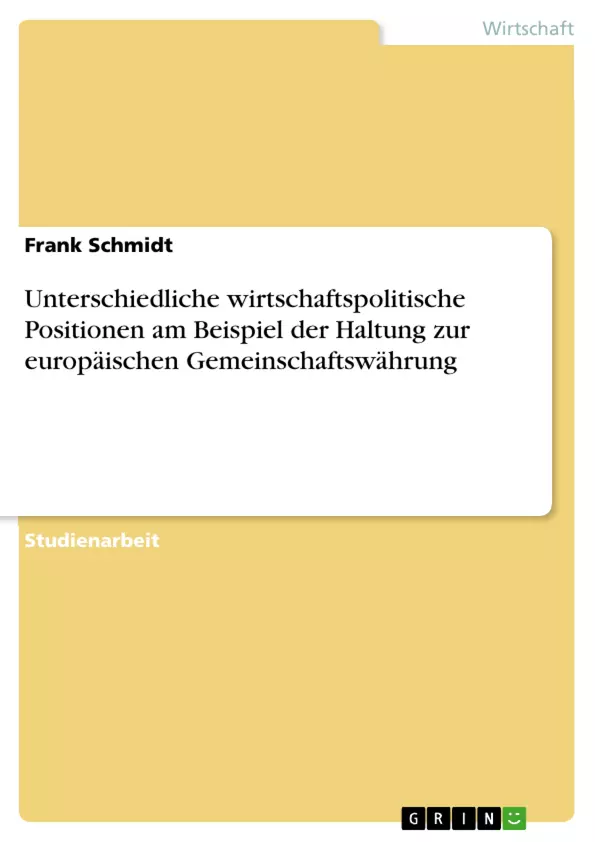In der öffentlichen Diskussion ist die Beurteilung der gemeinsamen europäischen Währungspolitik in erster Linie politisch besetzt. Eine positive, skeptische oder ablehnende Haltung zur europäischen Gemeinschaftswährung wird gleichgesetzt mit einer grundsätzlichen Haltung zur Idee der europäischen Gemeinschaft. Diese Arbeit baut dagegen auf der Hypothese auf, dass die Frage nach dem ob und dem wie einer europäischen Gemeinschaftswährung zunächst einmal auch das Ergebnis ökonomischer Überlegungen sein kann, welche wiederum auf bestimmten ökonomischen Grundannahmen aufbauen.
Wo sind die Ursachen für die unterschiedlichen Positionen zur europäischen Gemeinschaftswährung? Welcher Zusammenhang besteht zwischen wirtschafts-politischen Überzeugungen und konkreten Positionen in geldpolitischen Tagesfragen? Gibt es trotz aller unterschiedlichen Auffassungen einen „gemeinsamen Nenner“ der Beteiligten?
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt durch die Analyse und Einordnung der Positionen von Politik und Ökonomie in die Schulen des ökonomischen Denkens an den konkreten Beispielen
So wird deutlich, dass die Frage nach der europäischen Geldpolitik in erster Linie die Frage nach den unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Positionen ist und nur in Aus- nahmefällen unmittelbar politisch motiviert ist. Im Rahmen dieser Analyse werden auch die besonderen Merkmale und Axiome der jeweiligen wirtschaftspolitischen Handlungsprinzipien aufgezeigt.
Trotz aller Unterschiede, die bis hin zu erbitterten Gegnerschaften zwischen den Reprä- sentanten der einzelnen Positionen führen, besteht Einigkeit in der Feststellung des Ausgangs-Problems: die europäische Gemeinschaftswährung ist einem politischen Trilemma ausgeliefert. Die jeweiligen Lösungsmodelle basieren auf den isolierten Bedingungen der ihnen zugrunde liegenden Modelle und sind damit nur bedingt alltagstauglich, soweit ein gemeinsamer Konsens über die Lösungswege innerhalb der europäischen Währungsunion erzielt werden muss.
Die Lösung dieses Trilemmas gleicht damit einer „Quadratur des Kreises“, die immer ein wenig, immer an einer bestimmten Stelle - aber nie vollständig gelingt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung — Die europäische Gemeinschaftswährung als politisches Trilemma
- Hauptteil — Wirtschaftpolitisches Denken und daraus abgeleitete Positionen
- Wirtschaftspolitische Konzeptionen am Beispiel der Geldpolitik
- Klassische Nationalökonomie
- Grundannahme
- Geldpolitische Konsequenz
- Neoklassik
- Grundannahmen
- Geldpolitische Konsequenz
- Keynesianismus
- Grundannahme
- Geldpolitische Konsequenz
- Monetarismus
- Grundannahme
- Geldpolitische Konsequenz
- Österreichische Schule
- Grundannahme
- Geldpolitische Konsequenz
- Ordoliberalismus
- Grundannahme
- Geldpolitische Konsequenz
- Klassische Nationalökonomie
- Differenzierte Bewertung der europäischen Gemeinschaftswährung am Beispiel der Haltung zur Geldmengenpolitik der EZB und zum ESM
- Bundesregierung 1987 - 1991 / Kabinett Kohl III
- Geldpolitische Leitentscheidungen
- Erkennbare wirtschaftspolitische Ausrichtung
- Bundesregierung seit 2009 / Kabinett Merkel II
- Geldpolitische Leitentscheidungen
- Erkennbare wirtschaftspolitische Ausrichtung
- Euro-Rebellen in der FDP im 17. Deutschen Bundestag
- Geldpolitische Leitentscheidungen
- Erkennbare wirtschaftspolitische Ausrichtung
- AfD
- Geldpolitische Leitentscheidungen
- Erkennbare wirtschaftspolitische Ausrichtung
- Otmar Issing, ehemaliger Chefvolkswirt der EZB
- Geldpolitische Leitentscheidungen
- Erkennbare wirtschaftspolitische Ausrichtung
- Bundesregierung 1987 - 1991 / Kabinett Kohl III
- Schluss — Wirtschaftspolitik als Ausgleichs-Instrument im Spannungsfeld von politischem Wollen und praktischer Realisierbarkeit
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Positionen zur europäischen Gemeinschaftswährung, insbesondere hinsichtlich der Geldpolitik. Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen wirtschaftspolitischen Überzeugungen und konkreten Positionen in geldpolitischen Tagesfragen zu untersuchen und den Einfluss verschiedener ökonomischer Schulen auf die Beurteilung der europäischen Währungsunion aufzuzeigen.
- Die Rolle der Geldpolitik in der europäischen Gemeinschaftswährung
- Die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Konzeptionen (klassische Nationalökonomie, Neoklassik, Keynesianismus, Monetarismus, Österreichische Schule, Ordoliberalismus)
- Die Analyse von konkreten Positionen zur europäischen Gemeinschaftswährung (Bundesregierung, FDP, AfD, Otmar Issing)
- Die Herausforderungen der europäischen Währungsunion im Kontext der Staatsverschuldungskrise
- Die Bedeutung des politischen Trilemmas für die europäische Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die europäische Gemeinschaftswährung als ein politisches Trilemma dar, welches durch die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Positionen der Akteure geprägt ist.
Im Hauptteil werden die wichtigsten ökonomischen Schulen und ihre wirtschaftspolitischen Konzeptionen vorgestellt, wobei der Fokus auf die Geldpolitik liegt. Es werden die Grundannahmen und geldpolitischen Konsequenzen der klassischen Nationalökonomie, der Neoklassik, des Keynesianismus, des Monetarismus, der Österreichischen Schule und des Ordoliberalismus beleuchtet.
Im zweiten Teil werden die Positionen zu Geldmengenpolitik der EZB und zum ESM anhand von Beispielen aus der Politik und Ökonomie analysiert. Hierbei werden die wirtschaftspolitische Ausrichtung der Bundesregierung zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Euro, der aktuellen Bundesregierung, der „Euro-Rebellen" in der FDP, der AfD sowie des ehemaligen Präsidenten der EZB, Otmar Issing, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäische Gemeinschaftswährung, wirtschaftspolitische Positionen, Geldpolitik, EZB, ESM, Staatsverschuldungskrise, klassisches Wirtschaftsdenken, Neoklassik, Keynesianismus, Monetarismus, Österreichische Schule, Ordoliberalismus, politisches Trilemma, Wirtschaftspolitik, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Konvergenzkriterien, Euro-Krise, ordnungspolitische Maßnahmen, konjunkturpolitische Steuerungsmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Welche ökonomischen Schulen beeinflussen die Haltung zum Euro?
Wichtige Schulen sind der Keynesianismus, der Monetarismus, der Ordoliberalismus und die Österreichische Schule. Jede hat unterschiedliche Ansichten zu Geldmengenpolitik und Staatsinterventionen.
Was ist das „politische Trilemma“ der Gemeinschaftswährung?
Es beschreibt den Konflikt zwischen nationaler Souveränität, demokratischer Legitimation und der Notwendigkeit einer zentralen Geldpolitik in einer Währungsunion.
Wie unterscheidet sich die Geldpolitik der EZB nach monetaristischer Sicht?
Der Monetarismus betont die Kontrolle der Geldmenge zur Inflationsvermeidung und lehnt kurzfristige konjunkturpolitische Eingriffe weitgehend ab.
Was kritisiert die AfD an der europäischen Geldpolitik?
Die Kritik richtet sich oft gegen Rettungsschirme wie den ESM und die Niedrigzinspolitik der EZB, was meist auf ordoliberalen oder schuldentheoretischen Argumenten basiert.
Wer war Otmar Issing und welche Position vertritt er?
Otmar Issing war Chefvolkswirt der EZB. Er gilt als Verfechter einer stabilitätsorientierten Geldpolitik und mahnt die Einhaltung der Konvergenzkriterien strikt an.
- Wirtschaftspolitische Konzeptionen am Beispiel der Geldpolitik
- Quote paper
- Frank Schmidt (Author), 2013, Unterschiedliche wirtschaftspolitische Positionen am Beispiel der Haltung zur europäischen Gemeinschaftswährung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266534