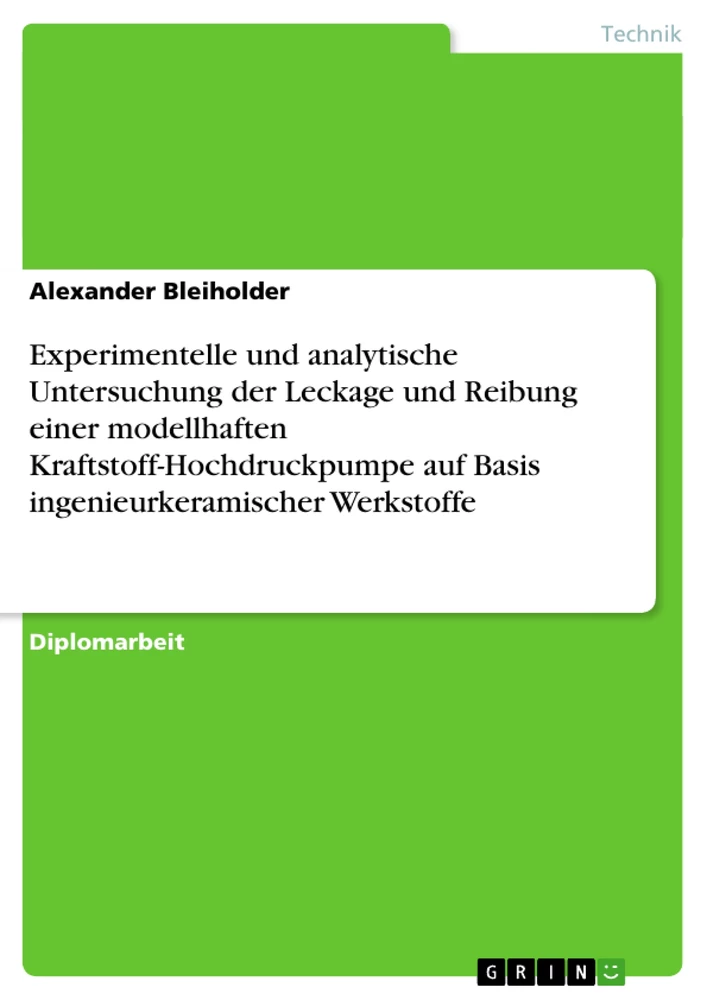[...] Neben der z.B. variablen Ventilsteuerung wird in modernen Ottomotoren die Technik der Benzindirekteinspritzung (BDE) immer mehr eingesetzt. Da der Teillastbetrieb beim BDE-Motor mit Ladungsschichtung erfolgt, kann der Motor ohne Drosselklappe und die damit verbundenen Verluste betrieben werden. So kann der Kraftstoffverbrauch, sowie der Schadstoff- und CO2-Ausstoß reduziert werden. Der Einspritzdruck bei BDE-Motoren muss jedoch weiter erheblich erhöht werden (momentan bei max. 120 bar), da im Vergleich zur Verdampfung des Kraftstoffs in einem herkömmlichen
Saugrohr-Einspritzmotor wesentlich weniger Zeit bei der Gemischbildung zur Verfügung steht. Damit führt eine Druckerhöhung zu einer besseren Gemischbildung, womit eine Wirkungsgradsteigerung des Motorprozesses erreicht wird (Abb. 1.0.2). Beim strahlgeführten
Brennverfahren muss der Einspritzdruck stark angehoben werden, da eine Benetzung der Zündkerze mit flüssigem Kraftstoff zu starker Korrosion, Thermoschockermüdung und zur Bildung von Ablagerungen führt und damit eine negative Beeinflussung der Verbrennung darstellt. Ebenso führt ein hoher Anteil an flüssigem Kraftstoff zu einer starken Rußemission. Die Entwicklung einer Hochdruckeinspritzpumpe für die Benzindirekteinspritzung ist somit unumgänglich, um den oben genannten Anforderungen gerecht zu werden. In der Dieseltechnologie ist die Direkteinspritzung bereits Standard und hat sich sowohl im Prinzip, wie auch im Design der einzelnen Elemente bewährt. Hierbei werden Einspritzdrücke bis zu 2000 bar realisiert. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften von Diesel gegenüber
Benzin können die Komponenten jedoch nicht einfach übernommen werden. Die schlechten Schmiereigenschaften von Benzin, bzw. dessen geringere Viskosität und die Adhäsions-Neigung von metallischen Werkstoffen, führen bei einer Erhöhung des Einspritzdrucks bei heutigen Benzineinspritzpumpen zu hohem Verschleiß und schlussendlich zum Ausfall der Pumpe. Die Druckerhöhung auf mindestens 300 bar soll durch den Einsatz ingenieurkeramischer Werkstoffe realisiert werden. Keramische Werkstoffe zeichnen sich vor allem durch eine höhere Härte, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturfestigkeit, sowie geringere Dichte und thermische Ausdehnung gegenüber den metallischen Werkstoffen aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Werkstoffe
- 2.1.1 Technische Keramiken
- 2.1.1.1 Aluminiumoxid (Al2O3)
- 2.1.1.2 Siliziumkarbid (SiC)
- 2.1.2 Vergleich Keramik - Stahl
- 2.1.1 Technische Keramiken
- 2.2 Pumpen
- 2.2.1 Hubkolbenpumpen
- 2.2.2 Umlaufkolbenpumpen
- 2.2.3 Kreiselradpumpen
- 2.2.4 Pumpenkennlinien
- 2.3 Digitale Signalverarbeitung (DSV)
- 2.3.1 Fourier-Reihe und Fourier-Transformation
- 2.3.1.1 Fourier-Reihe
- 2.3.1.2 Fourier-Transformation
- 2.3.1.3 Die z-Transformation
- 2.3.2 Digitalfilter
- 2.3.2.1 FIR-Filter
- 2.3.2.2 IIR-Filter
- 2.3.1 Fourier-Reihe und Fourier-Transformation
- 2.4 Strömungsmechanik
- 2.4.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik
- 2.4.1.1 Kontinuitätsgleichung
- 2.4.1.2 Impulsgleichungen
- 2.4.1.3 Energiegleichung
- 2.4.2 Turbulente Strömungen
- 2.4.3 Numerische Lösungsmethoden
- 2.4.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik
- 2.1 Werkstoffe
- 3 Prüfstand und Messtechnik
- 3.1 Prüfstand und Versuchsdurchführung
- 3.2 Messtechnik
- 4 Messergebnisse Teil A - Reibung und Verschleiß
- 4.1 Kolbenkinematik
- 4.2 Messergebnisse bei höheren Drehzahlen
- 4.3 Zylinderdruck und reibungsrelevante Kräfte
- 4.4 Reibungszahl und Verschleiß
- 4.5 Messergebnisse Stahlreferenzwerkstoff
- 5 Messergebnisse Teil B - Leckage im Kolben-Zylinder-Ringspalt
- 5.1 Strömungen in Spalten
- 5.1.1 Spaltströmung in modellhafter Hochdruckpumpe
- 5.1.1.1 Spalthöhenänderung in Folge des Kolbenkippens
- 5.1.1 Spaltströmung in modellhafter Hochdruckpumpe
- 5.2 Experimentelle und analytische Messergebnisse
- 5.1 Strömungen in Spalten
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- A MATLAB-Programm-Quellcodes
- A.1 ALF
- A.2 IIR-Butterworth-Tiefpass-Filter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht experimentell und analytisch die Leckage und Reibung einer modellhaften Kraftstoff-Hochdruckpumpe aus ingenieurkeramischen Werkstoffen. Ziel ist es, das Verhalten dieser Materialien unter Hochdruckbedingungen zu analysieren und Vergleichsdaten zu konventionellen Stahlwerkstoffen zu generieren.
- Vergleich der Reibungseigenschaften von Keramik und Stahl in einer Hochdruckpumpe.
- Analyse der Leckage im Kolben-Zylinder-Spalt unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
- Anwendung digitaler Signalverarbeitung zur Datenanalyse.
- Bewertung der Eignung von ingenieurkeramischen Werkstoffen für Hochdruckpumpen.
- Entwicklung und Validierung eines analytischen Modells zur Vorhersage von Leckage und Reibung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kraftstoff-Hochdruckpumpen und der Verwendung von ingenieurkeramischen Werkstoffen ein. Sie beschreibt die Motivation der Arbeit und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt die verwendeten Werkstoffe (Keramiken und Stahl), verschiedene Pumpentypen, die Prinzipien der digitalen Signalverarbeitung und die relevanten Aspekte der Strömungsmechanik. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich der Eigenschaften von Keramik und Stahl bezüglich Festigkeit, Verschleiß und Hochtemperaturbeständigkeit, sowie auf der Modellierung von Spaltströmungen. Die beschriebenen Methoden der Signalverarbeitung bilden die Basis für die Auswertung der experimentellen Daten.
3 Prüfstand und Messtechnik: Hier wird der speziell für diese Arbeit entwickelte Prüfstand detailliert beschrieben, inklusive der Messtechnik zur Erfassung von Druck, Kraft, Drehzahl und Temperatur. Die beschriebenen Methoden zur Kraft- und Leckagemessung gewährleisten die Genauigkeit der gewonnenen Daten. Der Aufbau des Prüfstandes und die Wahl der Messgeräte sind essentiell für die Aussagekraft der Ergebnisse.
4 Messergebnisse Teil A - Reibung und Verschleiß: Dieses Kapitel präsentiert die experimentellen Ergebnisse bezüglich Reibung und Verschleiß des Kolben-Zylinder-Systems. Die Ergebnisse werden in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie Drehzahl und Last dargestellt und analysiert. Die Kolbenkinematik wird untersucht, um Reibungseffekte besser zu verstehen. Ein Vergleich mit Stahl als Referenzwerkstoff wird durchgeführt. Die Datenanalyse wird unter Berücksichtigung der im Kapitel 2 beschriebenen Methoden durchgeführt.
5 Messergebnisse Teil B - Leckage im Kolben-Zylinder-Ringspalt: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die experimentellen Ergebnisse zur Leckage. Es werden die Strömungsverhältnisse im Kolben-Zylinder-Spalt untersucht, unter Berücksichtigung von Spalthöhenänderungen aufgrund von Kolbenkippen. Die experimentellen Ergebnisse werden mit analytischen Berechnungen verglichen, um das Modell zu validieren. Die detaillierte Beschreibung der Spaltströmung und deren Modellierung sind zentral für dieses Kapitel.
Schlüsselwörter
Hochdruckpumpe, Ingenieurkeramik, Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Stahl, Reibung, Leckage, Digitale Signalverarbeitung, Strömungsmechanik, Spaltströmung, Experimentelle Untersuchung, Analytisches Modell, Vergleichsstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Experimentelle und Analytische Untersuchung der Leckage und Reibung einer Modellhaften Kraftstoff-Hochdruckpumpe aus Ingenieurkeramischen Werkstoffen
Was ist das Thema dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht experimentell und analytisch die Leckage und Reibung einer modellhaften Kraftstoff-Hochdruckpumpe aus ingenieurkeramischen Werkstoffen. Im Fokus steht der Vergleich dieser Materialien mit konventionellen Stahlwerkstoffen unter Hochdruckbedingungen.
Welche Werkstoffe wurden untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Eigenschaften von Aluminiumoxid (Al2O3) und Siliziumkarbid (SiC) als ingenieurkeramische Werkstoffe mit Stahl. Die Unterschiede in Festigkeit, Verschleiß und Hochtemperaturbeständigkeit sind zentrale Vergleichskriterien.
Welche Pumpentypen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt verschiedene Pumpentypen, darunter Hubkolbenpumpen, Umlaufkolbenpumpen und Kreiselradpumpen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der modellhaften Hochdruckpumpe, die im experimentellen Teil verwendet wird.
Welche Messmethoden wurden eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt detailliert den eigens entwickelten Prüfstand und die eingesetzte Messtechnik. Gemessen wurden Druck, Kraft, Drehzahl und Temperatur. Die Messmethoden zur Kraft- und Leckagemessung gewährleisten die Genauigkeit der Ergebnisse.
Welche Rolle spielt die digitale Signalverarbeitung (DSV)?
Digitale Signalverarbeitung wird zur Analyse der experimentellen Daten verwendet. Die Arbeit beschreibt die Anwendung von Fourier-Transformationen und digitalen Filtern (FIR und IIR) zur Datenaufbereitung und -auswertung.
Welche Strömungsmechanischen Aspekte wurden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Grundgleichungen der Strömungsmechanik (Kontinuitäts-, Impuls- und Energiegleichung) sowie turbulente Strömungen und numerische Lösungsmethoden. Besonders relevant ist die Modellierung von Spaltströmungen im Kolben-Zylinder-System.
Wie wurden die Ergebnisse zur Reibung und zum Verschleiß dargestellt?
Die experimentellen Ergebnisse zu Reibung und Verschleiß werden in Abhängigkeit von Drehzahl und Last dargestellt und analysiert. Die Kolbenkinematik wird untersucht, um Reibungseffekte besser zu verstehen. Ein Vergleich mit Stahl als Referenzwerkstoff wird durchgeführt.
Wie wurden die Leckage-Ergebnisse analysiert?
Die Leckage-Ergebnisse konzentrieren sich auf die Strömungsverhältnisse im Kolben-Zylinder-Spalt, inklusive der Berücksichtigung von Spalthöhenänderungen aufgrund von Kolbenkippen. Experimentelle Ergebnisse werden mit analytischen Berechnungen verglichen, um das Modell zu validieren.
Gibt es ein analytisches Modell?
Ja, die Arbeit entwickelt und validiert ein analytisches Modell zur Vorhersage von Leckage und Reibung. Dieses Modell wird mit den experimentellen Ergebnissen verglichen.
Welche Software wurde verwendet?
Die Arbeit erwähnt die Verwendung von MATLAB, einschließlich Quellcodes für die Analyse (z.B. ALF und IIR-Butterworth-Tiefpass-Filter), die im Anhang zu finden sind.
Welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Die Schlussfolgerungen bewerten die Eignung von ingenieurkeramischen Werkstoffen für Hochdruckpumpen auf Basis der experimentellen und analytischen Ergebnisse. Ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten rundet die Arbeit ab.
- Quote paper
- Alexander Bleiholder (Author), 2004, Experimentelle und analytische Untersuchung der Leckage und Reibung einer modellhaften Kraftstoff-Hochdruckpumpe auf Basis ingenieurkeramischer Werkstoffe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26679