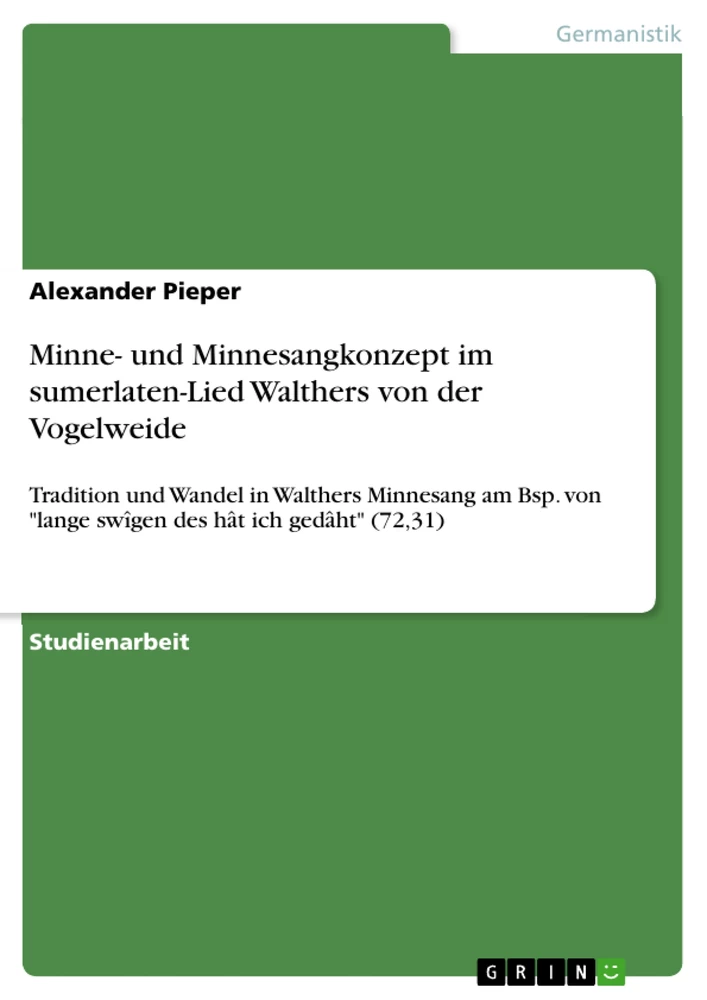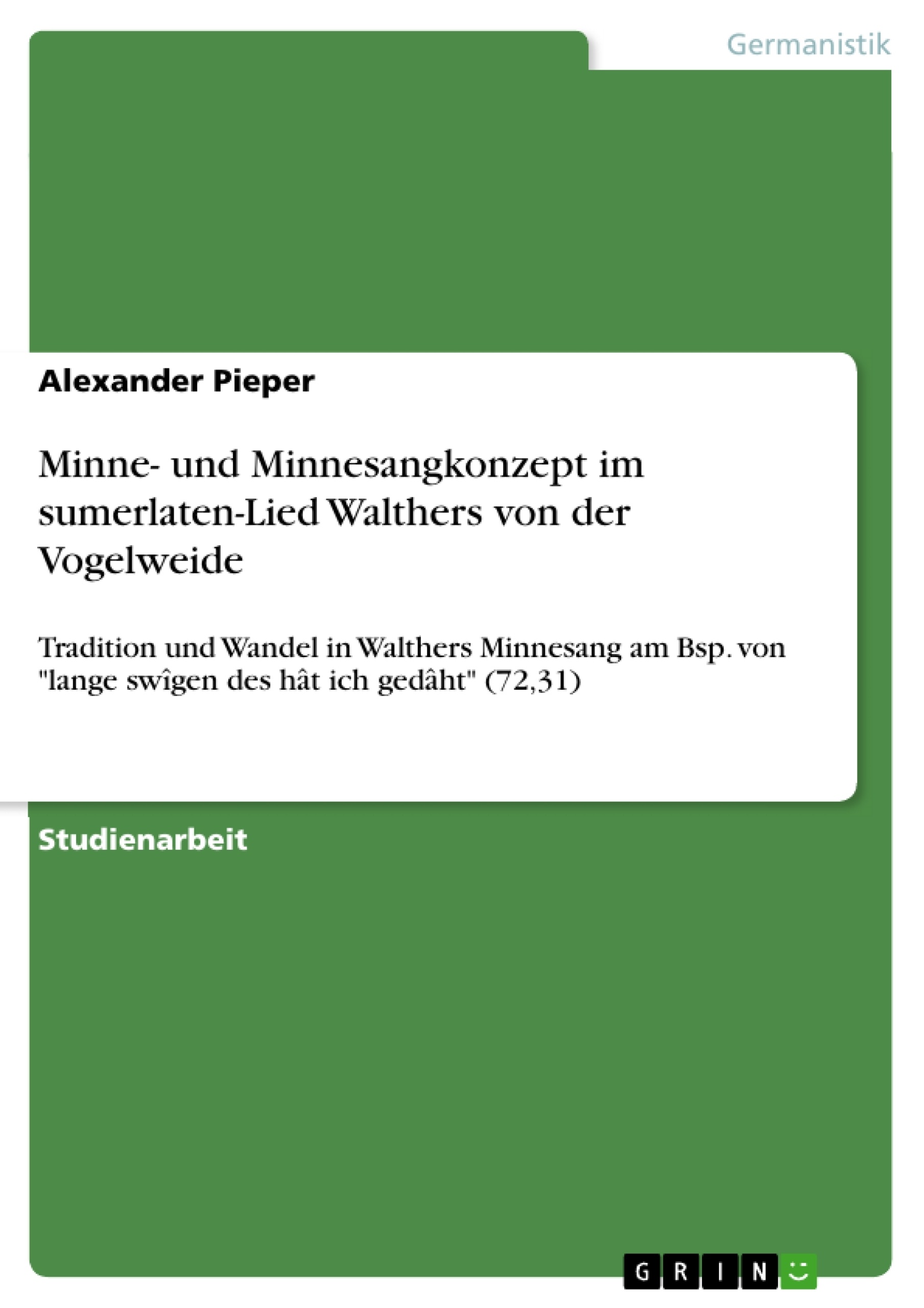In der vorliegenden Arbeit wird zunächst die Tradition des Minnesangs, auf die Walther trifft, vorgestellt. Vor dieser Folie wird dann das Besondere und zu Walthers Zeit Neue im sumerlaten-Lied transparent gemacht. Hierzu wird das Lied eingehend analysiert, wobei die Frage nach einem spezifischen Minnesangkonzept Walthers stets präsent bleibt.
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Textkritik
2 Die Tradition
2.1 Minnesang ist Rollenlyrik
2.2 Traditionelle Motive des hohen Minneliedes
2.3 Ein Beispiel
3 Das sumerlaten-Lied Walthers (72,31)
3.1 "swenne ich mîn singen lâze"
3.2 "swîgen oder singen alse ê?"
3.3.1 "swîgen"
3.3.2 "singen alse ê"
3.4 "rechet mich"
4 Schlußbetrachtungen
5 Literaturangaben
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textkritik
- Die Tradition
- Minnesang ist Rollenlyrik
- Traditionelle Motive des hohen Minneliedes
- Ein Beispiel
- Das summerlaten-Lied Walthers (72,31)
- swenne ich min singen läze
- swtgen oder singen alse é?
- swtgen
- singen alse é
- rechet mich
- Schlußbetrachtungen
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse des „summerlaten-Liedes" von Walther von der Vogelweide und untersucht, wie ein bestimmtes Minne- und Minnesangkonzept die Reflexionen und Überlegungen des Liedes prägt. Die Arbeit zielt darauf ab, dieses Konzept durch eine detaillierte Untersuchung des Liedes zu extrapolieren und in Zusammenhang mit den Reflexionen und Konsequenzen des Liedes zu setzen. Dadurch werden auch die Konsequenzen und Reflexionen als wesentlicher Bestandteil des Liedes eingehend untersucht.
- Die Rolle des Minnesängers in der Minnetradition
- Die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Sänger und Dame
- Die ethischen und moralischen Ansprüche an die Dame
- Die Bedeutung der höfischen Gesellschaft im Minnesangkonzept
- Die Kritik an traditionellen Minnekonzepten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Zielsetzung sowie die Methode der Untersuchung dar. Sie erläutert die Bedeutung des „summerlaten-Liedes" im Kontext von Walthers Minnesang und skizziert die Forschungsliteratur, die für diese Arbeit relevant ist.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Tradition des Minnesangs, die Walther in seinen Liedern fortsetzt. Es werden die wichtigsten Rollen, Motive und Inhalte des hohen Minneliedes vorgestellt und anhand eines Beispiels von Rudolf von Fenis-Neuenburg veranschaulicht. Dabei wird deutlich, dass der Minnesang eine stark schematisierte Form der Liebeslyrik ist, die von festen Rollen und Motiven geprägt ist.
Im dritten Kapitel wird das „summerlaten-Lied" Walthers im Detail analysiert. Es wird gezeigt, wie Walther die traditionellen Rollen und Motive des Minnesangs in Frage stellt und ein neues Minnekonzept entwickelt. Dieses Konzept basiert auf der Gegenseitigkeit und Unterscheidung zwischen „guot" und „nicht-guot" und stellt die traditionelle Abhängigkeitsstruktur zwischen Sänger und Dame auf den Kopf. Walther argumentiert, dass die Dame nicht mehr als unantastbares Idealbild des Sängers existiert, sondern ihre Rolle als Fiktion entlarvt wird.
Die Schlußbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewerten Walthers „summerlaten-Lied" als ein kritisches Werk, das traditionelle Minnekonzepte in Frage stellt und ein neues Verständnis von Minne und Minnesang etabliert. Die Arbeit zeigt, wie Walther mit seinem Lied die Rolle des Minnesängers in der höfischen Gesellschaft neu definiert und die Anforderungen an die Dame sowie die Gesellschaft selbst hinterfragt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Minne und Minnesang, das „summerlaten-Lied" von Walther von der Vogelweide, die Tradition des hohen Minneliedes, Rollenlyrik, ethische und moralische Ansprüche, Gegenseitigkeit, Unterscheidung, Abhängigkeitsverhältnis, höfische Gesellschaft, Kritik an traditionellen Minnekonzepten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Walthers „summerlaten-Lied“?
Walther stellt darin das traditionelle Minnekonzept in Frage und entwickelt eine neue Sichtweise, die auf Gegenseitigkeit und der Unterscheidung zwischen „guot“ und „nicht-guot“ basiert.
Was bedeutet „Minnesang ist Rollenlyrik“?
Es bedeutet, dass die Lieder nicht persönliche Gefühle ausdrücken, sondern festen literarischen Rollen (Sänger und Dame) und gesellschaftlichen Schemata folgen.
Wie kritisiert Walther die traditionelle „Hohe Minne“?
Er entlarvt die Rolle der Dame als Fiktion und bricht das einseitige Abhängigkeitsverhältnis auf, indem er ethische Forderungen an die Dame stellt.
Welche Bedeutung hat die „höfische Gesellschaft“ in Walthers Konzept?
Die Gesellschaft dient als Rahmen und Richter für den Minnesang; Walther nutzt seine Lieder, um die moralischen Ansprüche innerhalb dieser Gruppe neu zu definieren.
Was symbolisiert das Motiv des „Singen-Lassens“?
Es reflektiert die Entscheidung des Sängers, ob er die traditionelle Kunst fortsetzt oder aufgrund fehlender Erwiderung verstummt.
- Quote paper
- Alexander Pieper (Author), 1998, Minne- und Minnesangkonzept im sumerlaten-Lied Walthers von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266848