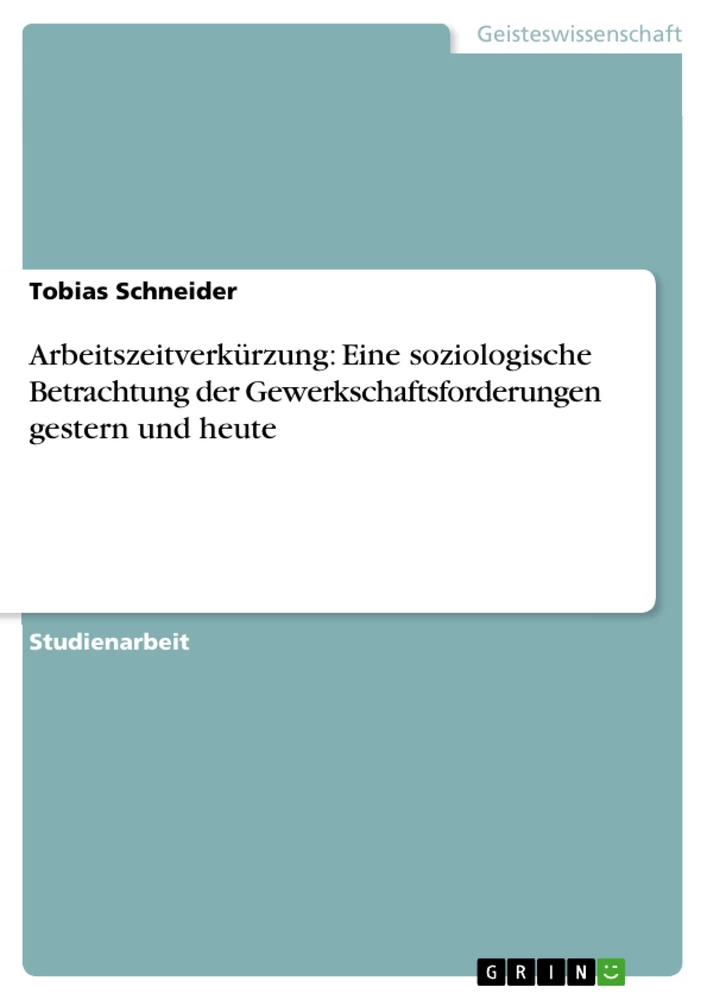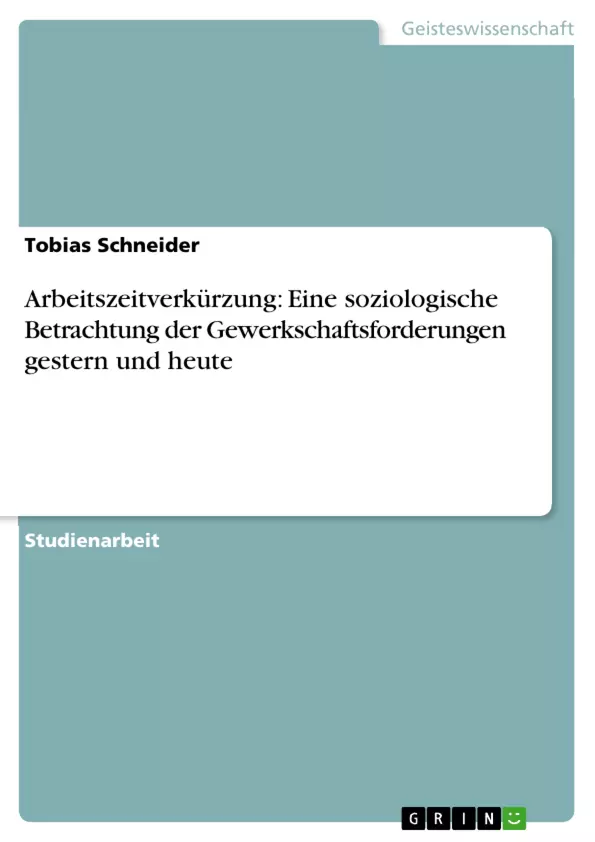Die im Jahre 1949 neugegründete Bundesrepublik Deutschland zeichnete sich in der Zeit des Wiederaufbaus bis zum Ende der 1950er Jahre mit anhaltend sinkenden Arbeitslosenzahlen aus. In der darauffolgenden Phase des Wirtschaftswunders bis ca. 1973 lag die Arbeitslosigkeit sogar unter 2%, sodass schon von Vollbeschäftigung und Arbeitskräftemangel, gesprochen wurde. So unerwartet schnell das ‚deutsche Wirtschaftswunder‘ die Bundesrepublik mit Wohlstand und Arbeit versorgte, kam auch genauso plötzlich 1973 die Ölpreiskrise, die eine gegenläufige Entwicklung mit sich brachte: Die schlagartig ansteigende Massenarbeitslosigkeit als Dauererscheinung. So stieg die Arbeitslosigkeit fast treppenförmig im Jahre 1975 auf über eine Million und ab 1983 auf über 2,2 Millionen Arbeitslose an. Dies hatte eine heftige Kontroverse in der Öffentlichkeit über mögliche Lösungsansätze zur Folge. So wurde vor allem auf Arbeitnehmerseite der historisch gehaltvolle Ruf nach Arbeitszeitverkürzung, bei teilweise bis vollem Lohnausgleich, lauter die Arbeitgebervertreter forderten hingegen überwiegend eine Lockerungen der Tarifverträge und die Senkung der Lohnstückkosten.
Im Folgenden soll besonders auf die Herkunft der Arbeit und das Bedürfnis des Arbeiters nach kürzeren Arbeitszeiten im geschichtlichen Kontext eingegangen werden. Hierbei wird vor allem auf die Gewerkschaften als wichtige Institution zur Erreichung dieser, aufmerksam gemacht. Schließlich betrachten wir besonders die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit ab den 1980er-Jahren und vergleichen diese mit der der jüngeren Arbeitszeitregulierung. Ziel der folgenden Hausarbeit ist es somit den tieferen Sinn der Arbeitszeitverkürzung und die tatsächliche Realisierung zu ergründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arbeit
- Arbeitszeit im geschichtlichen Kontext
- Arbeitszeit in der Vormoderne
- Arbeitszeit seit der Industrialisierung
- Die Gewerkschaften als Organisationsform der Lohnarbeiter
- Arbeitszeitverkürzung
- Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung zur Rückaneignung der Lebenszeit
- Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung zur Freisetzung neuer Arbeitsplätze
- Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung in den 1980er-Jahren
- Die Entwicklung der Arbeitszeit in der jüngeren Geschichte
- Arbeitszeitverlängerung seit 1990
- Die Krise der Gewerkschaften als Ursache für längere Arbeitszeiten
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Arbeitszeitverkürzung und deren Bedeutung im historischen Kontext. Sie untersucht die Entwicklung der Arbeitszeit von der Vormoderne bis zur Gegenwart und analysiert die Rolle der Gewerkschaften im Kampf für kürzere Arbeitszeiten. Dabei werden die verschiedenen Beweggründe und Ziele der Arbeitszeitverkürzung, wie die Rückaneignung der Lebenszeit und die Freisetzung neuer Arbeitsplätze, beleuchtet.
- Die Entwicklung der Arbeitszeit im historischen Kontext
- Die Rolle der Gewerkschaften im Kampf für Arbeitszeitverkürzung
- Die Bedeutung der Arbeitszeitverkürzung für die Lebensqualität und die Arbeitswelt
- Die Herausforderungen der Arbeitszeitverkürzung in der heutigen Zeit
- Die Folgen der Arbeitszeitverlängerung für Arbeitnehmer und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeitszeitverkürzung ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Arbeit definiert den Begriff der Arbeit und beleuchtet die Unterschiede zwischen dem klassischen Arbeitsbegriff und der kapitalistischen Lohnarbeit. Das Kapitel "Arbeitszeit im geschichtlichen Kontext" untersucht die Entwicklung der Arbeitszeit von der Vormoderne bis zur Industrialisierung. Es beleuchtet die Arbeitszeit in der vorindustriellen Gesellschaft, die an den natürlichen Gegebenheiten orientiert war, und die Veränderung der Arbeitszeit durch die Industrialisierung und die Einführung der mechanischen Uhr. Das Kapitel "Die Gewerkschaften als Organisationsform der Lohnarbeiter" analysiert die Rolle der Gewerkschaften als Interessenvertretung der Lohnarbeiter im Kampf für kürzere Arbeitszeiten. Es beleuchtet die Entstehung der Gewerkschaften und ihre Bedeutung im Kampf gegen die Ausbeutung der Arbeitskraft. Das Kapitel "Arbeitszeitverkürzung" beleuchtet die verschiedenen Beweggründe und Ziele der Arbeitszeitverkürzung. Es untersucht die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung zur Rückaneignung der Lebenszeit und die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung zur Freisetzung neuer Arbeitsplätze. Das Kapitel "Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung in den 1980er-Jahren" analysiert die Entwicklung der Arbeitszeitverkürzung in den 1980er Jahren im Kontext der Massenarbeitslosigkeit und der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Das Kapitel "Die Entwicklung der Arbeitszeit in der jüngeren Geschichte" untersucht die jüngeren Trends der Arbeitszeitentwicklung und analysiert die Ursachen der Arbeitszeitverlängerung seit 1990. Es beleuchtet die Rolle der Gewerkschaften in der heutigen Zeit und die Herausforderungen, die sich aus dem Strukturwandel und der Mitgliederkrise ergeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Arbeitszeitverkürzung, die Gewerkschaften, die Industrialisierung, die Lebenszeit, die Massenarbeitslosigkeit, die Produktivitätssteigerung, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Mitgliederkrise der Gewerkschaften. Der Text analysiert die historische Entwicklung der Arbeitszeit und die Rolle der Gewerkschaften im Kampf für kürzere Arbeitszeiten. Er beleuchtet die verschiedenen Beweggründe und Ziele der Arbeitszeitverkürzung, wie die Rückaneignung der Lebenszeit und die Freisetzung neuer Arbeitsplätze. Der Text untersucht auch die Herausforderungen der Arbeitszeitverkürzung in der heutigen Zeit, insbesondere die Folgen der Arbeitszeitverlängerung für Arbeitnehmer und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum forderten Gewerkschaften in den 1980ern die Arbeitszeitverkürzung?
Hauptziel war die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit durch die Umverteilung der vorhandenen Arbeit auf mehr Köpfe (Freisetzung neuer Arbeitsplätze).
Was bedeutet „Rückaneignung der Lebenszeit“?
Es beschreibt das Bedürfnis der Arbeiter, durch kürzere Arbeitszeiten mehr Zeit für Familie, Freizeit und die persönliche Entwicklung zurückzugewinnen.
Wie veränderte die Industrialisierung die Arbeitszeit?
Mit der Einführung der mechanischen Uhr und Fabrikarbeit wurde die Arbeitszeit von natürlichen Rhythmen entkoppelt und massiv ausgeweitet, was zur Entstehung der Gewerkschaften führte.
Warum kam es seit 1990 wieder zu Arbeitszeitverlängerungen?
Ursachen sind unter anderem die Krise der Gewerkschaften (Mitgliederschwund) sowie der Druck zur Flexibilisierung und Kostensenkung im globalen Wettbewerb.
Was ist der Unterschied zwischen Voll- und Teil-Lohnausgleich?
Beim vollen Lohnausgleich bleibt das Monatsgehalt trotz kürzerer Arbeitszeit gleich, was die Kaufkraft sichert, aber die Lohnstückkosten für Arbeitgeber erhöht.
- Arbeit zitieren
- Tobias Schneider (Autor:in), 2012, Arbeitszeitverkürzung: Eine soziologische Betrachtung der Gewerkschaftsforderungen gestern und heute, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266854