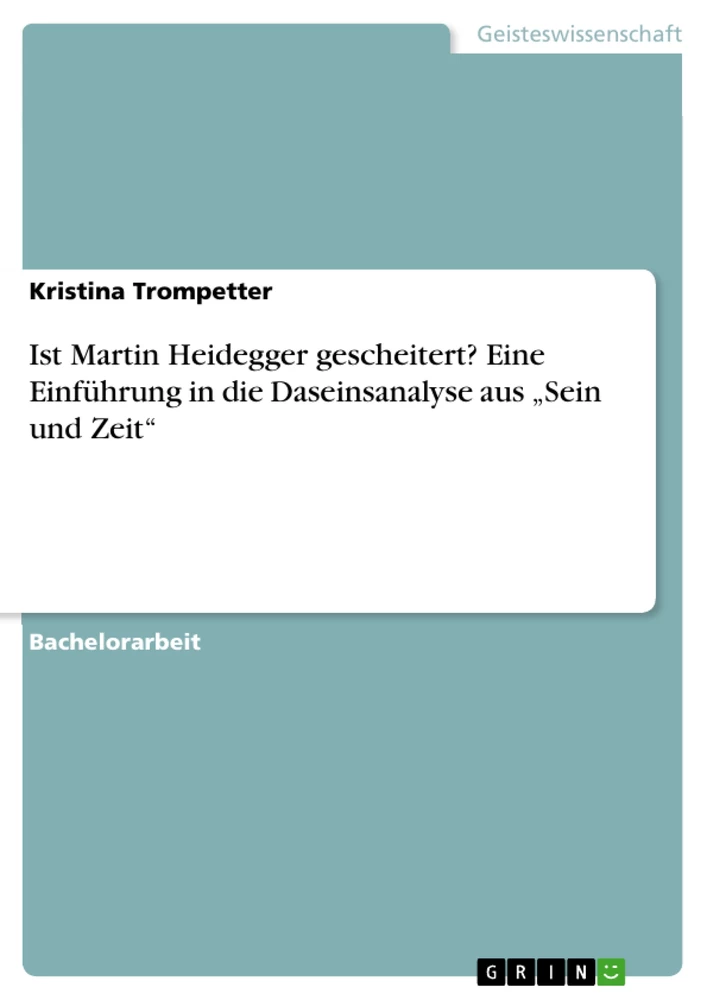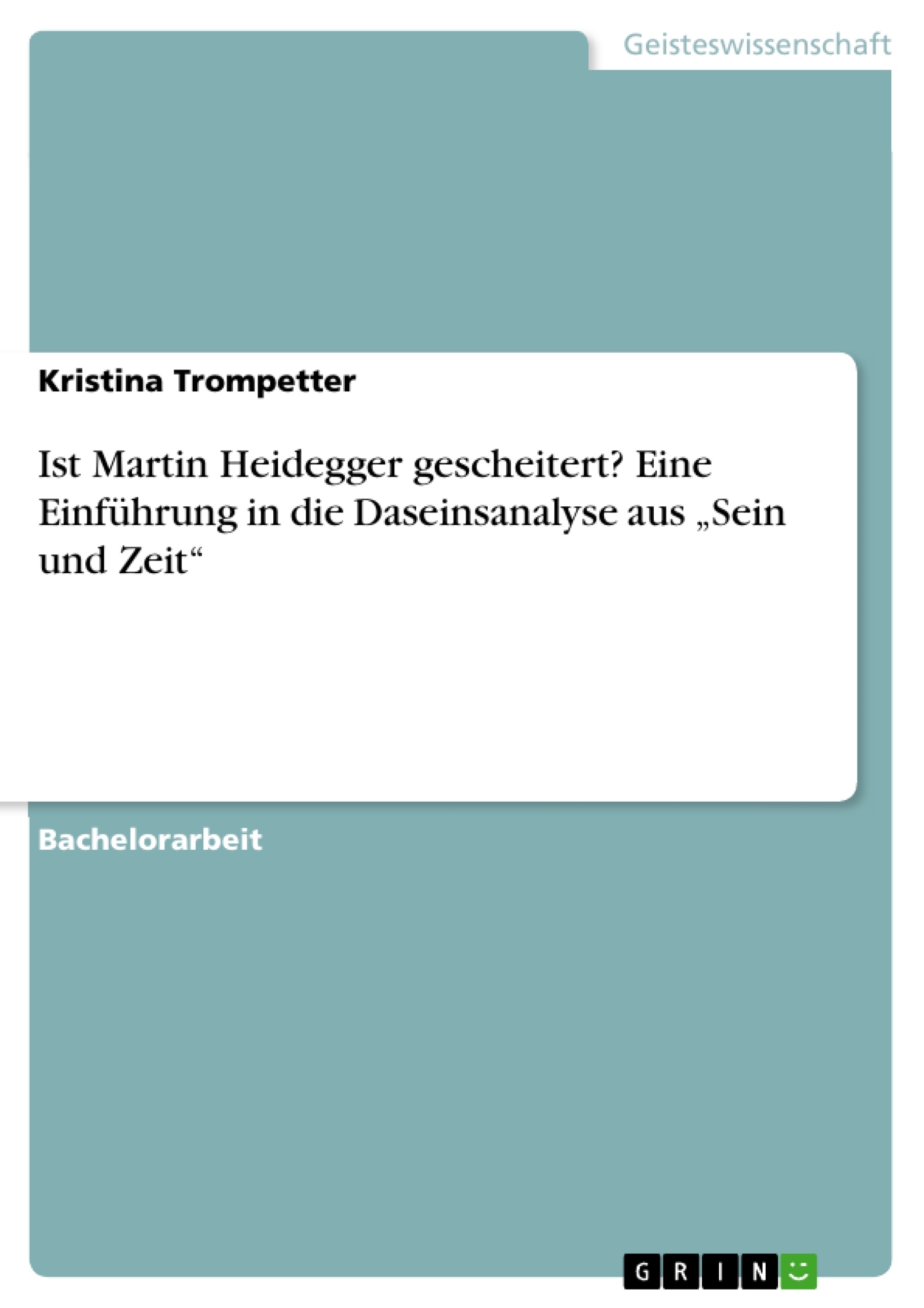„Die Undefinierbarkeit des Seins dispensiert nicht von der Frage nach seinem Sinn, sondern fordert dazu gerade auf “ (Heidegger 2006: 4).
Diese Worte Martin Heideggers führen unmittelbar in das Zentrum seines 1927 unter dem Titel „Sein und Zeit“ erschienenen Hauptwerks, welches sich im Nachgang dieser von der Seinsfrage ausgehenden Aufforderung versucht. Heidegger stellt die lange Zeit in Vergessenheit geratene Frage nach dem Sein erneut und berührt somit einen grundsätzlichen Bezugspunkt unseres Lebens. Dieser Bezug ist so eindeutig wie uneindeutig, sodass sich die Seinsfrage als klarste und auch dunkelste aller Fragen eröffnet, deren Durchleuchtung ein beachtliches Vorhaben darstellt – ein Vorhaben, das gescheitert ist?
SuZ blieb bekanntlich Fragment und im Zuge dessen stellt sich die pragmatische Frage danach, was die Beschäftigung mit einem Torso hervorbringen soll, dessen ursprüngliches und eigentliches Ziel niemals erreicht wurde. Möglicherweise besteht das Erbe einer solch unabgeschlossenen Analyse in den vorbereitenden Gedanken und bereits geleisteten Analyseschritten, sodass im ursprünglichen Rahmen des Gesamtvorhabens als Vorlauf bestimmte Erkenntnisse in den Fokus der Betrachtung rücken.
Im Kontext von SuZ richtet sich der Blick somit auf die umfassende sowie ausführliche Analyse des Daseins; eine Betrachtung des Menschen, die sich durch beachtliche Schärfe und Präzision, durch das beständige Fragen nach dem Dahinter auszeichnet. Diese dem Denken Martin Heideggers eigene „bohrende Qualität“ (Arendt 1969: 895) verleiht der Daseinsanalyse einen Status, der sie möglicherweise zu mehr als einer notwendigen vorbereitenden Betrachtung macht; der sie vielleicht sogar über die Grenzen der Philosophie hinaus relevant werden lässt.
Die Chance zu den Gedanken Heideggers durchzudringen und diese womöglich sogar in ihrer Bedeutung für eine Wissenschaft des Daseins, die Soziologie, sichtbar zu machen, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit vielmehr in einer strengen und zunächst textimmanenten Beschäftigung verankert. Wenn dies ernsthaft geschieht, so kann sie vorbereitendes Fundament einer externen Betrachtung sein, die ihren Boden somit auf einer philosophischen Erstanschauung begründet und daher womöglich weniger der Gefahr einer bloßen Auslegung der Daseinsanalyse als etwas unterliegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Notwendigkeit, Ziel und Methode
- 2.1 Seinsvergessenheit
- 2.2 Seinsfrage
- 2.3 Methode und Aufbau
- 3 Die Jemeinigkeit der Existenz
- 3.1 In-der-Welt-sein
- 3.1.1 Welt
- 3.1.2 In-Sein
- 3.2 Das Selbst
- 3.2.1 Der Modus der Uneigentlichkeit
- 3.2.2 Der Modus der Eigentlichkeit
- 3.3 Sorge und Zeitlichkeit
- 4 Schlussbemerkung: Die Frage nach dem Scheitern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen ersten verständlichen Einblick in Martin Heideggers Hauptwerk „Sein und Zeit“ (SuZ) und seine Konzeption des Menschen zu geben. Sie konzentriert sich auf eine textnahe Darstellung der Daseinsanalyse, ohne gesellschaftskritische, anthropologische oder moralische Interpretationen. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der zentralen Argumentationslinien und Konzepte.
- Die Seinsfrage und die Seinsvergessenheit
- Das Dasein als In-der-Welt-sein
- Die Unterscheidung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit
- Die Rolle von Sorge und Zeitlichkeit für das Dasein
- Die methodische Vorgehensweise Heideggers in SuZ
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das zentrale Thema von Heideggers „Sein und Zeit“ ein: die Frage nach dem Sein. Sie betont die Bedeutung dieser Frage für unser Leben und die Herausforderungen, die ihre Beantwortung mit sich bringt. Die Arbeit wird als Versuch einer verständlichen und verkürzten Darlegung der Daseinsanalyse vorgestellt, die einen ersten Einblick in Heideggers Konzeption des Menschen ermöglichen soll. Der Fokus liegt auf einer textnahen, philosophischen Interpretation, die als Grundlage für weiterführende Analysen dienen kann.
2 Notwendigkeit, Ziel und Methode: Dieses Kapitel beleuchtet den philosophisch-historischen Kontext, der Heidegger zur erneuten Fragestellung des Seins veranlasste. Es erläutert die Seinsfrage selbst und beschreibt den methodischen Aufbau und die Vorgehensweise in „Sein und Zeit“. Es bereitet den Boden für die folgende detaillierte Auseinandersetzung mit der Daseinsanalyse, indem es den Kontext und die methodischen Grundlagen etabliert. Die Analyse der Seinsvergessenheit wird als Ausgangspunkt für die Notwendigkeit der Seinsfrage dargestellt und die Methode der Daseinsanalyse als Weg zur Beantwortung dieser Frage erläutert.
3 Die Jemeinigkeit der Existenz: Das Herzstück der Arbeit widmet sich der Daseinsanalyse. Es erklärt das Dasein als In-der-Welt-sein, indem es die Welt der Dinge und die Weltlichkeit des Daseins differenziert und das Phänomen des In-Seins beleuchtet. Anschließend werden die Modi der Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit des Selbst untersucht. Der Abschnitt über Sorge und Zeitlichkeit fasst die verschiedenen Aspekte des Daseins zusammen und verdeutlicht, wie diese miteinander verbunden sind, um das Wesen des Daseins als Ganzheit zu verstehen. Die Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3 zeigen die verschiedenen Aspekte des Daseins in ihrer Verflechtung auf.
Schlüsselwörter
Sein und Zeit, Daseinsanalytik, Martin Heidegger, Seinsfrage, Seinsvergessenheit, In-der-Welt-sein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Sorge, Zeitlichkeit, Existenz, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen zu "Sein und Zeit" (Heidegger) - Eine Kurzübersicht
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Vorschau auf eine akademische Arbeit, die sich mit Martin Heideggers Hauptwerk „Sein und Zeit“ auseinandersetzt. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf einer textnahen Darstellung der Daseinsanalyse, ohne tiefergehende Interpretationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 (Notwendigkeit, Ziel und Methode), Kapitel 3 (Die Jemeinigkeit der Existenz) und Kapitel 4 (Schlussbemerkung: Die Frage nach dem Scheitern). Kapitel 3 ist weiter unterteilt in Unterkapitel, die verschiedene Aspekte des Daseins (In-der-Welt-sein, Selbst, Sorge und Zeitlichkeit) behandeln.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen verständlichen Einblick in Heideggers „Sein und Zeit“ und seine Konzeption des Menschen zu geben. Sie konzentriert sich auf die zentralen Argumentationslinien und Konzepte der Daseinsanalyse, ohne gesellschaftskritische, anthropologische oder moralische Interpretationen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Seinsfrage und die Seinsvergessenheit, das Dasein als In-der-Welt-sein, die Unterscheidung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, die Rolle von Sorge und Zeitlichkeit für das Dasein und die methodische Vorgehensweise Heideggers in „Sein und Zeit“.
Was wird in Kapitel 1 (Einleitung) behandelt?
Die Einleitung führt in die zentrale Frage nach dem Sein ein und betont deren Bedeutung für unser Leben. Sie stellt die Arbeit als Versuch einer verständlichen Darstellung der Daseinsanalyse vor, die einen ersten Einblick in Heideggers Konzeption des Menschen ermöglichen soll.
Was wird in Kapitel 2 (Notwendigkeit, Ziel und Methode) behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet den philosophisch-historischen Kontext, der Heidegger zur Seinsfrage veranlasste. Es erläutert die Seinsfrage, den methodischen Aufbau und die Vorgehensweise in „Sein und Zeit“, insbesondere die Analyse der Seinsvergessenheit und die Methode der Daseinsanalyse.
Was wird in Kapitel 3 (Die Jemeinigkeit der Existenz) behandelt?
Kapitel 3 ist das Herzstück der Arbeit und widmet sich der Daseinsanalyse. Es erklärt das Dasein als In-der-Welt-sein, differenziert die Welt der Dinge und die Weltlichkeit des Daseins, beleuchtet das In-Sein und untersucht die Modi der Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit des Selbst. Sorge und Zeitlichkeit werden als zusammenhängende Aspekte des Daseins erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sein und Zeit, Daseinsanalytik, Martin Heidegger, Seinsfrage, Seinsvergessenheit, In-der-Welt-sein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Sorge, Zeitlichkeit, Existenz und Philosophie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die einen ersten, verständlichen Einstieg in Heideggers „Sein und Zeit“ und die Daseinsanalyse suchen. Sie dient als Grundlage für weiterführende Analysen.
- Quote paper
- Kristina Trompetter (Author), 2013, Ist Martin Heidegger gescheitert? Eine Einführung in die Daseinsanalyse aus „Sein und Zeit“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266906