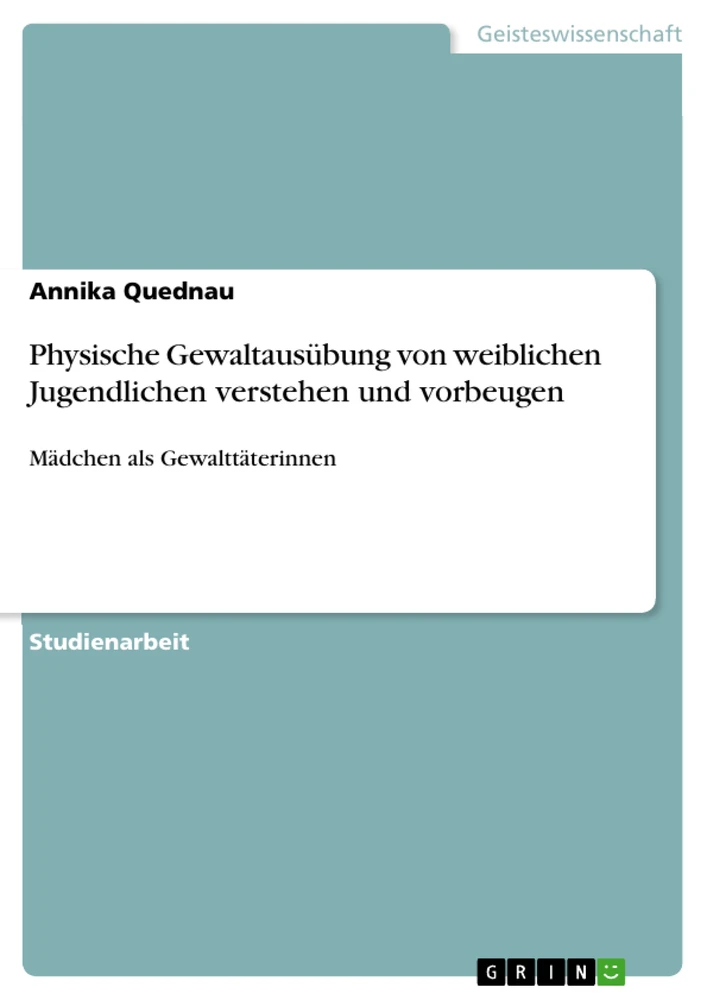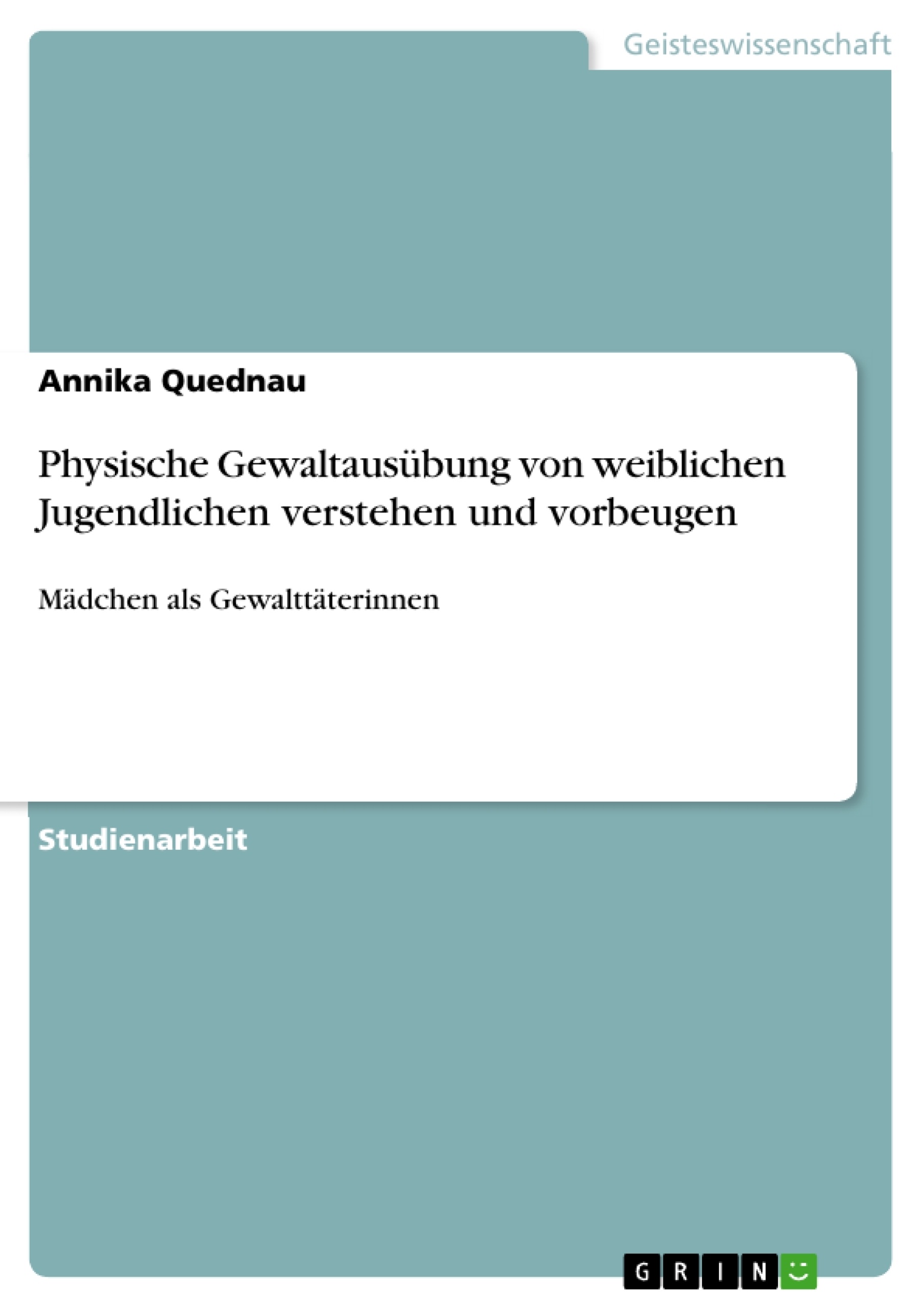In Karlsruhe stach eine 16-Jährige eine 17-Jährige auf offener Straße nieder, in Bad Windsheim misshandelte eine Gruppe mehrerer 14- und 15-jähriger Mädchen zwei Jungen und erpressten Bargeld von ihnen, in Hamburg schlug eine 14-Jährige eine 20-Jährige krankenhausreif . Dies sind nur einige Beispiele von Medienberichten über Mädchengewalt aus den letzten Jahren. Zwischen 1993 und 2007 hat sich die Zahl der Täterinnen bei Körperverletzungsdelikten verdreifacht.
Doch wie groß ist das Ausmaß wirklich? Und was sind die Ursachen hierfür? Was wissen wie über die Täterinnen?
Ziel dieser Hausarbeit ist es, durch eine Informationszusammentragung Folgerungen für die geschlechtsspezifische Gewaltprävention zu erlagen. Inspiriert wurde ich durch die Plakatvortragsrunde im Seminar, bei der es unter anderen auch um Gewaltausübungen von Frauen und um Mädchenarbeit ging.
Ich bin durch meine Arbeit in der offenen Kinder-und Jugendarbeit täglich sowohl mit Opfern als auch mit Täterinnen konfrontiert und denke, dass mir dort die Folgerungen der Hausarbeit in meiner Mädchengruppe helfen werden. Es geht in dieser Hausarbeit um die 12- bis 18 Jährigen und nicht um jüngere Kinder oder erwachsene Frauen. Des Weiteren bezieht sich diese Arbeit auf physische Gewalt, die bewusst eingesetzt wird um anderen zu schaden.
Diese Hausarbeit trägt den Titel „Mädchen als Gewalttäterinnen: Physische Gewaltausübung von weiblichen Jugendlichen verstehen und vorbeugen“. Nach dieser Einleitung folgt dazu in Punkt 2 erst einmal die aktuelle Sichtweise der Gesellschaft auf Mädchen und die Auswirkungen dessen auf die Sichtweise auf Mädchengewalt. Dann folgt ein Überblick über die Entwicklung von Mädchengewalt in den letzten Jahren, um das Ausmaß zu erfassen. In Punkt 4 geht es dann um die Gründe dafür, warum Mädchen gewalttätig werden. Punkt 5 veranschaulicht dies noch anhand von drei Fallbeispielen. Mit diesem Wissen folgt dann Punkt 6 und die Frage, wie man Mädchengewalt vorbeugen kann. Zum Schluss gibt es noch ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die aktuelle gesellschaftliche Sichtweise auf Mädchen.
- 3. Aktuelle Daten zum Ausmaß der Mädchengewalt.......
- 4. Ursachen für Mädchengewalt
- 5. Fallbeispiele.............
- 6. Physische Gewaltausübung von Mädchen vorbeugen..\n
- 7. Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Ursachen für physische Gewaltausübung von Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren zu verstehen und Ansätze für die geschlechtsspezifische Gewaltprävention zu entwickeln. Der Fokus liegt auf den aktuellen gesellschaftlichen Erwartungen an Mädchen und den Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Mädchengewalt.
- Die aktuelle Sichtweise auf Mädchen in der Gesellschaft
- Das Ausmaß der Mädchengewalt und die Entwicklung in den letzten Jahren
- Ursachen für Mädchengewalt
- Die Rolle von geschlechtsspezifischen Erwartungen und Rollenzuschreibungen
- Möglichkeiten zur Vorbeugung von Mädchengewalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung präsentiert aktuelle Beispiele von Mädchengewalt und stellt die Problematik der Hausarbeit dar. Sie beschreibt die Zielsetzung, die Motivation und den thematischen Fokus der Arbeit.
- Kapitel 2: Die aktuelle gesellschaftliche Sichtweise auf Mädchen Dieses Kapitel analysiert die heutige Sichtweise auf Mädchen in der Gesellschaft. Es beleuchtet die Erwartungen an Mädchen und die Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Mädchengewalt.
- Kapitel 3: Aktuelle Daten zum Ausmaß der Mädchengewalt Dieses Kapitel untersucht das Ausmaß der Mädchengewalt und die Entwicklung der Kriminalitätsraten in den letzten Jahren.
- Kapitel 4: Ursachen für Mädchengewalt Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen für Mädchengewalt und diskutiert die komplexen Faktoren, die zu gewalttätigem Verhalten führen können.
- Kapitel 5: Fallbeispiele Das Kapitel veranschaulicht die Thematik anhand von drei Fallbeispielen und bietet einen Einblick in die realen Situationen, in denen Mädchen Gewalt anwenden.
- Kapitel 6: Physische Gewaltausübung von Mädchen vorbeugen Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie man Mädchengewalt vorbeugen kann. Es beleuchtet verschiedene Ansätze und Strategien zur Prävention.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind Mädchengewalt, physische Gewalt, Jugendgewalt, geschlechtsspezifische Gewaltprävention, gesellschaftliche Erwartungen, Rollenzuschreibungen, Mädchenarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Kriminalität, Gewaltforschung, Medienberichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Nimmt die Gewalt von Mädchen tatsächlich zu?
Statistiken zeigen, dass sich die Zahl der Täterinnen bei Körperverletzungsdelikten zwischen 1993 und 2007 verdreifacht hat, was das Thema zunehmend in den medialen Fokus rückt.
Was sind die Hauptursachen für Mädchengewalt?
Die Ursachen sind komplex und reichen von familiären Problemen über Gewalterfahrungen bis hin zum Druck durch geschlechtsspezifische Rollenerwartungen.
Welche Rolle spielt die gesellschaftliche Sichtweise auf Mädchen?
Traditionelle Rollenbilder sehen Mädchen oft als friedfertig; wenn sie gewalttätig werden, reagiert die Gesellschaft oft mit Unverständnis, was eine gezielte Prävention erschweren kann.
Wie kann man Mädchengewalt effektiv vorbeugen?
Durch geschlechtsspezifische Gewaltprävention, die gezielt auf die Bedürfnisse und Lebensrealitäten von Mädchen eingeht, sowie durch Stärkung der sozialen Kompetenzen in der Jugendarbeit.
Welche Altersgruppe steht im Fokus dieser Untersuchung?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf weibliche Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren.
Was ist das Ziel der geschlechtsspezifischen Mädchenarbeit?
Ziel ist es, Mädchen alternative Handlungsstrategien zur Gewaltanwendung aufzuzeigen und sie in ihrer Identitätsentwicklung jenseits von Klischees zu unterstützen.
- Quote paper
- Annika Quednau (Author), 2013, Physische Gewaltausübung von weiblichen Jugendlichen verstehen und vorbeugen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266915