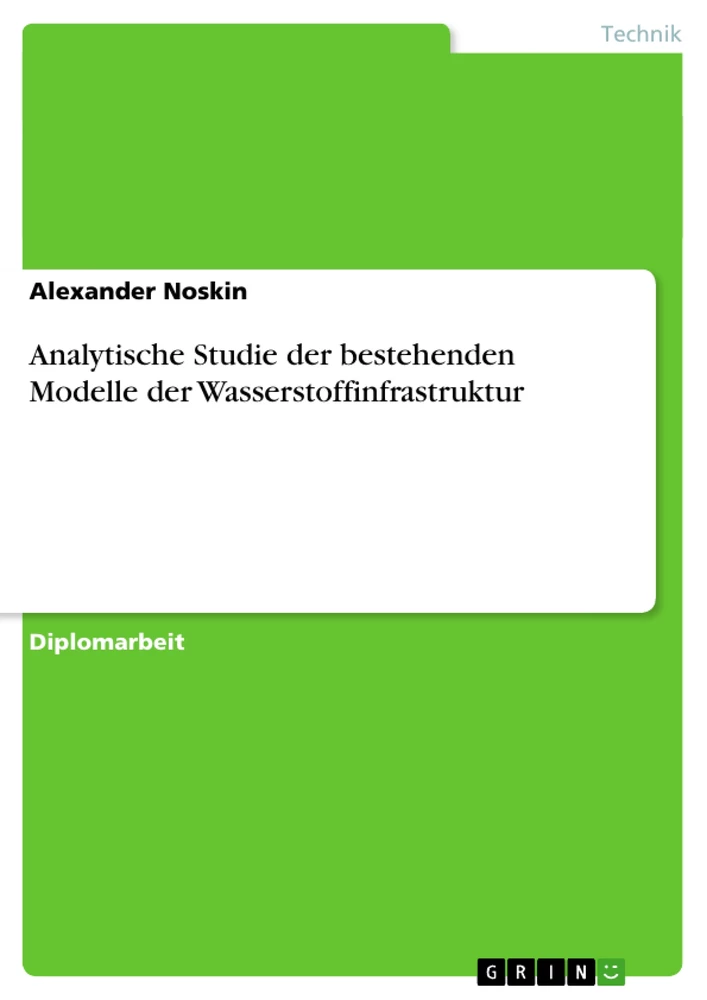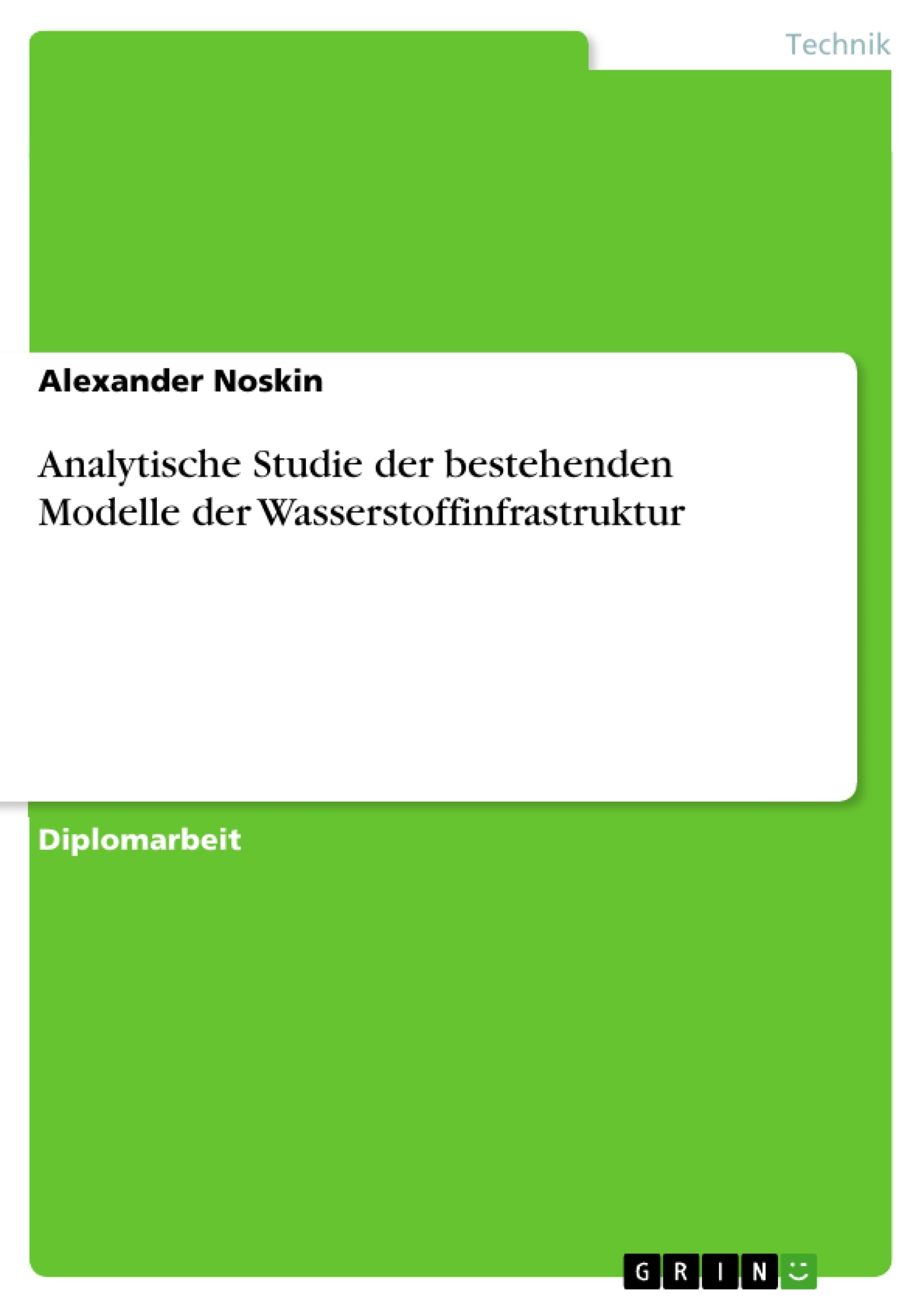Der Gebrauch von Wasserstoff als Sekundärenergieträger stellt eine interessante Alternative zu den bestehenden Energiesystemen dar und bietet eine Reihe von Vorteilen. Variable Produktionsmöglichkeiten leisten einen Beitrag zur Erhöhung der Energiesicherheit, es eröffnen sich Chancen zur Reduktion der Treibhausgase und einem effizienteren Energieverbrauch.
Für den Übergang zu einer weit verbreiteten Nutzung des Wasserstoffs muss allerdings erst eine Reihe von Problemen und Herausforderungen bewältigt werden. Neben technischen Verbesserungen in allen Bereichen des Wasserstoff-Lebenszyklus, der Erzielung von wesentlichen Kostensenkungen und der Ausarbeitung internationaler Standards für die Bereiche Sicherheit, Handel und Industrie, muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, die die Produktion, den Transport und die Distribution von Wasserstoff gewährleisten kann.
Vor dem Hintergrund der Unsicherheit und der enormen Investitionen, die der Aufbau der Infrastruktur erfordert, wurden und werden in der letzten Zeit zahlreiche Modelle entwickelt, um das Verständnis für den Ablauf des komplexen Entwicklungsprozesses zu verbessern und Entscheidungen bei der Planung zu unterstützen. Es entstand bereits eine umfangreiche Palette an Modellen, die unterschiedliche Bereiche der Wasserstoffwirtschaft behandeln und vielfältige Blickwinkel auf ihre Entwicklung und künftige Rolle bieten.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden die einzelnen Modelle, die in diesem Bereich existieren, detailliert untersucht und beschrieben. Die Beschreibung enthält Angaben zur ihrer jeweiligen Zielsetzung und ihrer Einordnung im Gesamtzusammenhang, zu ihrer Funktionsweise und gegebenenfalls zu ihren bisherigen Anwendungsbeispielen oder künftigen Erweiterungen. In einem separaten Kapitel werden die Modelle außerdem nach zahlreichen Kriterien aufgeschlüsselt und hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Motivation
- Zielsetzung
- Aufbau
- Problemfelder
- Produktion
- Transport und Distribution
- Speicherung
- Tankstelleninfrastruktur
- Tankstellentechnologien
- Tankstellenallokation und Nachfrageanalyse
- Infrastrukturplanung
- Soziale Akzeptanz von Wasserstoff
- Bedeutung der sozialen Akzeptanz
- Studien
- Generelle Analyse
- Wahrnehmung des Sicherheitsaspekts
- Modelltechniken
- Lineare Optimierung
- Dynamische Optimierung
- Agenten-basierte Modelle
- System Dynamics
- „Well-to-Wheels"-Modelle
- GIS-Modelle
- Modelle
- HIT
- Modellbeschreibung
- Die Peking-Fallstudie
- MOREHyS
- HyDS
- HyTrans
- H2CAS Expansion Model
- HyDive
- Das Modell von Stephan und Sullivan
- Modellbeschreibung
- Ergebnisse
- Das Modell von Malte Schwoon
- Modellbeschreibung
- Fallstudie
- MARKAL-ETSAP
- ETP
- Die Modellfamilie H2A
- H2A-Produktionsmodelle
- H2A-Distibutionsmodelle
- GREET
- E3-Database
- MSM
- NEMS
- Modelldiskussion
- Problematik eines Universalmodells
- Aufschlüsselung nach Kriterien
- Modellvergleich
- Zeitlicher und räumlicher Infrastrukturaufbau
- Lebenszyklus-Analyse
- Energiesystem-Analyse
- Tankstellenallokation und Nachfrageentwicklung
- Schlussfolgerung und Ausblick
- Schlussfolgerungen
- Kritische Würdigung und Ausblick
- Zusammenfassung
- Abstract
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit zielt darauf ab, bestehende Modelle der Wasserstoffinfrastruktur zu analysieren und einen umfassenden Überblick über ihre Funktionsweise, Stärken und Schwächen zu liefern. Die Arbeit soll dazu beitragen, das Verständnis für die komplexen Herausforderungen des Übergangs zu einer Wasserstoffwirtschaft zu verbessern und Entscheidungsträgern bei der Planung und Umsetzung von Wasserstoff-Infrastrukturprojekten zu unterstützen.
- Die Herausforderungen des Aufbaus einer Wasserstoffinfrastruktur
- Die verschiedenen Modelltechniken, die im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur eingesetzt werden
- Die Analyse und der Vergleich der wichtigsten Wasserstoffmodelle
- Die Identifizierung von Stärken und Schwächen der Modelle
- Die Bedeutung der sozialen Akzeptanz von Wasserstoff
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Wasserstoffwirtschaft und erläutert die Motivation und Zielsetzung der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Problemfelder im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur vorgestellt, darunter die Produktion, der Transport, die Speicherung und die Distribution von Wasserstoff.
Kapitel drei befasst sich mit den verschiedenen Modelltechniken, die im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur eingesetzt werden, wie lineare Optimierung, dynamische Optimierung, Agenten-basierte Modelle, System Dynamics, „Well-to-Wheels"-Modelle und GIS-Modelle.
Kapitel vier bietet eine detaillierte Beschreibung der wichtigsten Wasserstoffmodelle, die heute existieren. Für jedes Modell werden Aufbau, Funktionsweise, Stärken und Schwächen sowie relevante Fallstudien vorgestellt.
Kapitel fünf widmet sich dem Vergleich der Modelle und diskutiert die Problematik eines Universalmodells. Die Modelle werden nach verschiedenen Kriterien, wie Fokus, Typ, Inputs, Outputs, räumliche und zeitliche Aspekte, Prognostizierbarkeit sowie Stärken und Schwächen, kategorisiert und miteinander verglichen.
Das letzte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Wasserstoffmodellierung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wasserstoffinfrastruktur, Wasserstoffwirtschaft, Modellvergleich, Modellanalyse, Wasserstoffproduktion, Wasserstofftransport, Wasserstoffspeicherung, Wasserstoffdistribution, Tankstellenallokation, Nachfrageentwicklung, soziale Akzeptanz, Energiesystemmodelle, Lebenszyklus-Analyse, Agenten-basierte Modelle, System Dynamics, „Well-to-Wheels"-Modelle, GIS-Modelle.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eine Wasserstoffinfrastruktur notwendig?
Um Wasserstoff als Sekundärenergieträger breit nutzen zu können, müssen Produktion, Transport, Speicherung und Distribution (z. B. Tankstellen) flächendeckend gewährleistet sein.
Welche Modelltechniken werden zur Planung verwendet?
Zum Einsatz kommen unter anderem lineare Optimierung, agentenbasierte Modelle, System Dynamics, GIS-Modelle und „Well-to-Wheels“-Analysen.
Was ist das Ziel der untersuchten Modelle?
Die Modelle sollen helfen, den komplexen Aufbauprozess zu verstehen, Kosten zu senken und optimale Standorte für die Infrastruktur zu finden.
Welche Rolle spielt die soziale Akzeptanz?
Die Arbeit beleuchtet, dass der Erfolg der Wasserstoffwirtschaft stark von der Wahrnehmung der Sicherheit und der Akzeptanz in der Bevölkerung abhängt.
Welche spezifischen Modelle werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden unter anderem HIT, MOREHyS, HyDS, HyTrans sowie die H2A-Modellfamilie und GREET.
Was sind die größten Herausforderungen beim Infrastrukturaufbau?
Dazu gehören enorme Investitionskosten, technische Hürden bei der Speicherung und der Mangel an internationalen Sicherheitsstandards.
- Arbeit zitieren
- Alexander Noskin (Autor:in), 2007, Analytische Studie der bestehenden Modelle der Wasserstoffinfrastruktur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266949