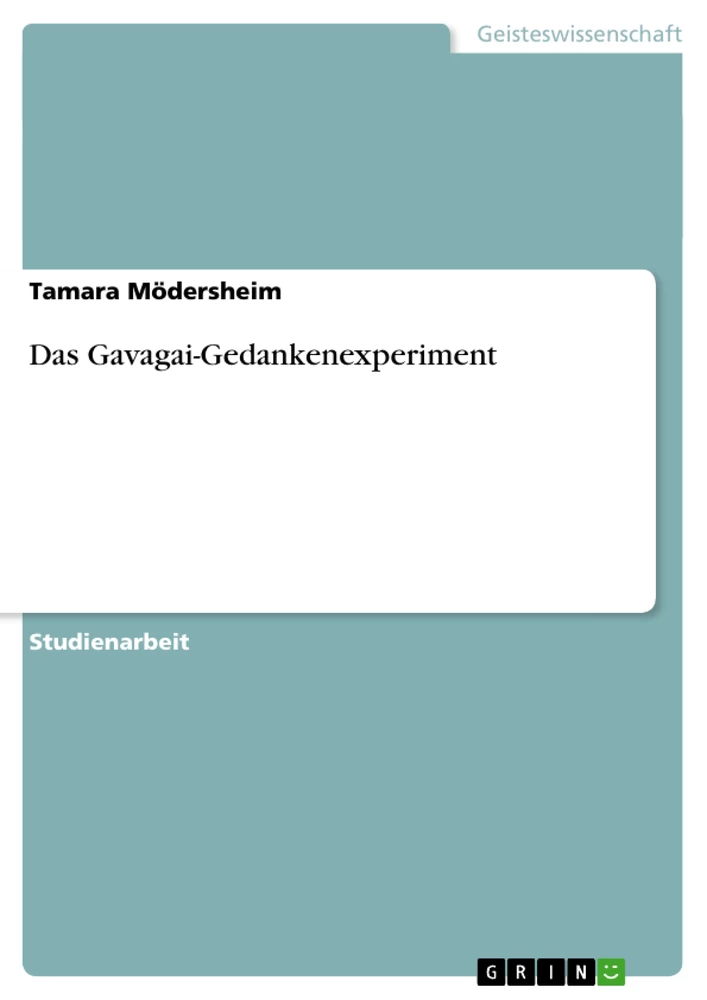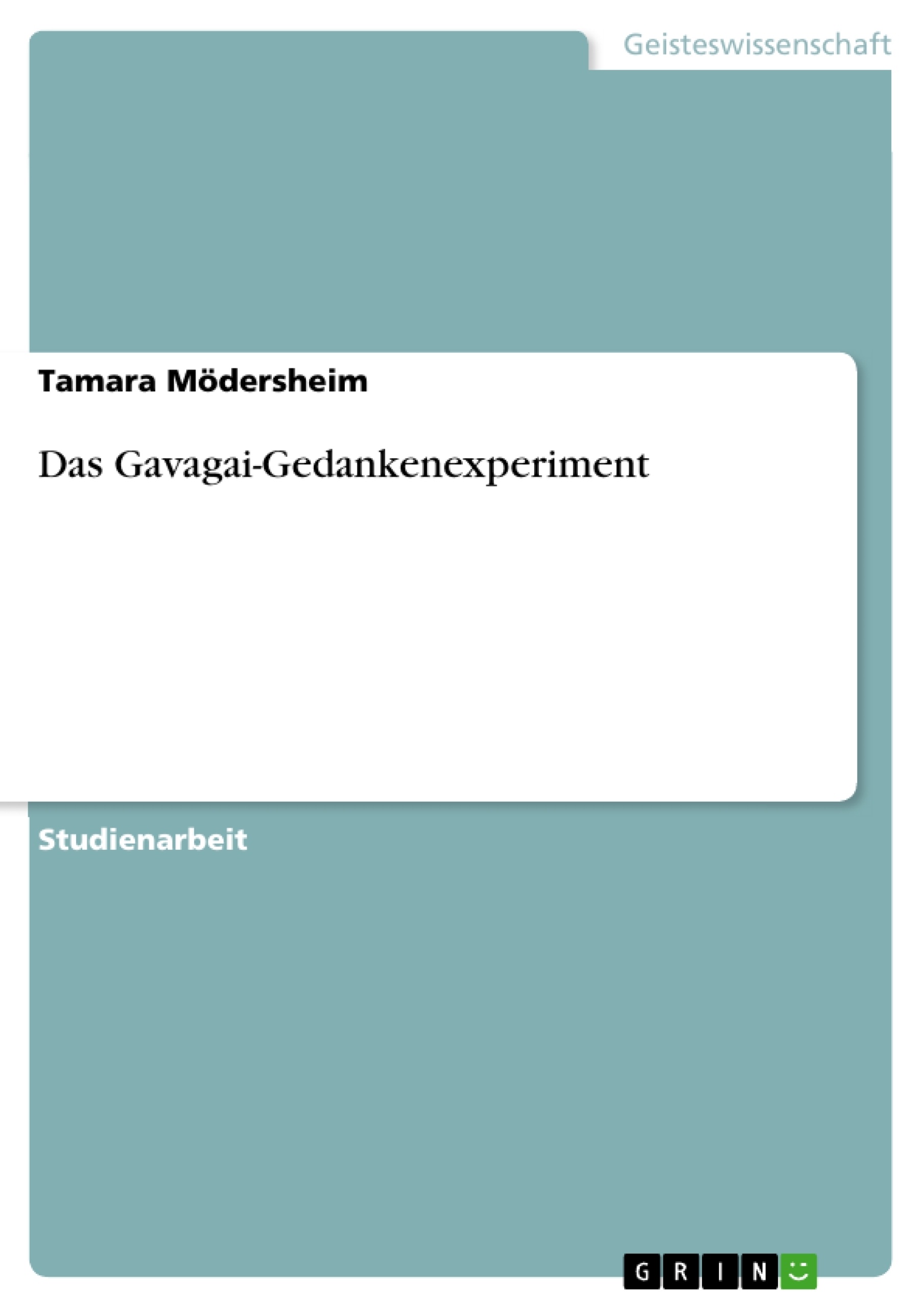Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren miteinander in allen erdenklichen Sprachen. Jeder von uns besitzt mehrere Wörterbücher, lernt in der Schule Fremdsprachen und belegt Sprachkurse für den Urlaub. Es gibt Sprachforscher, Fremdsprachenkorrespondenten, Dolmetscher und Wörterbuchautoren, die ihren Beruf Übersetzungen und der Verschiedenheit und Vielseitigkeit der Sprachen verdanken. Ohne die Übertragung von Inhalten aus einer Sprache in eine andere Sprache, sprich Übersetzungen, wäre jedes Land abgeschirmt. Es gäbe keinen globalen Handel und fast keine Migrationsbewegungen, weil sich niemand in fremden Ländern verständigen könnte. Übersetzungen sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens eines jeden von uns. Aber wo haben sie ihren Ursprung?
Quine kritisiert in seinem Aufsatz „word and object“ die Annahme, dass Sprache in der Struktur schon vorhanden ist. Er sieht die Existenz einer Blackbox als sehr zweifelhaft an.
Als Bedeutungsskeptiker ist der Begriff der Bedeutung für ihn unklar, genauso wie die Sprache. Es gibt zu jeder noch so brillianten Übersetzung mehrere Alternativen, die sich sogar oft gegenseitig ausschließen oder nichts miteinander gemeinsam haben.
Deswegen arbeitet er in seinem Aufsatz nicht mit Begriffen, um andere Begriffe zu erklären, sondern mit einem Gedankenexperiment, dem „Gavagai-Experiment“, um das es in meiner Hausarbeit geht. Es soll zeigen, dass es nicht gelingen kann, einer vollkommen fremden Sprache eine eindeutige Bedeutung zuzuteilen. Im Folgenden will ich die Schritte, die zu Quines These der Unbestimmtheit der Urübersetzung führen, erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gavagai-Experiment
- Anlass — die Unbestimmtheit der Ulübersetzung
- Durchfiihrung
- Probleme
- Gelegenheitssätze und bleibende Sätze
- Reizbedeutung
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem „Gavagai-Experiment" von Willard Van Orman Quine. Ziel ist es, die Unbestimmtheit der Urübersetzung zu beleuchten, die Quine in seinem Aufsatz „Word and Object" darlegt. Quine kritisiert dabei die Annahme, dass Sprache in ihrer Struktur bereits vorliegt und die Bedeutung von Wörtern eindeutig festgelegt ist. Das Gavagai-Experiment soll zeigen, dass es nicht möglich ist, einer vollkommen fremden Sprache eine eindeutige Bedeutung zuzuordnen.
- Die Unbestimmtheit der Urübersetzung
- Die Rolle von Reizen in der Bedeutungsermittlung
- Die Unterscheidung zwischen Gelegenheitssätzen und bleibenden Sätzen
- Die Schwierigkeiten der radikalen Übersetzung
- Die Bedeutung von Sprache als Ganzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Übersetzung ein und stellt die Bedeutung von Übersetzungen für die Kommunikation zwischen Menschen weltweit heraus. Quines Kritik an der Annahme einer vorgegebenen Sprachstruktur und der Unklarheit des Begriffs der Bedeutung wird erläutert. Das Gavagai-Experiment wird als zentrales Element der Hausarbeit vorgestellt.
Das Gavagai-Experiment wird in Kapitel 2 genauer betrachtet. Zuerst wird der Anlass für Quines Gedankenexperiment erläutert: die Unbestimmtheit der Ulübersetzung. Quine kritisiert den Bedeutungsbegriff und zeigt auf, dass selbst zwei Sprecher der gleichen Sprache ein Wort nicht unbedingt gleich auffassen. Anschließend wird die Durchführung des Experiments beschrieben: Ein Sprachforscher begegnet einem völlig fremden Volk und versucht, dessen Sprache zu verstehen. Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung werden anhand des Beispiels „Gavagai" erläutert. Es ist nicht klar, ob „Gavagai" „Kaninchen", „Tier", „weißes Kaninchen" oder etwas ganz anderes bedeutet. Der Sprachforscher muss in verschiedenen Situationen beobachten und versuchen, Muster zu erkennen.
Kapitel 3 befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Gelegenheitssätzen und bleibenden Sätzen. Gelegenheitssätze sind Sätze, die nur Zustimmung oder Ablehnung erfordern, wenn sie im Anschluss an einen veranlassenden Reiz in Frage gestellt werden. Bleibende Sätze hingegen können unabhängig von Reizeinflüssen bejaht oder verneint werden. Quine zeigt, dass auch Gelegenheitssätze von Zusatzinformationen abhängig sind und es daher zu Diskrepanzen zwischen dem Verständnis des Eingeborenen und dem Verständnis des Sprachforschers kommen kann.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Konzept der Reizbedeutung. Quine argumentiert, dass es nicht das Kaninchen selbst ist, welches die Zustimmung des Eingeborenen auf „Gavagai?" verursacht, sondern der Kaninchenreiz. Die Reizbedeutung wird als geordnetes Paar der negativen Reizbedeutung und der affirmativen Reizbedeutung definiert. Affirmative Reizbedeutung umfasst alle Reize, die einen Sprecher zur Zustimmung verleiten würden, während negative Reizbedeutung alle Reize umfasst, die einen Sprecher zur Ablehnung verleiten würden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Unbestimmtheit der Urübersetzung, das Gavagai-Experiment, die Bedeutung von Reizen, Gelegenheitssätze, bleibende Sätze, die Reizbedeutung und die radikale Übersetzung. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Bedeutungsermittlung in einer fremden Sprache und zeigt die Grenzen der Übersetzung auf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Gavagai-Experiment“?
Ein Gedankenexperiment von W.V.O. Quine, das zeigt, dass es unmöglich ist, einer vollkommen fremden Sprache eine eindeutige Übersetzung zuzuordnen (Unbestimmtheit der Übersetzung).
Was bedeutet das Wort „Gavagai“ im Experiment?
Das ist unklar: Es könnte „Kaninchen“, „da ein Kaninchen“, „unabgetrennter Kaninchenteil“ oder „Kaninchenhaftigkeit“ bedeuten, da der Beobachter nur den Reiz sieht.
Was ist die „Reizbedeutung“?
Quine definiert Bedeutung über die Gesamtheit der Reize, die einen Sprecher dazu bringen würden, einem Satz zuzustimmen oder ihn abzulehnen.
Was sind Gelegenheitssätze?
Sätze, die nur im Moment eines bestimmten Reizes (z.B. „Dort ist ein Kaninchen“) bejaht oder verneint werden können.
Warum kritisiert Quine den klassischen Bedeutungsbegriff?
Er bezweifelt, dass Sprache eine feste innere Struktur (Blackbox) hat, und sieht Bedeutung als etwas Unbestimmtes an, für das es immer alternative Übersetzungen gibt.
- Arbeit zitieren
- Tamara Mödersheim (Autor:in), 2011, Das Gavagai-Gedankenexperiment, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266965