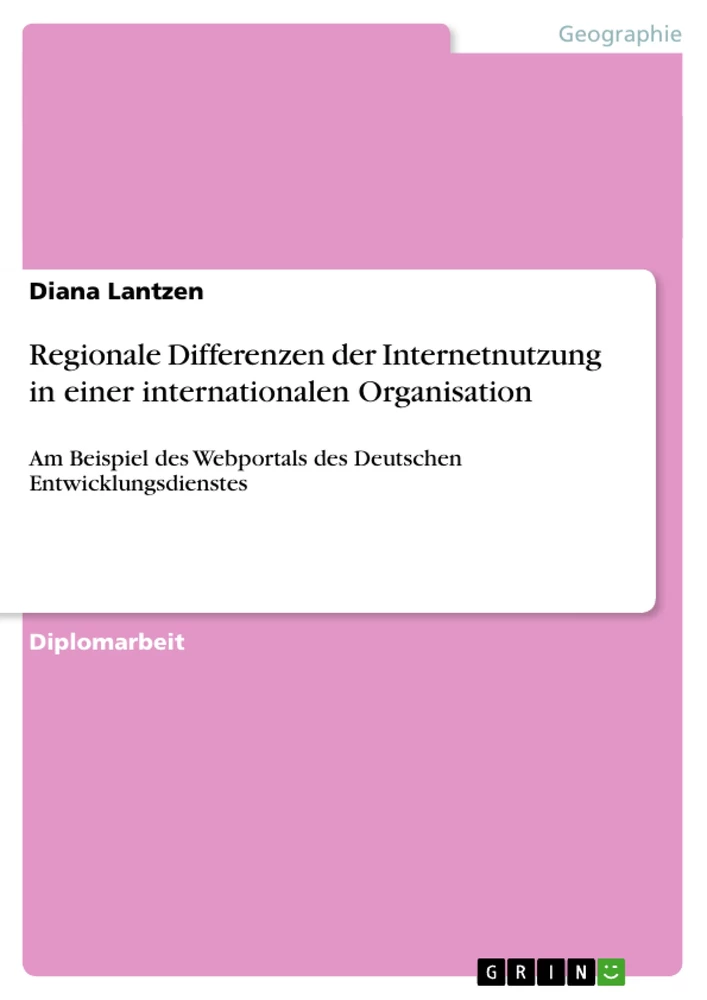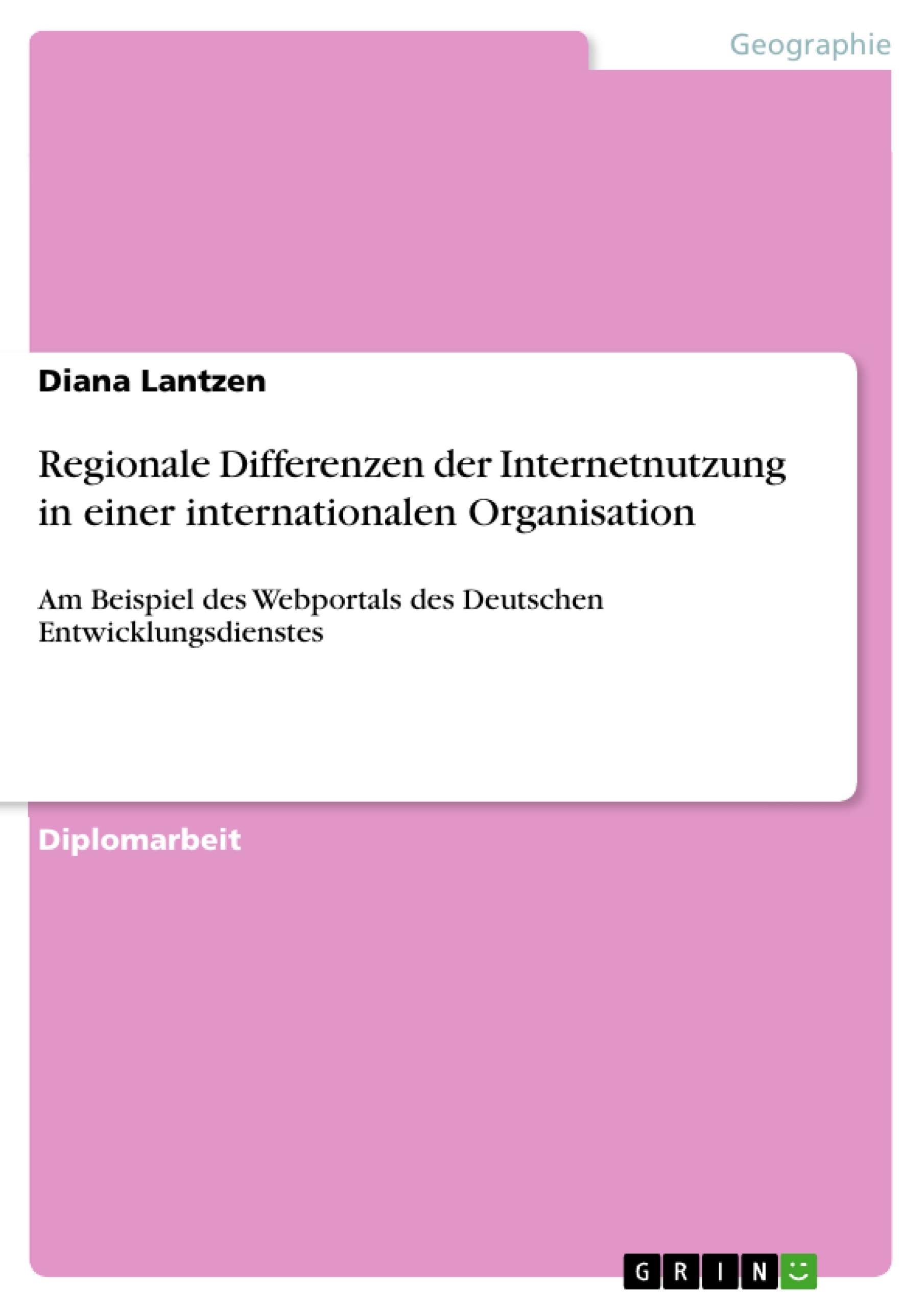In dieser Arbeit wird das Webportal des Deutschen Entwicklungsdienstes gGmbH
(DED) untersucht. Dabei liegt der Schwerpunkt der empirischen Untersuchung
darauf, die Nutzung des webbasierten Intranets seitens der Mitarbeiter innerhalb
der in aktuell 46 Ländern tätigen Organisation der EZ zu analysieren. Es muss
zunächst untersucht werden, ob es regionale Differenzen im Bezug auf die Nutzung
des Portals zwischen den einzelnen Ländern, in denen die Organisation sitzt, gibt.
Ausgehend davon stellt sich die Frage: Warum gibt es Unterschiede in der Nutzung?
Daraus ergibt sich zusammengefasst folgende Hauptfragestellung:
Gibt es regionale Differenzen der Nutzung des Webportals innerhalb der
Organisation und welche Gründe können für eine selektive Nutzung des Portals
ausgemacht werden?
Zur Beantwortung der Hauptfragestellung werden im Folgenden drei Unterfragen
formuliert. Zunächst muss die Frage beantwortet werden, ob es eine heterogene
Nutzung des Portals gibt. Die erste Unterfrage lautet:
1. Wird das Webportal in den einzelnen Ländern unterschiedlich genutzt? Wenn
ja, lässt sich das räumliche Muster der Nutzung auf divergierende
Zugangsbedingungen zum Internet zurückführen?
Die technischen Voraussetzungen, womit der Zugang zum Internet gemeint ist, sind
in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Das Webportal wird über das Internet
aufgerufen und damit besteht ein enger Zusammenhang zwischen Internetnutzung und Webportalnutzung. Am Beispiel des Webportals wird überprüft, ob sich
divergierende Zugangsbedingungen auf die Nutzung von IKT auswirken.
Zudem müssen die Funktionen und der Nutzen von Portallösungen diskutiert
werden, um nähere Erkenntnisse über den Untersuchungsgegenstand zu gewinnen.
Es muss gefragt werden (zweite Unterfrage):
2. Welche Funktionen erfüllt das webbasierte Unternehmensportal? Wird der
organisationsinterne Informationsaustausch verbessert?
Diese Unterfrage wird im Hinblick auf die Hauptfragestellung gestellt, um den Nutzen
einer medialen Interaktionsplattform allgemein zu erklären. Erfüllt das Portal nicht die
an es gestellten Anforderungen, können darin die möglichen Gründe für eine
uneinheitliche Nutzung innerhalb der Organisation liegen. Mit Hilfe dieser Unterfrage
sollen auch mögliche Barrieren oder Restriktionen von internetbasierten,
computergestützten Systemen aufgedeckt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hintergrund der Arbeit
- 1.2 Fragestellungen
- 1.3 Der Untersuchungsgegenstand- One Space of Information
- 1.4 Aufbau der Diplomarbeit
- 2. Internet und Raum — räumliche Strukturen und Formen der Internetnutzung
- 2.1 Der „anything, anywhere, anytime — Traum"
- 2.2 Räumliche Strukturen des Internets und „digital divide"
- 2.2.1 Räumliche Ausprägungen des Internets und der „space of flows"
- 2.2.2 Lokalisation von Internetinhalten und Internetnutzern
- 2.2.3 Digital Divide — ein Überblick
- 2.3 Interaktion im Internet
- 2.3.1 Information und Kommunikation durch Webtechnologien
- 2.3.2 Soziale Leistungen von neuen Technologien
- 2.3.3 Synchrone und asynchrone Interaktion im Internet
- 3. Informationstechnologien in Organisationen — Formen der Zusammenarbeit und deren Grenzen
- 3.1 Funktionen von Webportalen
- 3.1.1 Das Intranet im Internet als Kooperationssystem
- 3.1.2 Klassifikation von Kooperations- und Wissensmanagementsystemen
- 3.1.3 Funktionen von Computer Supported Cooperative Work-Systemen
- 3.1.4 Dokumentenmanagement-Systeme und kodifiziertes Wissen
- 3.1.5 „Communities Of Practice" im virtuellen Raum
- 3.2 Zusammenfassung: Nutzen von Webtechnologien und Grenzen des „flow of information"
- 3.1 Funktionen von Webportalen
- 4. Akzeptanz von technischen Innovationen
- 4.1 Akzeptanzbegriff und Akzeptanzforschung — ein Überblick
- 4.1.1 Begriff der Akzeptanz
- 4.1.2 Die klassische Akzeptanzforschung
- 4.2 Akzeptanzmodelle zu Informationstechnologien
- 4.2.1 Akzeptanzmodelle von Degenhardt, Goodhue und Davis
- 4.2.2 Technology-Acceptance-Model 2
- 4.3 Kritik der Akzeptanzmodelle und weitere Einflussfaktoren
- 4.1 Akzeptanzbegriff und Akzeptanzforschung — ein Überblick
- 5. Zwischenfazit und Hypothesen
- 6. Methodik
- 6.1 Quantitatives Verfahren — Logfileanalyse
- 6.1.1 Die Logfiles
- 6.1.2 Vorgehensweise: Lokalisierung der Nutzung
- 6.1.3 Durchführung eines „Speed"-Tests
- 6.2 Qualitatives Verfahren - leitfadengestützte Experteninterviews
- 6.3 Diskussion der methodischen Vorgehensweise
- 6.1 Quantitatives Verfahren — Logfileanalyse
- 7. Die Nutzung des Webportals in der Organisation — Ergebnisse der Arbeit
- 7.1 Räumliche Strukturen der Nutzung des Portals
- 7.1.1 Überblick - Nutzung des Portals in der Gesamtorganisation
- 7.1.2 Nutzung des Portals auf Ebene der Regionen
- 7.1.3 Differenzen in der Qualität der Internetanbindung: Die technischen Rahmenbedingungen in den Ländern
- 7.2 Funktionen des Webportals — Unterstützung des „flow of information"?
- 7.2.1 Das Webportal als technisches Kooperationssystem
- 7.2.2 Portale des Webs - Tür zum weltweiten Wissen der Organisation?
- 7.3 Einflussfaktoren auf die Nutzung - Individuelle Gründe für selektive Nutzung
- 7.3.1 Relevanz für das berufliche Aufgabenfeld. Portals - Useful for everyone?
- 7.3.2 Akzeptanz durch Lernangebote und Benutzerfreundlichkeit - Nutzen von Schulungen
- 7.3.3 Akzeptanz von Webportalen — Zusammenfassende Betrachtung der Faktoren
- 7.1 Räumliche Strukturen der Nutzung des Portals
- 8.Schlussbetrachtung
- 8.1 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
- 8.2 Schlussfolgerungen
- 9. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Nutzung des Webportals des Deutschen Entwicklungsdienstes (DED) in einer internationalen Organisation. Ziel ist es, regionale Differenzen der Internetnutzung im Kontext des Webportals zu analysieren und die Gründe für eine selektive Nutzung zu erforschen.
- Räumliche Strukturen der Internetnutzung
- Digital Divide und die Bedeutung von Zugangsbedingungen
- Funktionen und Nutzen von Webportalen in Organisationen
- Akzeptanz von technischen Innovationen und deren Einflussfaktoren
- Individuelle und kontextuelle Determinanten der Webportalnutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet das Internet als ein im Raum zu verortendes Medium und untersucht die räumlichen Strukturen und Formen der Internetnutzung. Es werden Ansätze vorgestellt, die die Bedeutung von Raum und Zeit im Kontext der Internetnutzung betonen und den „digital divide" als Ausdruck räumlicher Ungleichheiten im Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien diskutieren.
Kapitel 3 widmet sich den Funktionen von Webportalen in Organisationen und deren Einsatz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs. Es werden verschiedene Typen von Webportalen, die Funktionen von CSCW-Systemen und die Bedeutung von Dokumentenmanagement und virtuellen Communities of Practice (COP) beleuchtet. Die Grenzen des „flow of information" werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Akzeptanz von technischen Innovationen und erörtert verschiedene Akzeptanzmodelle, die den Einfluss von individuellen Faktoren und Kontextbedingungen auf die Nutzung von Informationstechnologien erklären. Das Technology-Acceptance-Model 2 (TAM 2) wird vorgestellt und dessen Relevanz für die Analyse der Webportalnutzung im DED erörtert.
Kapitel 5 fasst die theoretischen Grundlagen zusammen und stellt die Arbeitshypothesen auf. Es werden Annahmen über regionale Differenzen der Webportalnutzung, die Funktionen des Portals, die Rolle der Akzeptanz und die Bedeutung von individuellen Faktoren für das Nutzungsverhalten aufgestellt.
Kapitel 6 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die Logfile-Analyse als quantitatives Verfahren und leitfadengestützte Experteninterviews als qualitative Methode vorgestellt. Die Anwendung dieser Methoden zur Beantwortung der Forschungsfragen wird erläutert.
Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die räumlichen Strukturen der Webportalnutzung, die Funktionen des Portals und die Einflussfaktoren auf die Nutzung im Detail analysiert. Die Ergebnisse der Logfile-Analyse und der Experteninterviews werden zusammengeführt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Webportal, die Internetnutzung, regionale Differenzen, die Entwicklungszusammenarbeit, den Deutschen Entwicklungsdienst (DED), die Akzeptanz von technischen Innovationen, die Funktionen von Webportalen in Organisationen, die Bedeutung von Communities of Practice (COP) und die Einflussfaktoren auf die Webportalnutzung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das Webportal des DED in verschiedenen Ländern unterschiedlich genutzt?
Regionale Differenzen hängen stark von den technischen Zugangsbedingungen zum Internet sowie der individuellen Akzeptanz und Relevanz für das jeweilige Aufgabenfeld ab.
Was versteht man unter dem „Digital Divide“?
Der Digital Divide beschreibt die räumliche Ungleichheit beim Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien, die auch innerhalb einer internationalen Organisation spürbar ist.
Welche Funktionen erfüllt ein webbasiertes Unternehmensportal?
Es dient als Kooperationssystem, ermöglicht Wissensmanagement durch Dokumentenmanagement-Systeme und unterstützt den Aufbau virtueller „Communities of Practice“.
Welche Methodik wurde zur Untersuchung der Nutzung verwendet?
Die Arbeit kombiniert quantitative Verfahren (Logfileanalyse der Portalzugriffe) mit qualitativen Verfahren (leitfadengestützte Experteninterviews).
Was besagt das Technology-Acceptance-Model 2 (TAM 2)?
Das TAM 2 erklärt, wie individuelle Faktoren und kontextuelle Bedingungen die Akzeptanz und tatsächliche Nutzung technischer Innovationen beeinflussen.
Können Schulungen die Portalnutzung verbessern?
Ja, die Untersuchung zeigt, dass Lernangebote und Benutzerfreundlichkeit wesentliche Faktoren für die Akzeptanz von Webportalen sind.
- Citar trabajo
- Diplom Geographin Diana Lantzen (Autor), 2008, Regionale Differenzen der Internetnutzung in einer internationalen Organisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267084