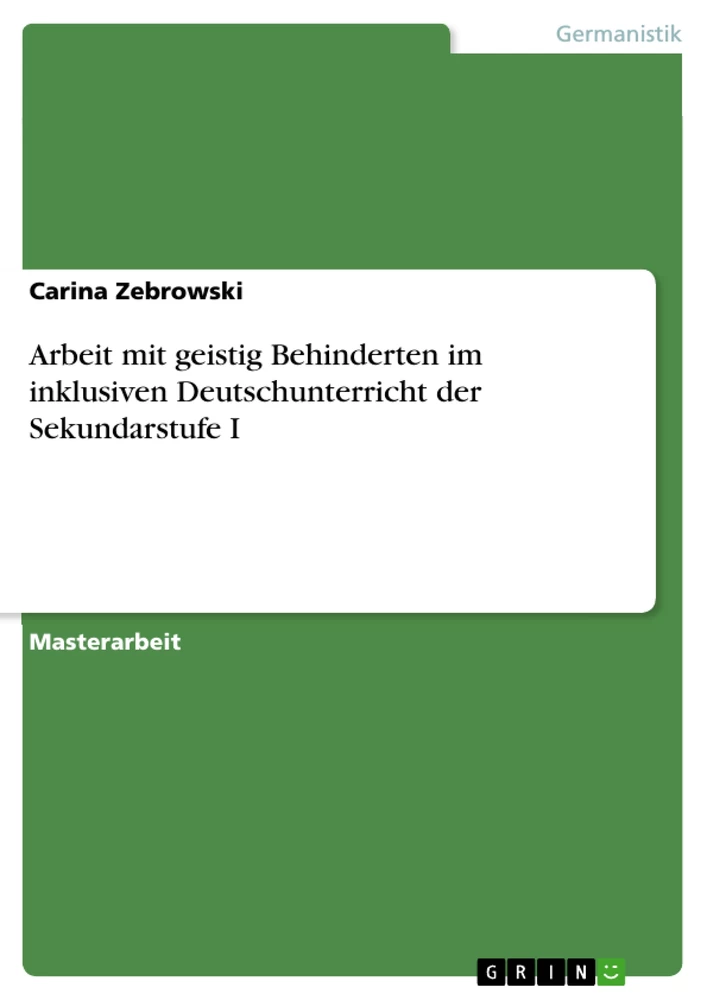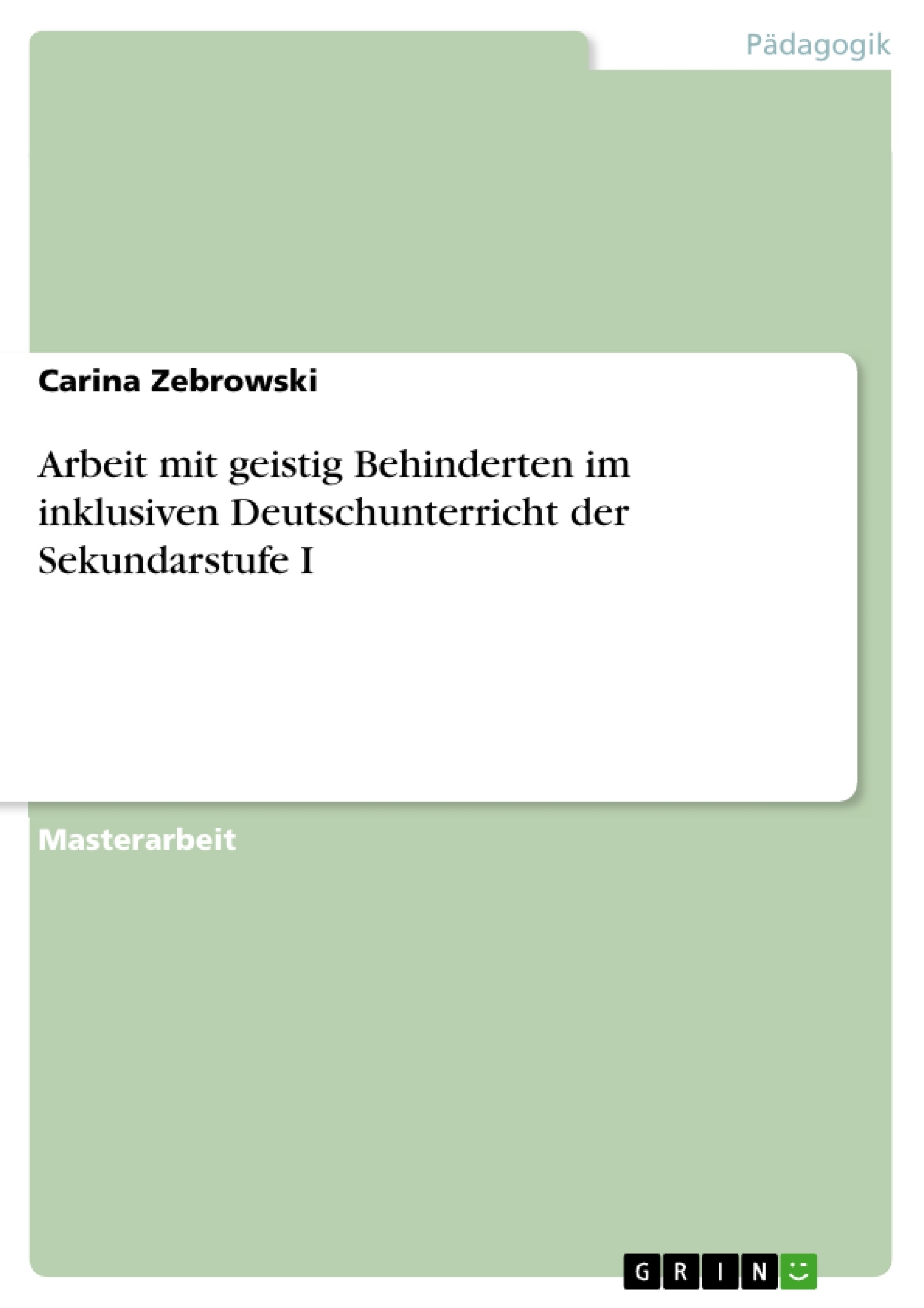In dieser Arbeit soll nicht das Idealkonzept einer durchweg inklusiven Bildungslandschaft aufgegriffen werden. Es wird eher versucht, Spannungsverhältnisse zwischen dem aktuellen Schulsystem und der Idealvorstellung des Rechts auf Inklusion darzustellen und darauf aufbauend eine Unterrichtseinheit für den Deutschunterricht zu entwickeln, die der Phase des Übergangs gerecht werden kann und mögliche Hilfestellungen für die Lehrpersonen aufzeigt.
Der Bezug zum Deutschunterricht ist insofern interessant, als er in seiner aktuellen Ausrichtung vielen Anforderungen gerecht werden muss. So geht es nicht mehr nur um die Vermittlung fachlichen Wissens – in diesem Beispiel um Sprachwandel und Sprachbewusstsein im Teilbereich Reflexion über Sprache – sondern zusätzlich um die Lese- und Sprachförderung sowie die Vermittlung von Medien- und Methodenkompetenz. Die Herausforderung für die Lehrerperson besteht darin, in einem stark heterogenen Klassenzimmer möglichst allen Schülern gerecht zu werden, an geeigneter Stelle zu differenzieren, Hilfs- oder Fördermittel bereitzustellen und gleichzeitig die Anschlussfähigkeit der einzelnen Schüler zu gewährleisten. In der vorgestellten Unterrichtseinheit im vierten Kapitel wird auf diese Ansprüche Bezug genommen und versucht, in einem noch sehr strukturierten und noch nicht inklusiven Schulsystem die Arbeit im inklusiven Klassenzimmer realistisch darzustellen. Die Einbindung und Unterstützung der beiden geistig behinderten Schüler Björn und Lisa spielt dabei eine zentrale Rolle.
Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel zwei und drei) werden – vorbereitend auf den Praxisbezug – zunächst das (Ideal-) Konzept der Inklusion sowie die Problematik, die sich bei der Umsetzung im aktuellen deutschen Schulsystem ergibt, vorgestellt. Zudem wird der Umgang mit Heterogenität durch den adäquaten Einsatz von innerer Differenzierung und Individualisierung aufgeführt, da diese die zentralen Bezugspunkte für die Aufgabenstellungen in der anschließenden Unterrichteinheit sein werden. Letztere umfasst elf Unterrichtsstunden zum Thema "Entwicklungen der deutschen Gegenwartssprache: Anglizismen", die für eine Regelklasse konzipiert und mit Differenzierungsmöglichkeiten und besonderen Hilfestellungen für die geistig behinderten Schüler Lisa und Björn ergänzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Herleitung und Problemstellung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Inklusion
- 2.1 Gesetzliche Grundlage
- 2.2 Der Aufbau eines inklusiven Bildungssystems in Deutschland
- 2.2.1 Inklusion als Qualitätsmerkmal?
- 2.2.2 Das „Doppelsystem“ aus Regel- und Sonderschulen als Hindernis
- 2.2.3 Die Übergangsphase zur Inklusion
- 3. Umsetzung eines inklusiven Unterrichts in der Schule
- 3.1 „Ein Bekenntnis zur Inklusion entspricht einem Bekenntnis zur Heterogenität“
- 3.2 Innere Differenzierung und Individualisierung
- 3.2.1 Differenzierender Unterricht
- 3.2.2 Aufgabenstellungen und Lernziele
- 3.2.3 Individuelle Förderung und Team-Teaching
- 4. Die Unterrichtseinheit – Konzeption und Differenzierungsmöglichkeiten
- 4.1 Der Anspruch an den Deutschunterricht
- 4.2 Lehr-Lern-Voraussetzungen
- 4.3 Lerninhalte und Lernziele
- 4.4 Unterrichtsverlauf und Differenzierungsmöglichkeiten
- 4.5 Fazit zur Konzeption der Unterrichtseinheit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Inklusion im Deutschunterricht der Sekundarstufe I, insbesondere die Arbeit mit geistig behinderten Schülern im Kontext des Übergangs zu einem inklusiven Schulsystem. Sie entwickelt eine Unterrichtseinheit, die die Bedürfnisse heterogener Lerngruppen berücksichtigt und Hilfestellungen für Lehrkräfte bietet.
- Inklusion im deutschen Schulsystem und dessen aktuelle Herausforderungen
- Umsetzung inklusiven Unterrichts mit Fokus auf innere Differenzierung und Individualisierung
- Entwicklung und Konzeption einer differenzierten Unterrichtseinheit im Deutschunterricht
- Praktische Hilfestellungen für Lehrkräfte im Umgang mit heterogenen Lerngruppen
- Spannungsfeld zwischen Idealvorstellung von Inklusion und der Realität des Schulsystems
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Spannungsverhältnisse zwischen dem aktuellen Schulsystem und dem Ideal der Inklusion aufzuzeigen und eine Unterrichtseinheit für den Deutschunterricht zu entwickeln, die dem Übergangsprozess gerecht wird. Es wird der Widerspruch zwischen dem Titel ("Arbeit mit geistig Behinderten im inklusiven Deutschunterricht") und dem Ideal der Dekategorisierung in der Inklusion thematisiert. Die Arbeit konzentriert sich auf die praktische Umsetzung inklusiven Unterrichts und bietet Hilfestellungen für Lehrkräfte. Der Bezug zum Deutschunterricht wird hergestellt, indem die Anforderungen an den modernen Deutschunterricht (Sprachförderung, Medienkompetenz etc.) in einem heterogenen Klassenzimmer beleuchtet werden.
2. Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Inklusion in Deutschland, ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention. Es analysiert den Aufbau des inklusiven Bildungssystems, wobei das "Doppelsystem" aus Regel- und Sonderschulen als Hindernis für eine umfassende Inklusion dargestellt wird. Die Übergangsphase zur Inklusion und die damit verbundenen Herausforderungen werden detailliert beschrieben. Das Kapitel untersucht kritisch die Herausforderungen und das Spannungsfeld zwischen dem theoretischen Ideal der Inklusion und seiner praktischen Umsetzung im deutschen Kontext.
3. Umsetzung eines inklusiven Unterrichts in der Schule: Dieses Kapitel widmet sich der praktischen Umsetzung inklusiven Unterrichts. Es betont die Bedeutung der Heterogenität und die Notwendigkeit innerer Differenzierung und Individualisierung im Unterricht. Differenzierender Unterricht, verschiedene Aufgabenstellungen und Lernziele sowie individuelle Förderung und Team-Teaching werden als wichtige Strategien für inklusiven Unterricht vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Methoden und Strategien, die den Bedürfnissen aller Schüler gerecht werden, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen.
4. Die Unterrichtseinheit – Konzeption und Differenzierungsmöglichkeiten: Das Herzstück der Arbeit ist die detaillierte Beschreibung und Konzeption einer Unterrichtseinheit im Deutschunterricht. Das Kapitel erläutert den Anspruch an den Deutschunterricht, die Lehr-Lern-Voraussetzungen, Lerninhalte und -ziele sowie den Unterrichtsverlauf mit seinen Differenzierungsmöglichkeiten. Die Einbindung und Unterstützung zweier fiktiver geistig behinderter Schüler, Björn und Lisa, spielt eine zentrale Rolle in der Darstellung der praktischen Umsetzung inklusiven Unterrichts. Das Kapitel zeigt exemplarisch, wie inklusiver Unterricht gestaltet werden kann und wie die Bedürfnisse aller Schüler berücksichtigt werden können.
Schlüsselwörter
Inklusion, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Geistige Behinderung, inklusive Pädagogik, Differenzierung, Individualisierung, Unterrichtseinheit, Heterogenität, UN-Behindertenrechtskonvention, Team-Teaching, sonderpädagogische Förderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Arbeit mit geistig Behinderten im inklusiven Deutschunterricht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Inklusion im Deutschunterricht der Sekundarstufe I, insbesondere die Arbeit mit geistig behinderten Schülern im Kontext des Übergangs zu einem inklusiven Schulsystem. Sie entwickelt eine konkrete Unterrichtseinheit, die die Bedürfnisse heterogener Lerngruppen berücksichtigt und Hilfestellungen für Lehrkräfte bietet. Ein zentrales Thema ist das Spannungsfeld zwischen dem Ideal der Inklusion und der Realität des deutschen Schulsystems.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die gesetzlichen Grundlagen der Inklusion, die Umsetzung inklusiven Unterrichts (mit Fokus auf innere Differenzierung und Individualisierung), die Entwicklung und Konzeption einer differenzierten Unterrichtseinheit im Deutschunterricht sowie praktische Hilfestellungen für Lehrkräfte im Umgang mit heterogenen Lerngruppen. Der Widerspruch zwischen dem Titel und dem Ideal der Dekategorisierung in der Inklusion wird ebenfalls thematisiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Zielsetzung, Problemstellung, Aufbau), Inklusion (gesetzliche Grundlagen, Aufbau des inklusiven Bildungssystems), Umsetzung inklusiven Unterrichts (innere Differenzierung, Individualisierung), die detaillierte Beschreibung einer Unterrichtseinheit im Deutschunterricht (mit Differenzierungsmöglichkeiten) und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche konkreten Hilfestellungen bietet die Arbeit für Lehrkräfte?
Die Arbeit bietet eine detaillierte Konzeption einer differenzierten Unterrichtseinheit im Deutschunterricht, die exemplarisch zeigt, wie inklusiver Unterricht gestaltet werden kann und wie die Bedürfnisse aller Schüler, auch derer mit geistiger Behinderung, berücksichtigt werden können. Sie erläutert Methoden und Strategien der inneren Differenzierung und Individualisierung sowie die Bedeutung von Team-Teaching und individueller Förderung.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die UN-Behindertenrechtskonvention bildet die gesetzliche Grundlage für die Inklusion in Deutschland und wird in der Arbeit ausführlich behandelt. Sie dient als Ausgangspunkt für die Analyse des Aufbaus des inklusiven Bildungssystems und der damit verbundenen Herausforderungen.
Wie wird das „Doppelsystem“ aus Regel- und Sonderschulen behandelt?
Das „Doppelsystem“ wird als Hindernis für eine umfassende Inklusion dargestellt. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der Übergangsphase zur Inklusion und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung inklusiver Prinzipien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Geistige Behinderung, inklusive Pädagogik, Differenzierung, Individualisierung, Unterrichtseinheit, Heterogenität, UN-Behindertenrechtskonvention, Team-Teaching, sonderpädagogische Förderung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Lehrkräfte der Sekundarstufe I, die sich mit den Herausforderungen des inklusiven Unterrichts auseinandersetzen und praktische Hilfestellungen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen suchen. Sie ist insbesondere für Lehrer relevant, die Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten.
- Quote paper
- Carina Zebrowski (Author), 2013, Arbeit mit geistig Behinderten im inklusiven Deutschunterricht der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267137