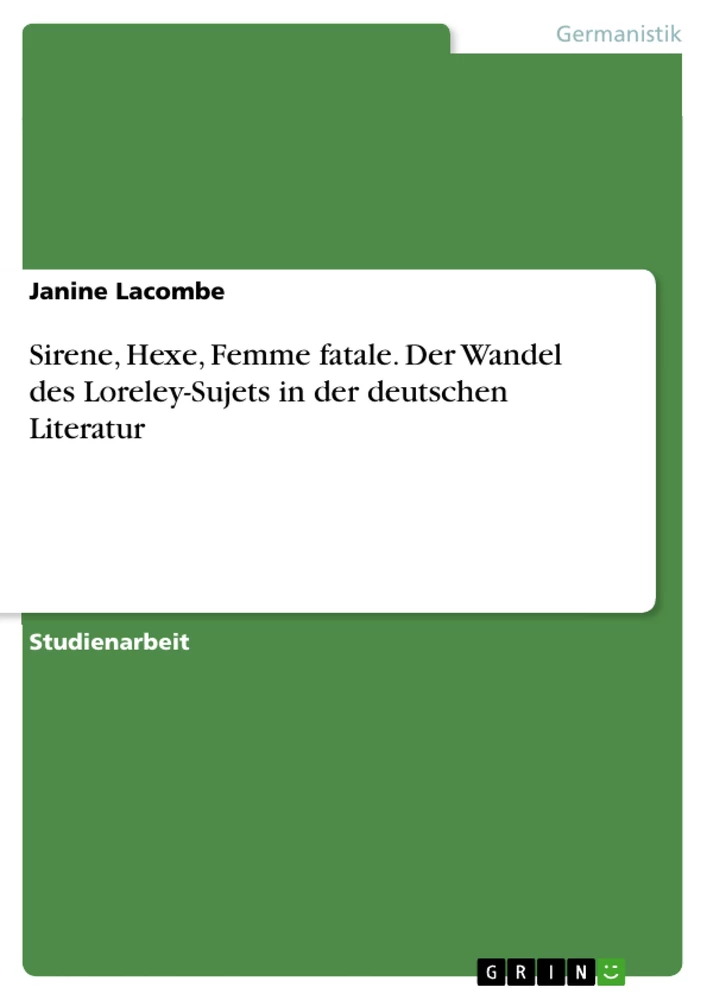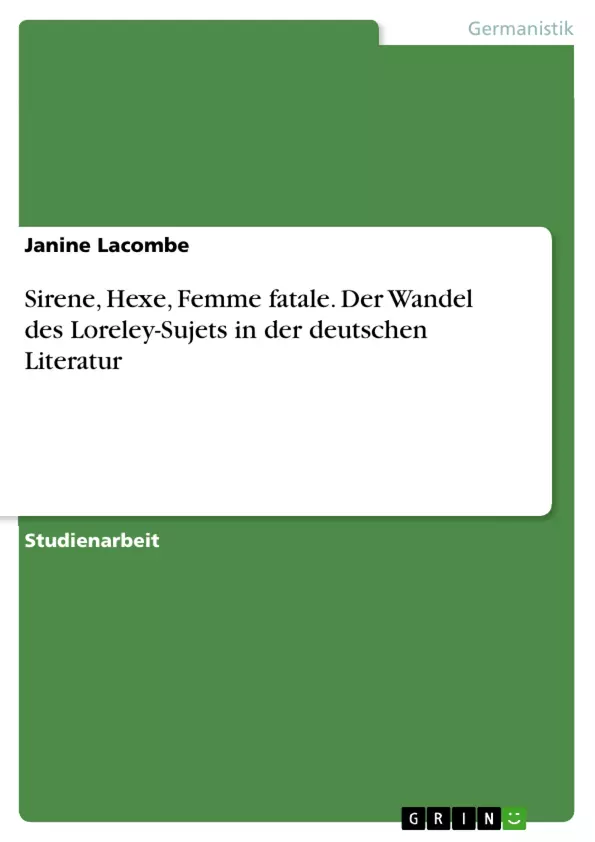Das an Sagen und Geschichten reiche Rheintal bietet bereits seit Jahrhunderten eine Vielzahl an Stoffen, die geeignet zur Legendenbildung sind. Das wohl bekannteste Beispiel einer solchen Mystifizierung ist ein am Rhein gelegener, 132 Meter hoher Schieferfels nahe St. Goarshausen, welcher um 1800 aus dem Geist der Rheinromantik heraus von Clemens Brentano (s)eine Stimme erhielt. Was alter Sagenwelt zu entstammen scheint, ist jedoch eine literarische Erfindung des Dichters Brentano. Er personifizierte den für sein Echo bekannten Fels „Lurley“ oder Elfenstein zu einer „sie“ und schenkte somit der Literatur das neue Sujet der Loreley-Gestalt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Komposition des Loreley-Themas als literarisches Motiv und dessen Wandel in der deutschen Literatur auseinander. Exemplarisch für den Verlauf der Motivkette vom romantischen Thema hin zur Gestaltung eines Klischees werden verschiedene wichtige literarische Verarbeitungen des Sujets vorgestellt, um die manifestierten Wesensfacetten der Loreley bestimmen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der Arbeit
- Allgemeine Vorgehensweise
- Forschungsüberblick
- Ältere Forschungen
- Jüngere Forschungen
- Vom Fels zum Mythos - Genese einer Kunstfigur
- Brentanos Schöpfung – Gestaltung des Loreley-Motivs
- Die verführerische Schönheit der Loreley
- Die Loreley-Landschaft
- Stereotype Stoffelemente des Loreley-Motivs
- Mögliche literarische Einflüsse
- Adaptionen
- Kontamination – Brentanos Verarbeitung literarischer Vorbilder
- Die Loreley - Ein Kind der Romantik
- Brentanos Zu Bacharach am Rheine
- Die Lore Lay-Ballade im Kontext des Godwi
- Die „Lore Lay“
- Verarbeitung und Bedeutung des Echomythos
- Brentanos Rheinmärchen
- Die Figur der Frau Lureley im Kontext des Märchens
- Frau Lureley – eine Loreley-Gestalt
- Die Lorelei Eichendorffs
- Die „Hexe Lorelei“ in dem Gedicht Waldgespräch
- Verarbeitung des Loreley-Motivs in der Figur der Gräfin Romana
- Die Dichotomie von Natur (Weiblichkeit) und Kultur (Männlichkeit)
- Von der romantischen Allegorie zum Klischee - Der Wandel des Loreley-Motivs
- Die romantische Allegorie
- Die allegorische Funktion Romanas in Eichendorffs Ahnung und Gegenwart
- Der Weg zum Klischee
- Heines Ich weiß nicht was soll es bedeuten
- Die Lore-Ley
- Intentionen und ihre Fehldeutungen
- Ironisierung und Politisierung der Loreley-Gestalt
- Kästner stellt die Loreley auf den Kopf
- Politisierung des Sujets bei Erich Kästner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Loreley-Motivs in der deutschen Literatur. Der Fokus liegt auf der Genese des Motivs bei Clemens Brentano und dessen Wandlung vom romantischen Thema zum Klischee. Die Arbeit analysiert verschiedene literarische Adaptionen, um die Wesensfacetten der Loreley zu bestimmen und deren Entwicklung über die Epochen hinweg zu verstehen.
- Genese des Loreley-Motivs bei Clemens Brentano
- Einflüsse auf die Gestaltung des Motivs
- Wandlung des Motivs von der romantischen Allegorie zum Klischee
- Fehldeutungen und Politisierung des Loreley-Motivs
- Epochenübergreifende Entwicklung des Motivs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Loreley-Motiv als literarische Erfindung Brentanos vor und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Genese und des Wandels des Motivs in der deutschen Literatur. Die Arbeit verfolgt exemplarisch den Weg des Motivs von der romantischen Allegorie bis hin zum Klischee, wobei verschiedene literarische Adaptionen analysiert werden, um die Wesensfacetten der Loreley zu bestimmen. Die methodische Vorgehensweise, beginnend mit einem Forschungsüberblick, wird ebenfalls skizziert.
Forschungsüberblick: Dieses Kapitel differenziert die Forschung zum Loreley-Sujet in ältere, positivistische und jüngere, verständnisorientierte Ansätze. Die ältere Forschung konzentrierte sich primär auf die Herkunft der Loreley und tendierte dazu, ihren Ursprung in der deutschen Sagenwelt zu verorten, oft ohne Brentanos literarische Schöpfung kritisch zu hinterfragen. Der Beitrag beleuchtet die unterschiedlichen Sichtweisen und Bewertungen des Loreley-Motivs in der Forschung.
Vom Fels zum Mythos - Genese einer Kunstfigur: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Gestaltung des Loreley-Motivs bei Clemens Brentano. Es analysiert, wie Brentano verschiedene Quellen assimilierte, um seine Loreley zu gestalten. Die Kapitel beleuchtet die Ballade "Zu Bacharach am Rheine" und die Rolle der Loreley in Brentanos Märchen, unter Berücksichtigung von literarischen Einflüssen und Adaptionen.
Die Loreley - Ein Kind der Romantik: Dieses Kapitel analysiert die Loreley im Kontext der Romantik, fokussiert auf Brentanos Werke ("Zu Bacharach am Rheine" und die Rheinmärchen) und Eichendorffs Darstellung. Es untersucht die literarischen und kulturellen Einflüsse der Romantik auf die Gestaltung und Entwicklung des Motivs und erörtert die Verbindung zwischen dem Echomythos, der Loreley und der romantischen Ästhetik.
Von der romantischen Allegorie zum Klischee - Der Wandel des Loreley-Motivs: Dieses Kapitel untersucht die Wandlung des Loreley-Motivs von der romantischen Allegorie zur Ironisierung und Politisierung. Es analysiert Heines Gedicht "Ich weiß nicht was soll es bedeuten" und dessen Fehldeutungen. Ferner betrachtet es die kritische und satirische Verarbeitung des Motivs bei Erich Kästner, beleuchtend dessen Umdeutung des romantischen Bildes.
Schlüsselwörter
Loreley, Clemens Brentano, Romantik, Allegorie, Klischee, literarische Adaption, Motivgeschichte, Heine, Eichendorff, Kästner, Mythos, Sagenwelt, Rheinromantik, Politisierung, Ironisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Vom Fels zum Mythos - Die Entwicklung des Loreley-Motivs in der deutschen Literatur"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Loreley-Motivs in der deutschen Literatur. Der Fokus liegt dabei auf der Genese des Motivs bei Clemens Brentano und dessen Wandlung vom romantischen Thema zum Klischee. Verschiedene literarische Adaptionen werden analysiert, um die Wesensfacetten der Loreley und deren Entwicklung über die Epochen hinweg zu verstehen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Genese des Loreley-Motivs bei Clemens Brentano, die Einflüsse auf die Gestaltung des Motivs, die Wandlung vom romantischen Symbol zum Klischee, Fehldeutungen und Politisierungen des Motivs sowie die epochenübergreifende Entwicklung.
Welche Autoren und Werke werden untersucht?
Die Arbeit analysiert vor allem die Werke von Clemens Brentano (z.B. "Zu Bacharach am Rheine", Rheinmärchen), Joseph von Eichendorff (z.B. "Waldgespräch", "Ahnung und Gegenwart") und Heinrich Heine ("Ich weiß nicht, was soll es bedeuten"), sowie die kritische Auseinandersetzung mit dem Motiv bei Erich Kästner.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Forschungsüberblick, ein Kapitel zur Genese des Loreley-Motivs bei Brentano, ein Kapitel zur Loreley in der Romantik, und ein Kapitel zum Wandel des Motivs bis hin zur Ironisierung und Politisierung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst. Ein Inhaltsverzeichnis und ein Stichwortverzeichnis sind enthalten.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert literarische Texte, um die Entwicklung des Loreley-Motivs nachzuvollziehen. Sie vergleicht verschiedene Interpretationen und beleuchtet den historischen Kontext, um die Wandlung des Motivs zu erklären. Der Forschungsüberblick zeigt die Entwicklung der Loreley-Forschung auf.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit zeigt, wie das Loreley-Motiv von Brentano geschaffen und im Laufe der Zeit von verschiedenen Autoren unterschiedlich interpretiert und verwendet wurde. Sie verdeutlicht den Wandel vom romantischen Symbol zu einem oft missverstandenen und politisch instrumentalisierten Klischee.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Loreley-Motiv eine vielschichtige Geschichte hat, die von seiner ursprünglichen romantischen Bedeutung bis hin zu heutigen Interpretationen reicht. Die vielseitigen Adaptionen des Motivs spiegeln die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen wider.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für deutsche Literatur, die Romantik und die Motivgeschichte interessieren. Sie ist insbesondere für Studierende der Germanistik und Literaturwissenschaft relevant.
Wo finde ich weitere Informationen zum Loreley-Motiv?
Die Arbeit enthält ein Literaturverzeichnis mit weiteren Quellen zur Vertiefung des Themas. Zusätzlich werden im Text relevante Werke und Forschungsliteratur genannt.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Loreley, Clemens Brentano, Romantik, Allegorie, Klischee, literarische Adaption, Motivgeschichte, Heine, Eichendorff, Kästner, Mythos, Sagenwelt, Rheinromantik, Politisierung, Ironisierung.
- Arbeit zitieren
- Janine Lacombe (Autor:in), 2012, Sirene, Hexe, Femme fatale. Der Wandel des Loreley-Sujets in der deutschen Literatur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267174