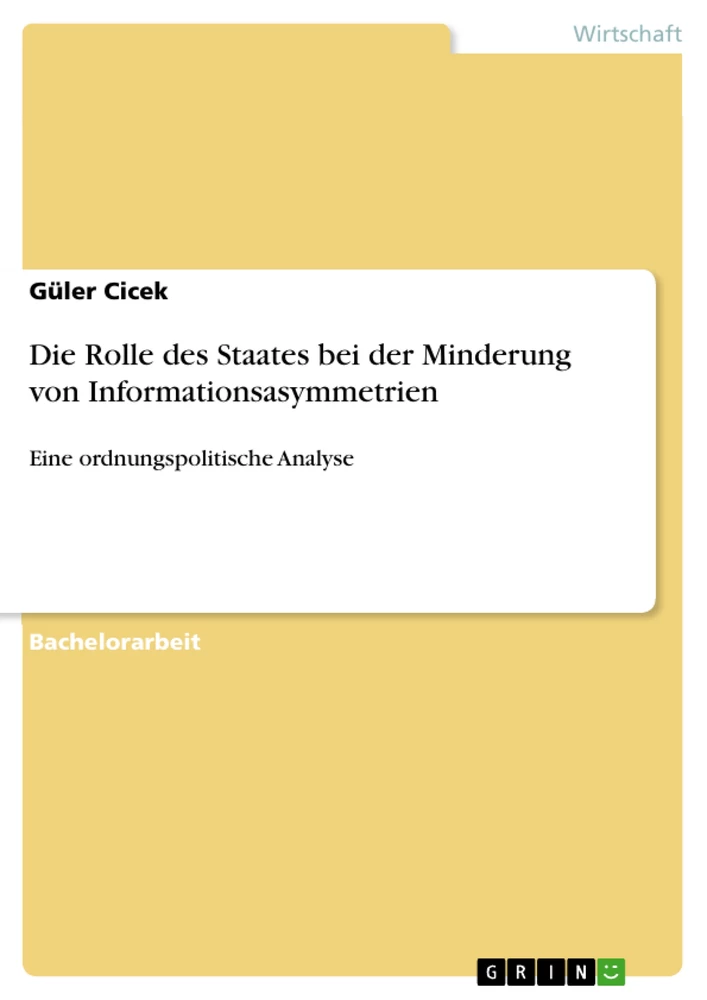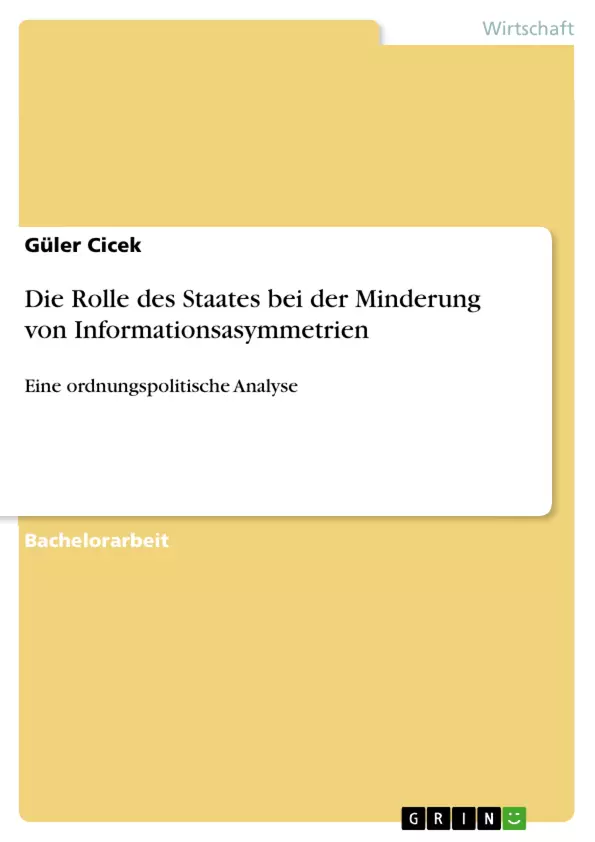Der Lebensmittelbranche sowie der staatlichen Lebensmittel- bzw. Verbraucherpolitik kommt eine hohe Verantwortung zu, um die Konsumenten mit einwandfreien Lebensmitteln zu versorgen, die zumindest den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
In den vergangenen Jahren gab es augenscheinlich eine starke Häufung von Lebensmittelskandalen.
Meistens sind diese in der Lebensmittelindustrie durch vorsätzliche oder zumindest fahrlässige Nichtbeachtung bestimmter Vorgaben begründet. Dabei erzielen die Lebensmittelhersteller enorme Kosteneinsparungen durch Missachtung von Qualitätsvorgaben und diversen gesetzlichen Regelungen.
Die Lebensmittelhersteller, die Verbraucherpolitik mitsamt den damit verknüpften Kontrollinstanzen
und die Konsumenten stehen hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit in einem Beziehungsgeflecht, das durch gegenseitige Informationsasymmetrien gekennzeichnet ist. Die Lebensmittelhersteller, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, wissen üblicherweise
um ihr Vergehen und haben Kenntnis über die staatlichen bzw. gesetzlichen Maßnahmen. Sie wissen jedoch nicht, ob ihr Verstoß entdeckt und geahndet wird. Die Verbraucherpolitik und die Kontrollinstanzen wissen nicht, welche Hersteller gegen Gesetze verstoßen, sodass
hauptsächlich die Möglichkeit besteht, mit präventiv ausgerichteten Gesetzen und Vorgaben sowie mit stichprobenhaften Kontrollen die Lebensmittelsicherheit zu erhöhen. Die Verbraucher wissen zwar, dass Qualitätsverstöße vorkommen, haben aber ex ante keine
Informationen darüber, welche Lebensmittel belastet sind, und können nur darauf vertrauen, dass der Staat – und in untergeordnetem Maße private Institutionen – Qualitätsverstöße rechtzeitig und umfassend aufdecken.
Es ist ersichtlich, dass die größte Informationsasymmetrie zwischen den Lebensmittelproduzenten und den Konsumenten besteht. Diese Informationsasymmetrie ist einer der vielen Konfliktpunkte in der Verbraucherpolitik, bei dem der Staat mit ordnungspolitischen Instrumenten eingreifen muss [vgl. Ahlheim (2011, S.5)].
Dabei stellt sich die Frage: Ist es für die Lebensmittelproduzenten tatsächlich so einfach, die
Verbraucher zu täuschen und die staatlichen Regulierungen zu hintergehen, und warum werden Vergehen häufig erst dann entdeckt, wenn es schon fast zu spät ist, um Schaden
vom Verbraucher abzuwenden?[...]
Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- Symbolverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Prinzipal-Agenten-Theorie
- 2.1 Das Standard Modell
- 2.1.1 Das Grundmodell
- 2.1.2 First-Best-Lösung
- 2.1.3 Second-Best-Lösung
- 2.2 Informationsökonomik
- 2.2.1 Moral Hazard
- 2.2.2 Adverse Selektion
- 2.2.3 Hidden-lnformation-Modell
- 2.3 Ansatz der Mechanismus-Design-Theorie
- 2.1 Das Standard Modell
- 3. Allgemeine ordnungspolitische Rolle des Staates
- 4. Rolle des Staates bezüglich dem Abbau von Informations-Asymmetrien in der Lebensmittelproduktion
- 4.1 Akteure
- 4.1.1 Die Hersteller/Produzenten
- 4.1.2 Die Verbraucher/Konsumenten
- 4.1.3 Der Staat
- 4.2 Effekt der Informationsasymmetrien auf die soziale Wohlfahrt
- 4.3 Wirkung des staatlichen Eingriffs — Mechanismus-Design-Theorie
- 4.1 Akteure
- 5. Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Rolle des Staates bei der Minderung von Informationsasymmetrien. Der Fokus liegt dabei auf der Lebensmittelproduktion und den Informationsasymmetrien zwischen Herstellern und Verbrauchern. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen der Informationsasymmetrien anhand der Prinzipal-Agenten-Theorie und der Informationsökonomik. Darüber hinaus werden die Folgen von Informationsasymmetrien für die soziale Wohlfahrt betrachtet und die Wirkung staatlicher Eingriffe im Sinne der Mechanismus-Design-Theorie untersucht.
- Prinzipal-Agenten-Theorie
- Informationsasymmetrien in der Lebensmittelproduktion
- Rolle des Staates in der Verbraucherpolitik
- Effekt von Informationsasymmetrien auf die soziale Wohlfahrt
- Mechanismus-Design-Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Prinzipal-Agenten-Theorie, die die Grundlage für das Verständnis von Informationsasymmetrien liefert. Anhand des Standard-Modells wird das Problem der Beziehung zwischen Prinzipal und Agent dargestellt und eine formale Situationsanalyse durch das Grundmodell vorgestellt. Die First-Best- und Second-Best-Lösungen werden erläutert, um die Problematik der Informationsasymmetrie zu verdeutlichen. Die Informationsökonomik und das Hidden-lnformation-Modell werden im weiteren Verlauf des Kapitels vorgestellt. Der Ansatz der Mechanismus-Design-Theorie wird ebenfalls skizziert, wobei das Zeuthen-Harsanyi Modell als Beispiel für die Gestaltung optimaler Lösungen durch spezifische Rahmenbedingungen dient.
Das dritte Kapitel widmet sich den Grundzügen der ökonomischen Theorie des Staates. Die Aufgaben des Staates sowie wichtige Instrumente der Ordnungspolitik, die das Ziel der Minderung von Informationsasymmetrien haben, werden näher betrachtet.
Im vierten Kapitel wird die Problematik der Informationsasymmetrien in der Lebensmittelproduktion analysiert. Die Akteure, ihre Funktionen und Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Informationsasymmetrie werden aufgezeigt. Die Folgen der Informationsasymmetrie für die soziale Wohlfahrt und die Wirkung des staatlichen Eingriffs im Sinne der Mechanismus-Design-Theorie werden ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Womit befasst sich diese Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Staates bei der Minderung von Informationsasymmetrien, insbesondere in der Lebensmittelproduktion zwischen Herstellern und Verbrauchern.
Was ist die Prinzipal-Agenten-Theorie?
Es ist ein theoretisches Modell, das die Beziehung zwischen einem Auftraggeber (Prinzipal) und einem Auftragnehmer (Agent) analysiert, wenn ungleiche Informationen vorliegen.
Warum gibt es Informationsasymmetrien bei Lebensmitteln?
Hersteller wissen oft um Qualitätsmängel oder Gesetzesverstöße, während Verbraucher diese Informationen vor dem Kauf nicht haben und auf staatliche Kontrollen vertrauen müssen.
Welche Rolle spielt der Staat laut diesem Dokument?
Der Staat greift mit ordnungspolitischen Instrumenten und präventiven Gesetzen ein, um die Lebensmittelsicherheit zu erhöhen und die soziale Wohlfahrt zu schützen.
Was ist die Mechanismus-Design-Theorie?
Ein Ansatz zur Gestaltung von Rahmenbedingungen, die trotz privater Informationen zu optimalen sozialen Ergebnissen führen sollen.
Was sind Moral Hazard und Adverse Selektion?
Dies sind Konzepte der Informationsökonomik, die beschreiben, wie Fehlverhalten nach Vertragsabschluss (Moral Hazard) oder eine schlechte Auswahl vorab (Adverse Selektion) durch ungleiche Informationen entstehen.
- Quote paper
- Güler Cicek (Author), 2013, Die Rolle des Staates bei der Minderung von Informationsasymmetrien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267188