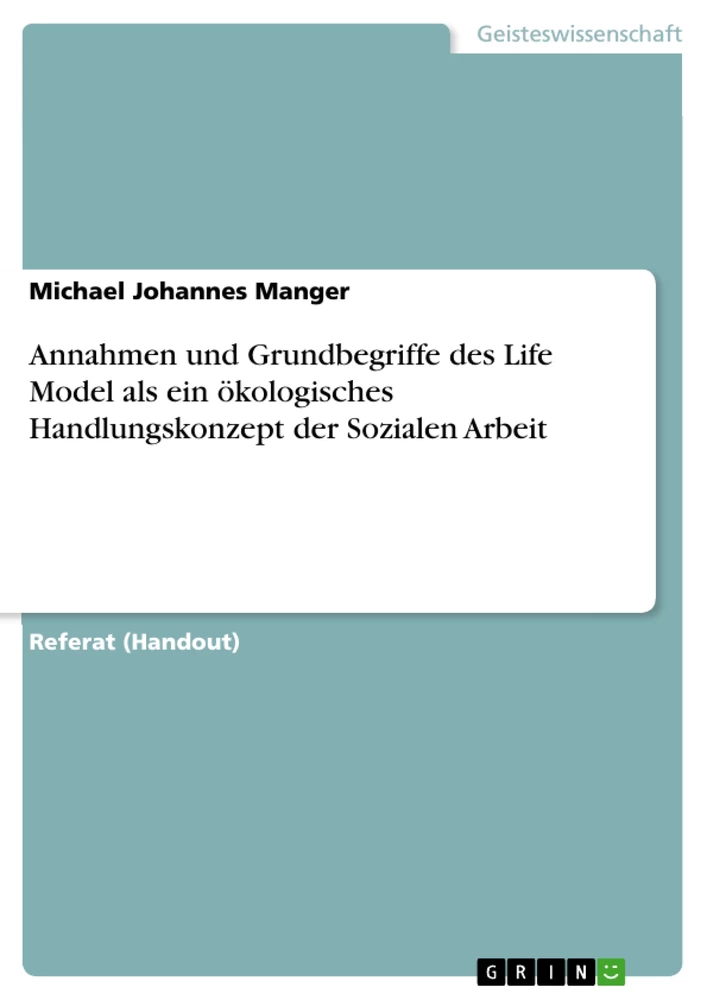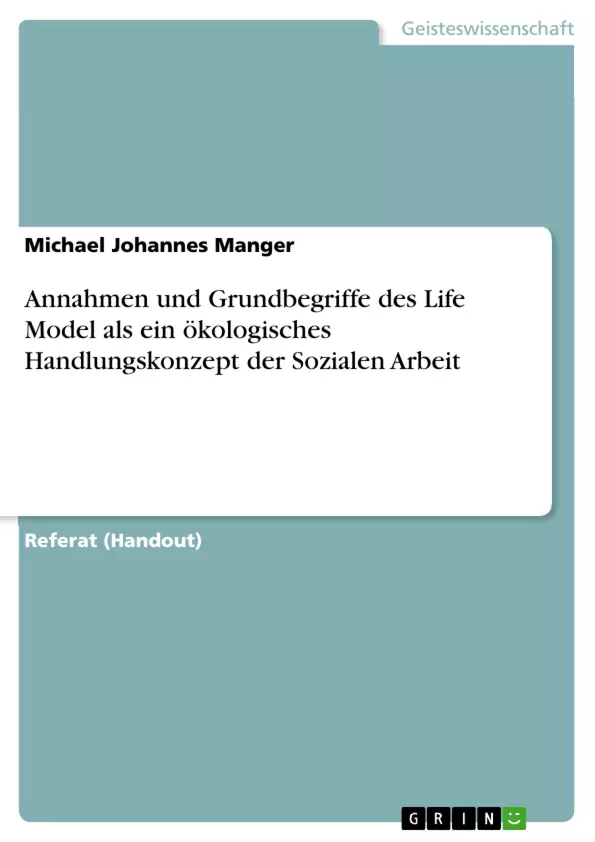Das „Life Model“ wurde Anfang der 80er Jahre von den US-amerikanischen Sozialwissenschaftlern Carel B. Germain und Alex Gittermann in Ihrem Werk „Praktische Sozialarbeit - Das „Life Model“ der Sozialen Arbeit“ niedergelegt. Im Folgenden sollen die ökologischen Annahmen und Begriffe des „Life Model“ Ausführungen finden.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Der ökologische Ansatz der Sozialen Arbeit
- Der Begriff „Ökologie“
- Die Bedeutung der ökologisch orientierten Sozialen Arbeit
- Grundlegende Annahmen und Begriffe des „Life Model“
- Der Mensch lebt in einer materiellen und sozialen Umwelt
- Die Bedeutung der „Transaktion“
- Die „Nische“, der soziale Standort des Menschen
- Das „Habitat“ als ein Teil der ökologischen Perspektive
- Der „Lebens-Stress“ im „Life Model“
- „Coping“ und „Lebens Stress“
- Allgemeine Vorgehensweise in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Grundbegriffe und Annahmen des „Life Model“ als ökologisches Handlungskonzept in der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung des ökologischen Ansatzes im Kontext der Sozialen Arbeit und zeigt die Bedeutung der Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt auf.
- Der ökologische Ansatz in der Sozialen Arbeit
- Die zentralen Annahmen des „Life Model“
- Die Bedeutung der „Transaktion“ und des „Lebens-Stresses“ im „Life Model“
- Das „Habitat“ und die „Nische“ als wichtige Konzepte im „Life Model“
- Die praktische Anwendung des „Life Model“ in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt den Entstehungshintergrund der Arbeit. Es werden die zentralen Fragen, die im Kontext des „Life Model“ behandelt werden, erläutert. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem ökologischen Ansatz der Sozialen Arbeit und analysiert den Begriff „Ökologie“ sowie die Bedeutung der ökologisch orientierten Sozialen Arbeit. Das dritte Kapitel beleuchtet die Grundannahmen und zentralen Begriffe des „Life Model“. Es werden die Bedeutung der materiellen und sozialen Umwelt, die „Transaktion“, die „Nische“ und das „Habitat“ sowie der „Lebens-Stress“ im „Life Model“ dargestellt. Das vierte Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung des „Life Model“ in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Schlüsselbegriffe des „Life Model“ im Kontext der Sozialen Arbeit. Zu den wichtigsten Begriffen zählen: ökologischer Ansatz, „Transaktion“, „Lebens-Stress“, „Nische“, „Habitat“, Person-Umwelt-Beziehung, „Coping“, soziale und materielle Umwelt, Lebensereignisse, Interventionen, Anpassungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 'Life Model' in der Sozialen Arbeit?
Das Life Model ist ein ökologisch orientiertes Handlungskonzept, das die Wechselwirkungen zwischen dem Menschen und seiner Umwelt in den Fokus rückt.
Was bedeutet der Begriff 'Transaktion' im Life Model?
Transaktionen bezeichnen die ständigen Austauschprozesse und gegenseitigen Beeinflussungen zwischen einer Person und ihrer materiellen sowie sozialen Umwelt.
Was versteht man unter 'Nische' und 'Habitat'?
Die 'Nische' ist der soziale Standort eines Menschen, während das 'Habitat' den physischen Lebensraum und die Umgebung beschreibt.
Wie definiert das Life Model 'Lebens-Stress'?
Lebens-Stress entsteht durch ein Missverhältnis zwischen Umweltanforderungen und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten (Coping) einer Person.
Wer entwickelte das Life Model?
Es wurde Anfang der 80er Jahre von den US-amerikanischen Sozialwissenschaftlern Carel B. Germain und Alex Gitterman entwickelt.
- Arbeit zitieren
- Diplom Online-Journalist Michael Johannes Manger (Autor:in), 2001, Annahmen und Grundbegriffe des Life Model als ein ökologisches Handlungskonzept der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2673