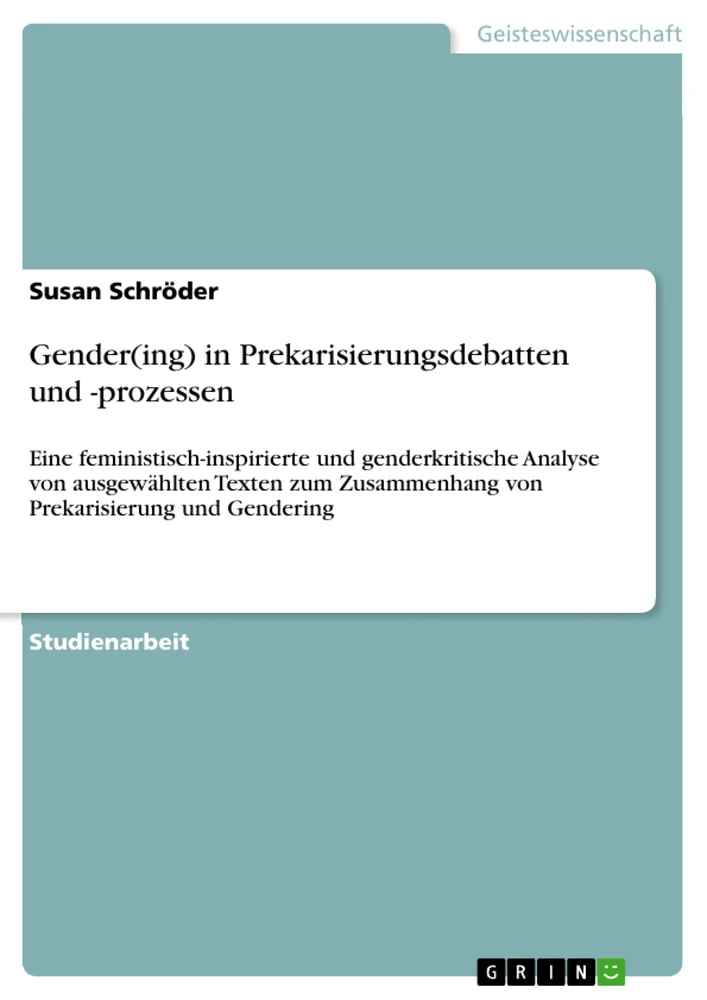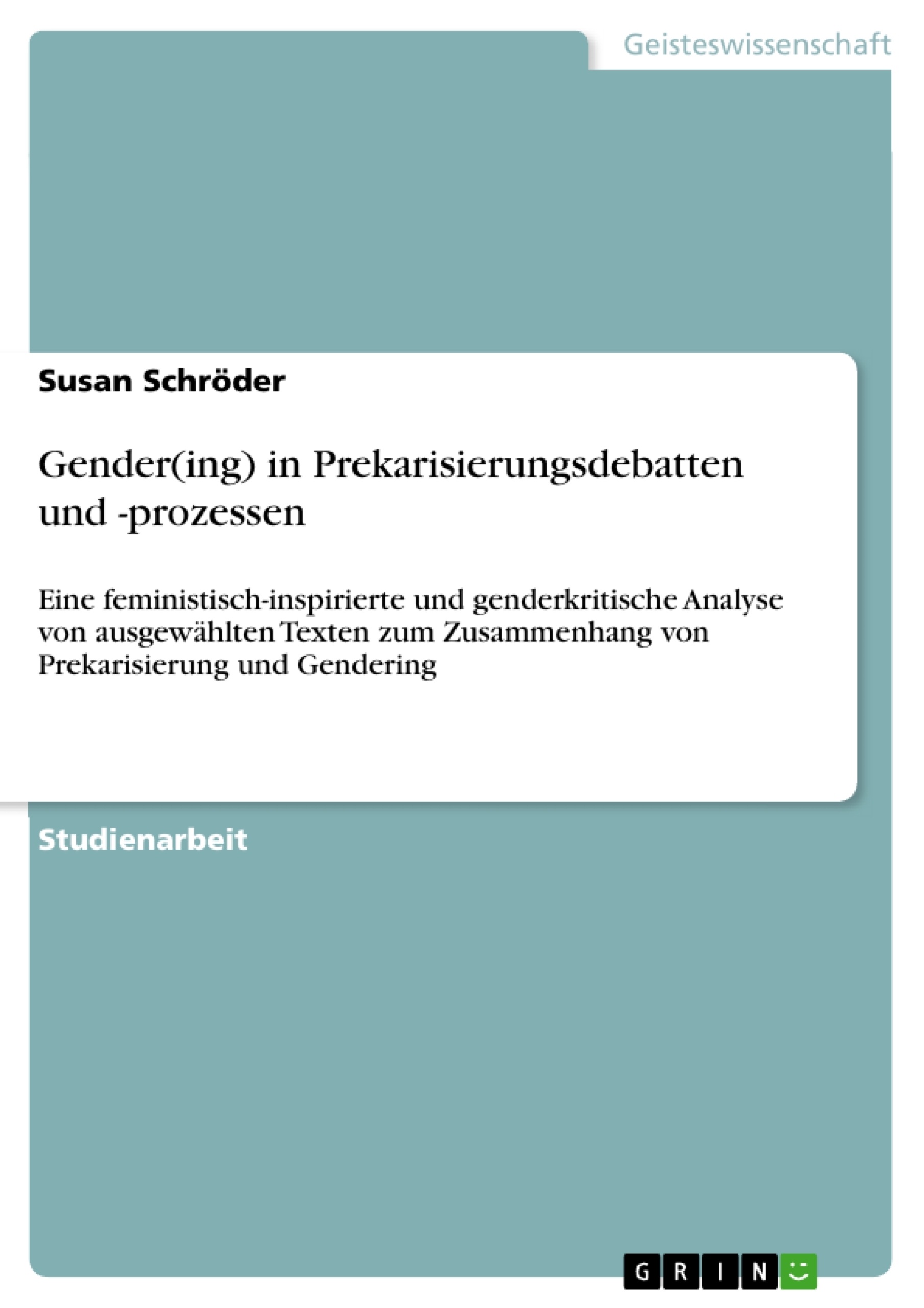In dieser Arbeit geht es um eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Prekarisierung in Zusammenhang gedacht mit konstatierten Transformationsprozessen der Arbeits-, Wohlfahrts- und Genderregime. Ausgangsthese der Arbeit ist, Aulenbacher’s Argumentation folgend, dass in Bezug auf gegenwärtige Transformationsprozesse „[e]in industriesoziologischer Topos“ vorherrscht, der sich von Schwerpunktsetzungen und Theoretisierungen der Frauen- und Geschlechterforschung unterscheidet. Der Topos bezieht sich auf die „malestream“ Ausrichtung und Perspektivierung der Theoretiker und wird in feministischen Theoretisierungen kritisiert, umformuliert und weiter- bzw. anders gedacht. Der noch genauer darzustellende Topos lässt sich als Defizit- bzw. Mangelperspektive beschreiben, insbesondere begründet auf der Zentralsetzung von Integration und Inklusion als ‚Normalzustand des Sozialen‘. Der Arbeit liegt eine genderkritische und feministisch-inspirierte Perspektive zu Grunde. Bei der geht es darum, Wissenskonstruktionen in Bezug auf das Phänomen Prekarisierung hinsichtlich der Konstituierung von Ungleichheitsverhältnissen, Normierungen und Ausblendungen zu analysieren und zu reflektieren. Der hier verwendete Genderbegriff ist interdependent gedacht. D.h. ich gehe davon aus, dass gesellschaftliche Phänomene hierarchisch strukturiert und verschiedene Ungleichheitsverhältnisse in einem je spezifischen Kontext miteinander verwoben und dahingehend zu situieren sind. Zudem ist ein Anliegen dieser Arbeit „vergeschlechtlicht-hierarchisierte und heteronormative Verfügungen zurückzuweisen und das Begehren zu artikulieren, anders in der Welt zu sein“ sowie an der Herstellung, von „gesellschaftlich wünschenswerte[r] Arbeit, der Möglichkeit einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe für Frauen und Männer sowie (…) [der] Herstellung sozialer Gleichheit“ mitzuwirken.
Im Rahmen dieser Arbeit wird einerseits das Phänomen Prekarisierung mit seinen Auswirkungen dargestellt und diskutiert; zum anderen wird es um die Analyse und Reflexion ausgewählter Ausschnitte der Debatte um Prekarisierung gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmung und Begriffsklärung
- Das Normalarbeitsverhältnis (NAV) als hegemoniale Referenzfolie zu Prekarisierung
- Bundesdeutscher Kontext in Modellen und Zahlen
- „Prekarität ist überall“- Bourdieus Konzept von Prekarität als neuem gesellschaftlichem Modus
- Castels,,Wiederkehr der sozialen Unsicherheit“ unter Berücksichtigung feministischer Interventionen und kritischer Theoretisierungen
- Prekariat/Prekarier_innen, eine neue soziale Kategorisierung?
- Feministische Interventionen: Zwischen Anomie und Normalisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Prekarisierung im Kontext von Transformationsprozessen der Arbeits-, Wohlfahrts- und Genderregime. Ziel ist es, die Argumentation von Aulenbacher aufzugreifen und aufzuzeigen, dass die industriesoziologische Perspektive auf Prekarisierung stark von der feministischen und genderkritischen Perspektive abweicht. Die Arbeit will die Defizit- und Mangelperspektive auf Prekarisierung, die auf Integration und Inklusion als Normalzustand des Sozialen fokussiert, aus einer genderkritischen und feministisch-inspirierten Perspektive analysieren und hinterfragen.
- Prekarisierung im Kontext von gesellschaftlichen Transformationsprozessen
- Analyse von Wissenskonstruktionen in Bezug auf Prekarisierung
- Konstituierung von Ungleichheitsverhältnissen, Normierungen und Ausblendungen
- Interdependenz von Gender und Prekarisierung
- Potenzialitäten für Deprivilegierte in sozialen Ungleichheitsverhältnissen und deren Transformationsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung legt den Fokus auf das Phänomen der Prekarisierung und die Notwendigkeit einer genderkritischen Analyse. Sie stellt die Leitfragen der Arbeit vor, die sich mit der Begründung, dem Umfang und der Vergeschlechtlichung von Prekarisierung beschäftigen.
- Kapitel 2: Das Normalarbeitsverhältnis wird als disziplinierendes und diskriminierendes Phänomen betrachtet, das als hegemoniale Referenzfolie zu Prekarisierungsphänomenen dient.
- Kapitel 3: Die Auswirkungen atypischer Erwerbsarbeit und regulärer Beschäftigung in der BRD werden analysiert, wobei der Zusammenhang zwischen der Arbeitsmarktintegration von Frauen und Prekarisierungsprozessen hervorgehoben wird.
- Kapitel 4: Die Analysen von Bourdieu und Castel, die eine Mangelperspektive auf das Phänomen Prekarisierung einnehmen, werden kritisch beleuchtet.
- Kapitel 5: Die Ergebnisse von Bourdieu und Castel werden durch feministische Erkenntnisse konterkariert und diskutiert, wobei die androzentristische Verkürzung und Nicht-Berücksichtigung der Pluralisierung von Lebensformen kritisiert werden.
- Kapitel 6: Die Verantwortung soziologischer Forschung für die Gestaltung und Veränderung der sozialen Wirklichkeit wird hervorgehoben. Ein Handlungs- und Optionenfokus soll Potenzialitäten für Deprivilegierte in sozialen Ungleichheitsverhältnissen und deren Transformationsprozessen schaffen.
Schlüsselwörter
Prekarisierung, Gender(ing), Normalarbeitsverhältnis, atypische Erwerbsarbeit, gesellschaftliche Transformationsprozesse, feministische Theorie, genderkritische Analyse, Ungleichheitsverhältnisse, Wissenskonstruktionen, Deprivilegierte, soziale Wirklichkeit, Handlungsoptionen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Prekarisierung im Arbeitskontext?
Prekarisierung bezeichnet den Prozess, in dem sichere Arbeitsverhältnisse durch unsichere, schlecht bezahlte oder befristete Beschäftigung (atypische Erwerbsarbeit) ersetzt werden.
Welche Rolle spielt Gender bei der Prekarisierung?
Frauen sind überproportional von Prekarisierung betroffen, da Arbeitsmarktstrukturen oft auf einem männlich geprägten "Normalarbeitsverhältnis" basieren und Care-Arbeit ausblenden.
Was ist die Kritik an der "malestream" Soziologie?
Feministische Theorien kritisieren, dass männliche Theoretiker Integration oft nur über Erwerbsarbeit definieren und dabei geschlechtsspezifische Ungleichheiten vernachlässigen.
Was versteht man unter dem "Normalarbeitsverhältnis" (NAV)?
Das NAV ist die hegemoniale Referenzfolie für Vollzeitbeschäftigung, soziale Absicherung und Kontinuität, von der immer mehr Menschen abweichen.
Wie hängen Prekarität und soziale Unsicherheit zusammen?
Prekarisierung führt laut Theoretikern wie Castel und Bourdieu zu einer Wiederkehr der sozialen Unsicherheit, die die gesellschaftliche Teilhabe gefährdet.
- Quote paper
- M.A. Susan Schröder (Author), 2011, Gender(ing) in Prekarisierungsdebatten und -prozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267365