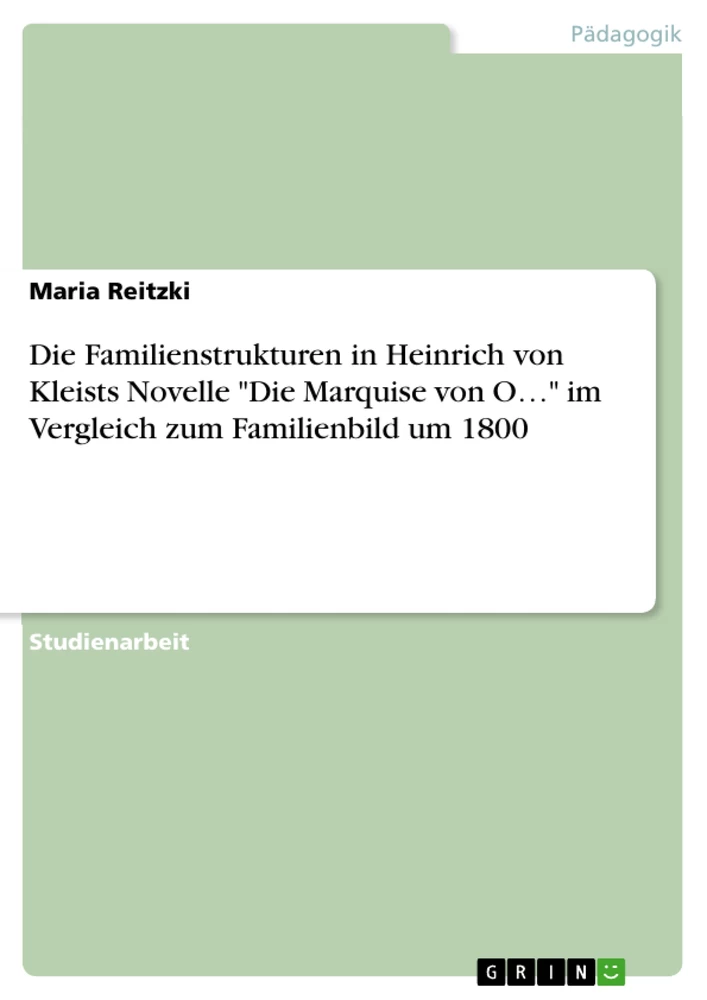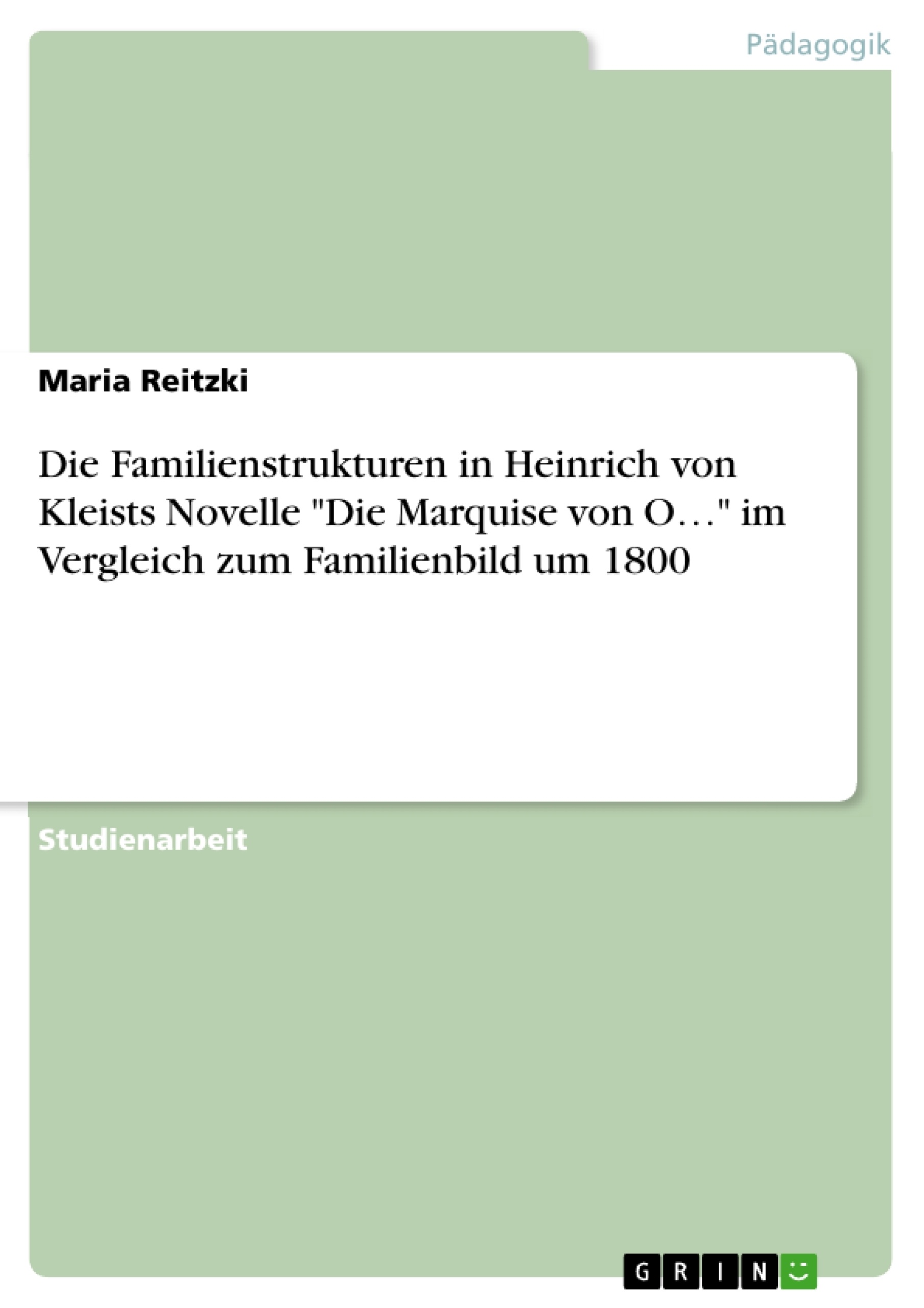„Über das historisch-empirische Familienleben sagen die bürgerlichen Trauerspiele, Rührstücke und Familiengemälde des 18. und 19. Jahrhunderts freilich ebensowenig [sic] aus, wie die als Familiendrama apostrophierten Spielfilme und Seifenopern des ausgehenden 20. Jahrhunderts über den familiären Alltag unserer Zeit. Allerdings geben sie Einblick in die einschlägigen Ordnungsvorstellungen und kulturellen Imaginationen der Menschen in einer Epoche.“
Ist das tatsächlich so? Lassen sich aus literarischen Werken nur so wenige Informationen über das Leben in einer bestimmten Epoche ziehen? In der vorliegenden Arbeit soll dieser nüchternen und resignierten Ansicht Anke Vogels ein anschaulicher Vergleich zwischen dem Familienbild um 1800 und dem dargestellten Familienleben in einer Novelle dieser Zeit entgegengesetzt werden. M. E. lassen sich aus diesem Vergleich nicht nur Rückschlüsse über die ‚einschlägigen Ordnungsvorstellungen’ innerhalb der Lektüre ziehen, sondern dem gegenüber kann sich ebenfalls herauskristallisieren, welche zeitgenössischen Gesellschaftsspezifika ein Autor nicht in seinem Werk verarbeitet hat – aus welchen Gründen auch immer.
Grundlage des nachfolgenden Vergleichs wird die Novelle Die Marquise von O… des damals 30-jährigen Heinrich von Kleist sein, die im Jahre 1808 erschienen ist. Die Handlung der Geschichte spielt sich größtenteils im Rahmen der adeligen Familie von G… ab, wodurch die Familienthematik hier einen besonderen Stellenwert einnimmt.
Der Vergleich mit dem zu Kleists Zeit gängigen Familienbild der Realität wirft diverse Fragen auf: Welche Familienstrukturen gab es um 1800, welche waren vorherrschend? Entspricht die Familie von G… genau diesem Familienbild? Oder hat Kleist in seinem Werk eine für die damalige Zeit veraltete oder aber zukunftsweisende Form des Familienlebens aufgezeigt? Welchen Einfluss hatte die Gesellschaft auf das Familienleben? Die Basis dieser Arbeit soll demnach eine intensive Auseinandersetzung sowohl mit der damals gültigen Familiennorm als auch mit den Moral- und Wertvorstellungen zu Kleists Zeit bilden. Zentral ist hier eine Beschäftigung mit dem familialen Patriarchalismus.
Neben diesem literatursoziologischen Zugang zur dargestellten Familie sollen zum anderen auch die familieninternen Strukturen textanalytisch beleuchtet werden. Welche Rolle spielt der Zusammenhalt innerhalb der Familie? Welche Verhaltensweisen legen die einzelnen Familienmitglieder an den Tag? (...)
Inhalt
1. Einleitung
2. Das Familienbild zu Kleists Zeit
2.1 Zeitliche und gesellschaftliche Bestimmung des Untersuchungsrahmens
2.2 Die Entstehung des Familienbegriffs
2.3 Die patriarchalische Familienstruktur
2.3.1 Der Patriarchalismus als Herrschaftsform
2.3.2 Die Polarisierung von Geschlechtscharakteren
2.3.3 Furcht und Liebe: Die zwei Seiten des Patriarchalismus
2.4 Die Eheschließung im Wandel der Zeit
2.5 Zwischenresümee
3. Das Familienbild in Kleists ‚Die Marquise von O…’
3.1 Die Familiensituation
3.2 Familienbild und -struktur
3.2.1 Die Rolle der Gesellschaft
3.2.2 Der familiale Patriarchalismus
3.3 Das Verfahren der Eheschließung
4. Schluss
5. Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Maria Reitzki (Autor), 2009, Die Familienstrukturen in Heinrich von Kleists Novelle "Die Marquise von O…" im Vergleich zum Familienbild um 1800, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267400