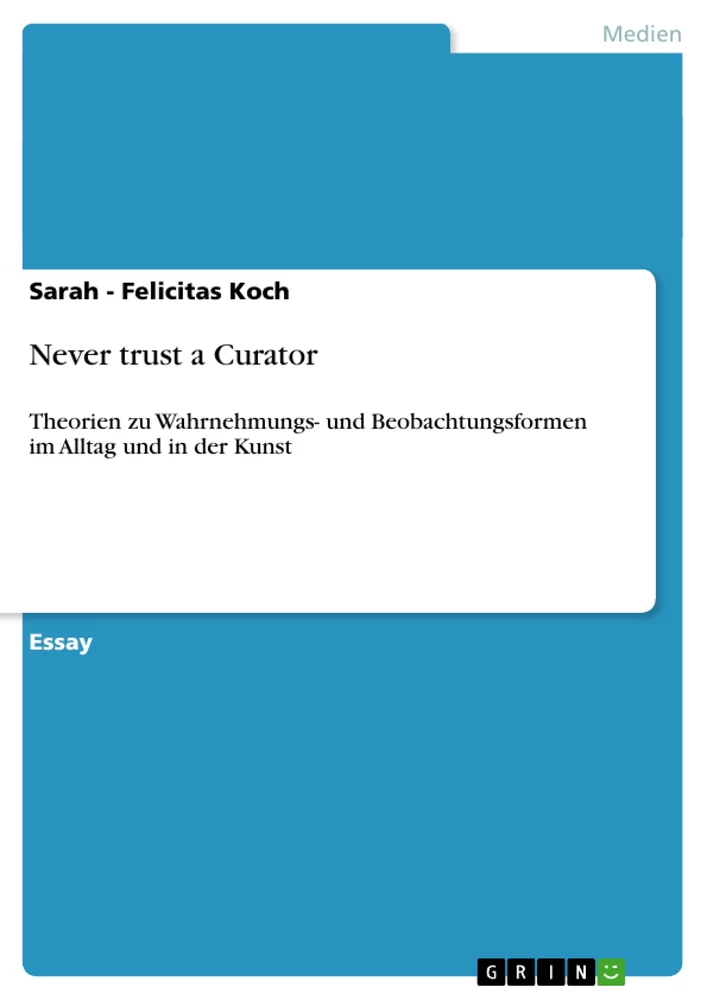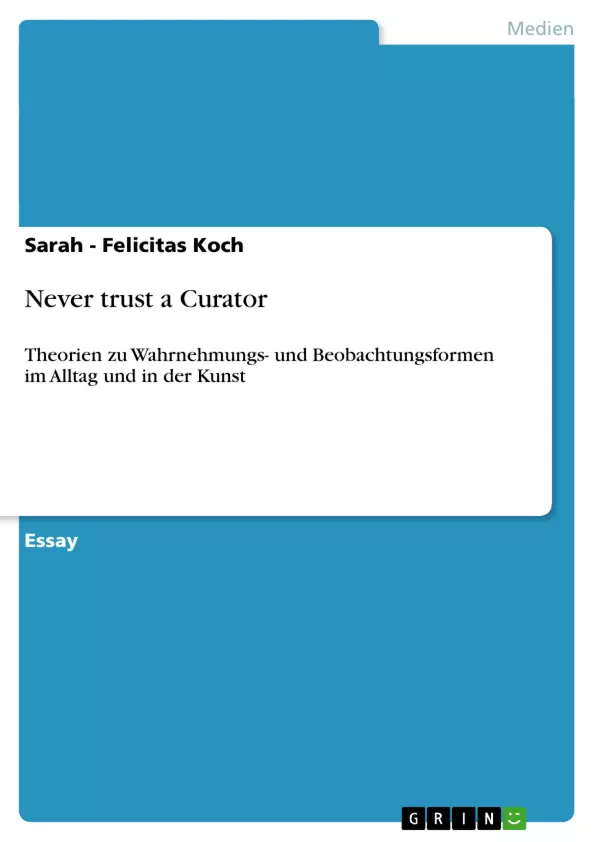Wenn etwas anzusehen ist, spielt die Täuschung mithin eine wesentliche Rolle. Sofern es sich um eine visuelle Betrachtung handelt, führt dies unweigerlich zu der Möglichkeit einer Verschiebung der Realität. »Ich sehe also spinn ich« kann und sollte für Kuratoren geradezu als Aufforderung der optischen Verführung konzeptueller und ästhetisierender Modulation verstanden werden. Was bedeutet dies für das Heldenbild? Bewusst inszenierte Täuschung oder aber Schärfung des Blickes auf ein Sinnbild vom Abbild?
Inhalt
Never trust a Curator Theorien zu Wahrnehmungs- und Beobachtungsformen im Alltag und in der Kunst
Literatur
(Dieses Essay nimmt Bezug auf die vorgestellten Arbeiten der Ausstellung Held - Ich - Superheld; Rechercheausstellung zum Heldischen in unserer Zeit, der Ringvorlesung heroe_s. Der Held im postheroischen Zeitalter, 2013, vom Studium generale Netzwerk Nord, einem Zusammenschluss norddeutscher Hochschulen in Kooperation mit der Universität Hamburg.)
Never trust a Curator Theorien zu Wahrnehmungs- und Beobachtungsformen im Alltag und in der Kunst
Wenn etwas anzusehen ist, spielt die Täuschung mithin eine wesentliche Rolle. Sofern es sich um eine visuelle Betrachtung handelt, führt dies unweigerlich zu der Möglichkeit einer Verschiebung der Realität. »Ich sehe also spinn ich« kann und sollte für Kuratoren geradezu als Aufforderung der optischen Verführung konzeptueller und ästhetisierender Modulation verstanden werden. Was bedeutet dies für das Heldenbild? Bewusst inszenierte Täuschung oder aber Schärfung des Blickes auf ein Sinnbild vom Abbild?
In diesem kurzen Essay wird die Betrachtung als aktives Moment eines Prozesses von Perzeption in unterschiedlichen Ebenen darzustellen versucht. Diese Betrachtung z.B. eines Kunstwerkes oder Artefaktes in einem Betrachtungsgehäuse wie etwa einer Galerie, einem Museum oder Theater, hat grundlegend die Funktion einer aktiven Betrachtungsebene. Wie aber schaut es mit Beobachtungen aus? Sind Betrachtungen eine direkte Auseinandersetzung mit einem Objekt, einem Gemälde, Artefakt oder eines Theaterstückes, so lassen sich Beobachtungen als ein aktiver, jedoch vielfach unbewusster Wahrnehmungsvorgang bezeichnen. Diese Prämisse findet in der soziologischen Gesellschaftstheorie eine Unterschei- dung in Systeme und die auf sie reagierende Umwelt.
In einem stetigen Prozess von Wahrnehmungsvorgängen und Unterscheidungen von, für, gegen und zu etwas Anderem, entstehen unterschiedliche Formen der Betrachtung und der Beobachtung.
Der Soziologe Niklas Luhmann beschäftigte sich in seiner Wahrnehmungs- theorie mit Beobachtungsformen verschiedener Ordnungsprinzipien. Selbst in der Imagination, in Märchenerzählungen, abstrakter Kunst, das 'sich lösen' von etwas Seiendem in etwas Gegenteiliges oder Fremdes, kann nicht von der Anschaulichkeit der Welt und dem Weltlichen tatsäch- lich gelöst werden. Auch in der Täuschung, in der Inszenierung, in der Abstraktion oder Konkretisierung, der Modifikation folgt man noch immer einem Erlebten, das die Welt, wie sie sein könnte, annimmt.[1] In der Rolle der Beobachtung zweiter Ordnung wird die Beobachtung von Beobach- tungen vollzogen. Diese Perspektive erlangt der Beobachter wenn er zwischen einer Beobachtung und z.B. einem Ding unterscheiden kann.
In gewisser Tradition könnte die Unterscheidung von Subjekt und Objekt damit verstanden sein. Wie sieht es im Falle eines Kunstwerkes aus? Luhmann beschreibt in einer Passage über die eigene Erleichterung durch Beobachtung von Beobachtern zu einem Kunstwerk und die Unbeobacht- barkeit der eigenen Operation des Beobachtens, mit einem Vorbehalt wie folgt:
„ Es k ö nnte ja sein, dass man ein Kunstwerk im Hinblick auf die in ihm festgelegte Beobachtung beobachten kann, ohne deswegen auch den K ü nstler zu beobachten; es mag ja gen ü gen, dass man wei ß oder erkennt, dass es sich um ein hergestelltes und nicht um ein nat ü rliches Objekthandelt. [ … ] Mancher K ü nstler mag zwar davon getr ä umt haben, in einer anderen Welt sein Gl ü ck zu machen; aber was er machen kann, beschr ä nkt sich darauf, die Unbeobachtbarkeit der Welt zu reproduzieren “[2]
In seinem Hauptwerk 'Rahmen-Analyse' beschreibt der US-amerikanische Soziologe Erving Goffman die zum Teil anthropologisch begründeten, zum Teil kulturell übergreifenden Situationen sowie damit einhergehende Beobachtungs- und Urteilsformen im alltäglichen Gesellschaftsleben. Auf Situationen wird zwangsläufig immer reagiert. Wie Situationen einge- schätzt, wie sie verstanden werden und welche Schlussfolgerung/ Reaktionen daraus resultieren, wird aufgrund von 'Rahmen' die zu einer Einschätzung einer Situation dienen, unterschiedlicher Abstufungen vorgenommen. Dies geschieht als Reaktion auf etwas, automatisch. Es ist letztendlich eine vermeintlich intuitive, spontane oder zunächst spontane Schlussfolgerung/Reaktion auf etwas Vorherrschendes. Begründet aber in festen Gewohnheiten, Erfahrungen, empirischem Wissen, soziologischen Strukturen, etc. und somit ein Verständnis oder eine Auffassung, zum Beispiel für die Betrachtung und Akzeptanz, oder nicht zuletzt für ein 'Erkennen' eines Kunstwerkes, aus einem zu berücksichtigendem Kontext heraus.[3] Die von Goffman beschriebenen Rahmen, unterschiedlicher Qualität, tragen zur Bestimmung von Situationen bei. Diese können sich auch überschneiden und ineinander verschieben. Wie etwa in Platons Höhlengleichnis, geht es um die dem Menschen sich darstellende Wirklichkeit und 'seine' Realität und die daraus erfolgenden, für ihn realen Wirkungen/ Resultate/ Konsequenzen.
Nicht wirklich/ nicht real sind zum Beispiel Rituale oder Theaterstücke, Aktionskunst als auch Spiel aller Art. Hier findet eine Modulation innerhalb des primären Rahmens statt. Gefahr, Ängste oder Freude werden zwar erlebt, aber in ihrer Erkenntnis nicht als Resultat und Reaktion auf etwas Reales wahrgenommen. Ausgehend vom primären Rahmen, der die Grundierung bildet, existiert ein zweiter, natürlicher oder sozialer Rahmen mit möglicher Modulation oder Täuschung.
„ Urbild und Bild, Kopiertes und Kopie [ … ] Wie auch immer das 'Wirkliche' beschaffen ist, es kann auf diese beiden Weisen ( Modulation und Täuschung ) umgepr ä gt werden. [...] eine Transformation von Transformationen. “[4]
Figuren, die dem Heldischen zugeordnet werden, können aufgrund ihrer Konstruktion niemals autopoietisch oder a priori in Form eines natürlichen Rahmens gesehen oder verstanden werden. Dies, für sämtliche Identifikationsebenen empirisches Wissen vorausgehende, macht es möglich unterschiedliche Formen von 'Bildern' und ihren Bedeutungen zu prägen. Leisten kann dies das Kollektiv, eine Bevölkerung, ein bestimmter Kulturkreis, eine ganze Kulturgeschichte. Betrachtungsweisen werden so, infolge einer Beobachtung für, von, gegen oder zu etwas Neuem in Wahrnehmung und Unterscheidung zu etwas bereits Gewusstem, über- wiegend passiv, beeinflusst.
Betrachtung durch Unterscheidung kann als ein sowohl bewusster Prozess verstanden werden, ihm jedoch geht bereits der Umstand eines unbewussten Vorganges in der Beobachtung voraus.
Ein Heldentopos funktioniert durch eine, nicht aus ihm herausgehende, sondern einer ihm zugeführten 'Bildhaftigkeit'. Ein anthropologisches 'Abbild oder auch Menschenbild' moralischer und ethischer Prämissen.
Der Blick einer Kultur auf ein Heldenbild ist, man könnte auch sagen, kulturell und/ oder universal codiert. Die universale Zeichentheorie, von F. de Saussure, in Anlehnung an die Antroposemiotik, welche menschliche Signale und Zeichen berücksichtigt, ist eine Zeichendefinition und Klassifikation von Charles S. Peirce. Sie bildet einen fundamentalen Bestandteil der Semiotik. Peirce beschreibt die Grundlage seiner Theorie damit, das das gesamte menschliche Denken in Zeichen erfolgt. Dieses ergibt sich daraus, das ein Gedanke auf andere Gedanken verweist und dieses Objektbezogen erfolgt. Ein wesentliches Kriterium seiner Theorie ist die Definition der Zeichen in bestimmte Charakter zwischen Zeichen, Objekten und Bedeutungen. Kein Zeichen fungiert als solches, bevor es nicht einen tatsächlichen, sogenannten Interpretanten hat.[5] Kunstwerke gehören ebenso dazu und verfügen zudem über ästhetische Zeichen, wie Charles W.Morris sie in einem Aufsatz über Ästhetik und Zeichentheorie beschreibt.[6] In seiner nicht logisch zu begründenden Phänomenologie der universalen Zeichen unterteilt Peirce in drei Hauptcharakteristika von Semiotik; dem Ikon, Index und dem Symbol.
In allen Bereichen des menschlichen Lebens haben diese Zeichensysteme ihre Präsenz und werden auf unterschiedlichste Weise miteinander in Verbindung gebracht und je nach Beschaffenheit individuell oder auch universell interpretiert. So kann in dem Bereich der Kunst ein Zeichen immer nur Möglichkeiten vermitteln. Es gibt hier keine festen Bedeutungen, sondern lediglich individuelle Interpretationsmöglichkeiten. Im Alltag beziehen sich die Zeichen auf die, uns als Realität erscheinende, Wirklichkeit. Sie haben ein reales Objekt und ein Sprecher kann in der Regel davon ausgehen, dass der Andere das Gemeinte versteht. In der Wissenschaft verweisen die Zeichen auf Notwendigkeiten und folgen fachspezifischen Regeln. Verwendete Begriffe müssen definiert, Aussagen belegbar und Schlussfolgerungen bewiesen werden. So der klassisch manifestierte Topos unseres Wissenschaftsbegriffes. Im Falle eines Kunstwerkes sieht es, wie sich denken lässt, differenzierter und fragiler aus. Charles Morris fügt an, dass in der menschlichen Konzeption das Kunstwerk als ein Zeichen zu verstehen ist, welches, von einzelnen Grenzfällen abzusehen, seinerseits aus Zeichen besteht und zusammengefügt wird.[7]
Das spezifische des ästhetischen Zeichens in einem Kunstwerk zu bestimmen liegt in der Art der Gegenstände, die als ästhetische Zeichen fungieren. Aus der Sichtweise dieser Theorie heraus, ist das Kunstwerk strenggenommen ein ästhetisches Zeichen, das ausschließlich in einem Interpretationsprozess existieren kann. In einer ästhetischen Analyse, könnte man sagen, wird die Ästhetik ihrerseits zu einer Wissenschaft von der ästhetischen Wahrnehmung,[8] da auch die Wahrnehmung selbst, mit Hintergrund dieses Kontextes, als Zeichenprozess verstanden sein will.
[...]
[1] Vgl.Luhmann, Niklas, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1995,S.93.
[2] Ebd. S.95, 96.
[3] Vgl.Goffman, Erving; Rahmen-Analyse; Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen, London, 1974, Frankfurt am Main 1977, S.16-25.
[4] Erving Goffman, Rahmen-Analyse; Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen, Frankfurt M., 1977, S.176.
[5] Vgl.Peirce, Charles Sanders; Phänomen und Logik der Zeichen, Frankfurt am Main, 1983, S.64-68.
[6] Vgl.Morris, W.Charles, Theorien der Kunst; Kapitel; Ästhetik und Zeichentheorie, Frankfurt am Main, 1982, S.357.
[7] Vgl.Ebd, S.356.
[8] Vgl.Ebd, S.357.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Täuschung in der Kunstbetrachtung?
In der visuellen Betrachtung führt Täuschung oft zu einer Verschiebung der Realität, die Kuratoren gezielt zur optischen Verführung und konzeptionellen Gestaltung nutzen.
Was ist der Unterschied zwischen „Betrachtung“ und „Beobachtung“?
Betrachtung ist eine direkte, aktive Auseinandersetzung mit einem Objekt, während Beobachtung oft als aktiver, aber unbewusster Wahrnehmungsvorgang verstanden wird.
Wie wendet Niklas Luhmann seine Theorie auf Kunst an?
Luhmann nutzt das Konzept der „Beobachtung zweiter Ordnung“, um zu analysieren, wie wir Kunstwerke als hergestellte Objekte im Vergleich zur natürlichen Welt wahrnehmen.
Was bedeutet Erving Goffmans „Rahmen-Analyse“ für die Kunst?
Rahmen dienen dazu, Situationen einzuschätzen; im Falle der Kunst hilft der Kontext (z.B. ein Museum), ein Objekt überhaupt erst als Kunstwerk zu erkennen.
Wie wird das „Heldenbild“ in Ausstellungen konstruiert?
Ein Heldentopos entsteht durch eine zugeführte „Bildhaftigkeit“ und moralische Prämissen, die kulturell oder universal codiert sind.
- Citation du texte
- Sarah - Felicitas Koch (Auteur), 2013, Never trust a Curator, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267406