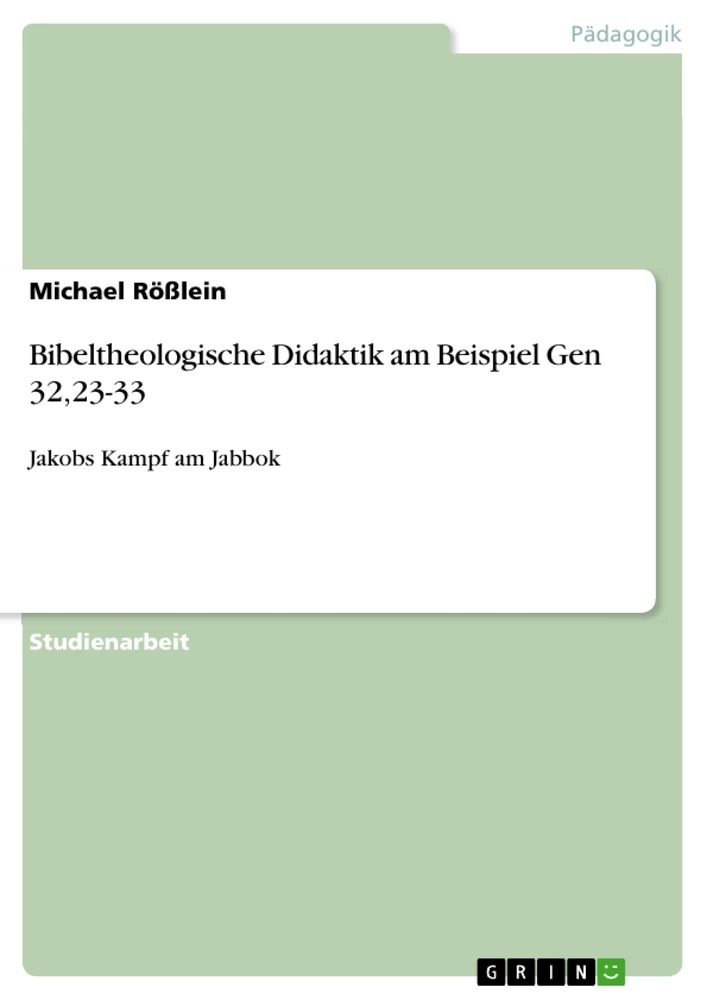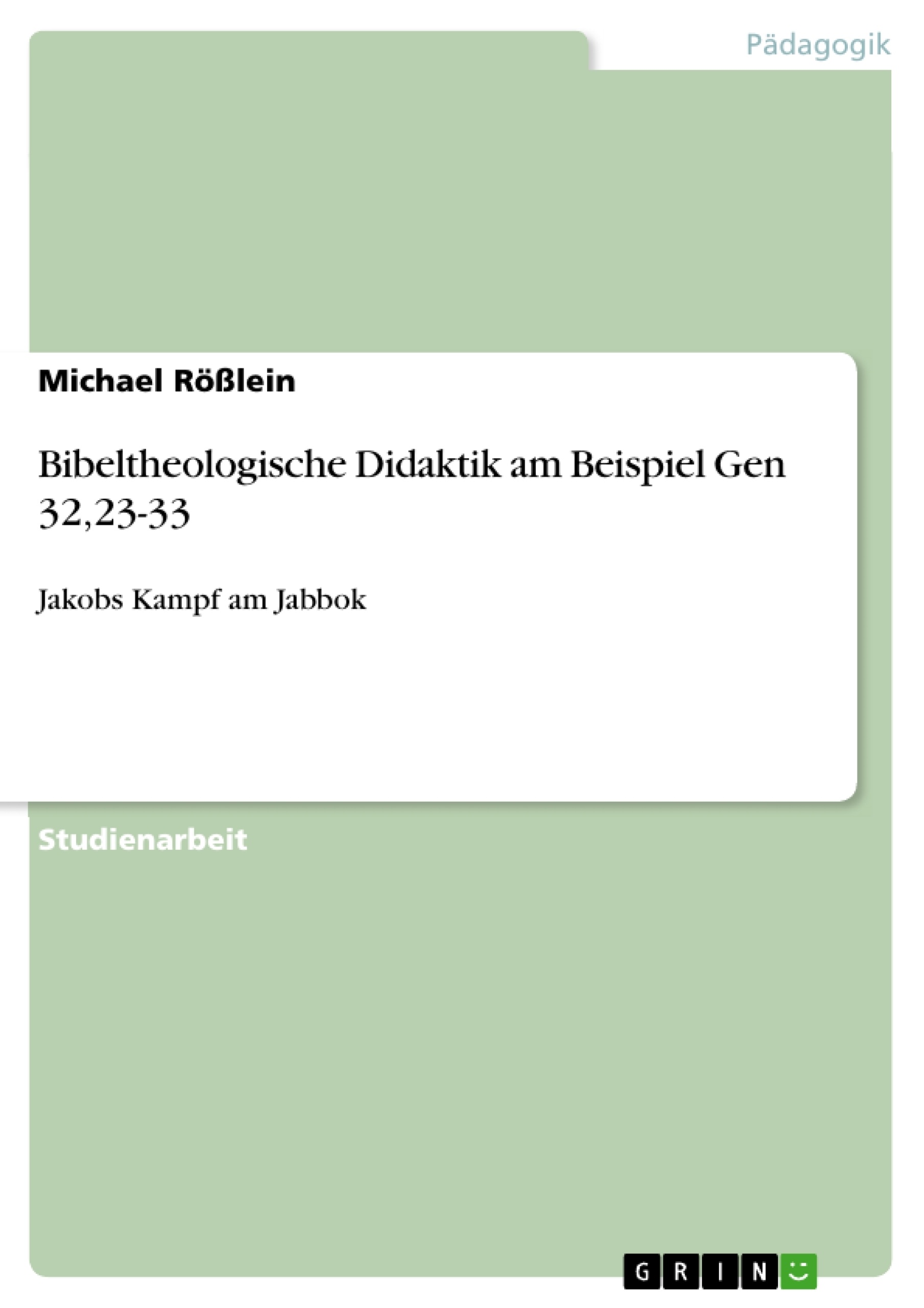In der folgenden Arbeit soll der Ansatz der bibeltheologischen Didaktik dargestellt und an einem konkreten Beispiel näher erläutert werden. Dazu wird zuerst die Textwelt und anschließend die Leserwelt in den Blick genommen und wie sich diesen beiden Welten angenähert werden kann. Anschließend soll auf die Begegnung zwischen Leser und Text eingegangen werden und die Bewegungen, die diese auslöst. Auf die Rolle der Lehrkraft, die einen wesentlichen Teil zu einer erfolgreichen Auseinandersetzung zwischen den Schüler/innen, als Leser, und dem Text beiträgt, wird ebenfalls einzugehen sein. Anschließend wird der Kampf Jakobs am Jabbok (Gen 32,23-33), als konkretes Beispiel, für die bibeltheologische Didaktik entfaltet. Hierzu wird in einem ersten Schritt auf die „Strategien des Textes“ eingegangen und in einem weiteren Schritt die Enzyklopädie des Textes näher dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Darstellung des Ansatzes der „Bibeltheologischen Didaktik"
- Der Text und seine Welt
- Der Text und seine Welt
- Annäherungen an die Textwelt
- Der Leser und seine Welt
- Annäherungen an die Leserwelt
- Bewegungen zwischen Textwelt und Leserwelt
- Zur Bedeutung der Lehrkraft
- Zusammenfassung
- Konkretisierung des Ansatzes der „Bibeltheologischen Didaktik" anhand Gen 32,23-33: Jakobs Kampf am Jabbok
- Hinführung zu Gen 32,23-33
- Physischer Text Gen 32,23-33
- Überblick über die Bibelstelle
- Sinnabschnitte
- Brüche
- Doppelungen
- Widersprüche / Ungereimtheiten
- Leerstellen
- Enzyklopädie des Textes
- Gen 32,23-33 im Kontext der Jakobserzählung
- Der Name Jakob negativ konnotiert - Name Israel als neuer Lebensabschnitt
- Charakterisierung des Mannes und Bedeutung für Jakobs weiteren Lebensweg
- Die Bedeutung des Segens im AT
- Name des Flusses Jabbok und seine Rolle für die Erzählung
- Ursprung des Ortsnamens Penuel
- Wieso die Juden bis heute keinen Hüftmuskel mehr essen
- Vorbiblische Fassung des Kampfes am Jabbok
- Resümee
- Der Text und seine Welt
- Zur Tragweite und den Grenzen der Arbeit mit der „Bibeltheologischen Didaktik" im Religionsunterricht des Gymnasiums
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Ansatz der „Bibeltheologischen Didaktik", einem Konzept zur Interpretation biblischer Texte im Religionsunterricht. Ziel ist es, die Methode anhand eines konkreten Beispiels, Gen 32,23-33, zu erläutern und ihre Tragweite und Grenzen im Religionsunterricht des Gymnasiums zu diskutieren.
- Die Bedeutung der Textwelt und Leserwelt für die Interpretation biblischer Texte
- Die Interaktion zwischen Leser und Text und die daraus resultierenden Bewegungen
- Die Rolle der Lehrkraft in der Gestaltung des Lernprozesses
- Die Bedeutung der Enzyklopädie des Textes für das Verständnis der Bibelstelle
- Die Anwendung der „Bibeltheologischen Didaktik" in der konkreten Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entwicklung der Bibeldidaktik in den letzten Jahrzehnten dar und führt in das Konzept der „Bibeltheologischen Didaktik" von Mirjam Schambeck ein. Im Hauptteil wird der Ansatz der „Bibeltheologischen Didaktik" detailliert beschrieben. Hierbei werden die Textwelt und die Leserwelt als zwei wichtige Elemente der Interpretation hervorgehoben. Die Interaktion zwischen Leser und Text sowie die Rolle der Lehrkraft werden ebenfalls beleuchtet. Anschließend wird der Ansatz anhand des Beispiels Gen 32,23-33 konkretisiert, indem die „Strategien des Textes" und die Enzyklopädie des Textes untersucht werden. Zum Abschluss werden die Tragweite und die Grenzen der „Bibeltheologischen Didaktik" im Religionsunterricht des Gymnasiums diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bibeltheologische Didaktik, die Textwelt, die Leserwelt, die Interpretation biblischer Texte, die Begegnung von Leser und Text, die Enzyklopädie des Textes, die „Strategien des Textes", Gen 32,23-33, Jakob, der Kampf am Jabbok, der Religionsunterricht, die Unterrichtspraxis, die Rolle der Lehrkraft, die Verstehensvoraussetzungen des Lesers, die Tragweite und die Grenzen der „Bibeltheologischen Didaktik".
Häufig gestellte Fragen
Was ist bibeltheologische Didaktik?
Es ist ein Konzept zur Interpretation biblischer Texte im Religionsunterricht, das die Welten des Textes und des Lesers miteinander in Dialog bringt.
Welche Bibelstelle dient als Beispiel in dieser Arbeit?
Die Arbeit konkretisiert den Ansatz am Beispiel von Jakobs Kampf am Jabbok (Genesis 32,23-33).
Welche Rolle spielt die Lehrkraft in diesem didaktischen Modell?
Die Lehrkraft fungiert als Begleiter, der die Auseinandersetzung zwischen den Schülern (als Lesern) und dem biblischen Text ermöglicht und strukturiert.
Was versteht man unter der „Enzyklopädie des Textes“?
Damit ist das Hintergrundwissen und der historische Kontext gemeint, den ein Text voraussetzt, um ihn vollständig verstehen zu können.
Welche Bedeutung hat die Namensänderung von Jakob zu Israel?
Der neue Name markiert einen Wendepunkt und einen neuen Lebensabschnitt für Jakob nach seinem Kampf mit dem unbekannten Mann.
- Darstellung des Ansatzes der „Bibeltheologischen Didaktik"
- Citar trabajo
- Michael Rößlein (Autor), 2011, Bibeltheologische Didaktik am Beispiel Gen 32,23-33, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267410