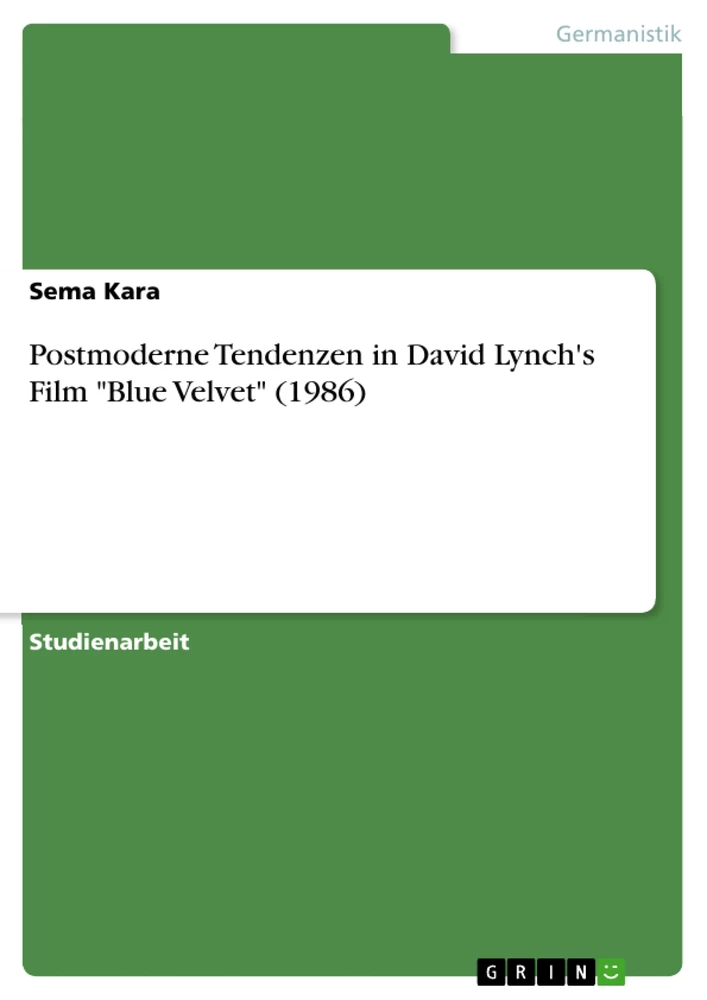In der vorliegenden Arbeit soll nun betrachtet und begründet werden, ob und warum
„Blue Velvet“ tatsächlich einen der typischsten postmodernen Filme darstellt. Hierfür soll
zu Beginn eine allgemeine Definition der Postmoderne folgen, im Anschluss dazu werden
der postmoderne Film und seine typischen Merkmale betrachtet. Jens Eders Kriterien für
den postmodernen Film in seiner Abhandlung „Oberflächenrausch“ werden hierfür als Referenzpunkt
dienen. Diese Kriterien sollen in der anschließenden praktischen Analyse auf
den Film „Blue Velvet“ angewendet werden. Zudem soll eine kurze Betrachtung des Werkstils von David Lynch die Analyse von „Blue Velvet“ abrunden und gängige Stilmerkmale des Regisseurs aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Postmoderne - Versuch einer Begriffsdefinition
3. Der postmoderne Film
4. Merkmale des postmodernen Films
4.1 Intertextualität
4.2. Spektakularität durch Darstellung anti-ästhetischer Exzesse
4.3 Selbstreferentialität
4.4 Anti - Konventionalismus und dekonstruierte Narrativität
5. David Lynch - ein postmoderner Regisseur?
6. Postmoderne Aspekte in Blue Velvet (1986)
6.1 Handlungsübersicht
6.2 Blue Velvet - ein postmoderner Film?
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Sema Kara (Author), 2012, Postmoderne Tendenzen in David Lynch's Film "Blue Velvet" (1986), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267436