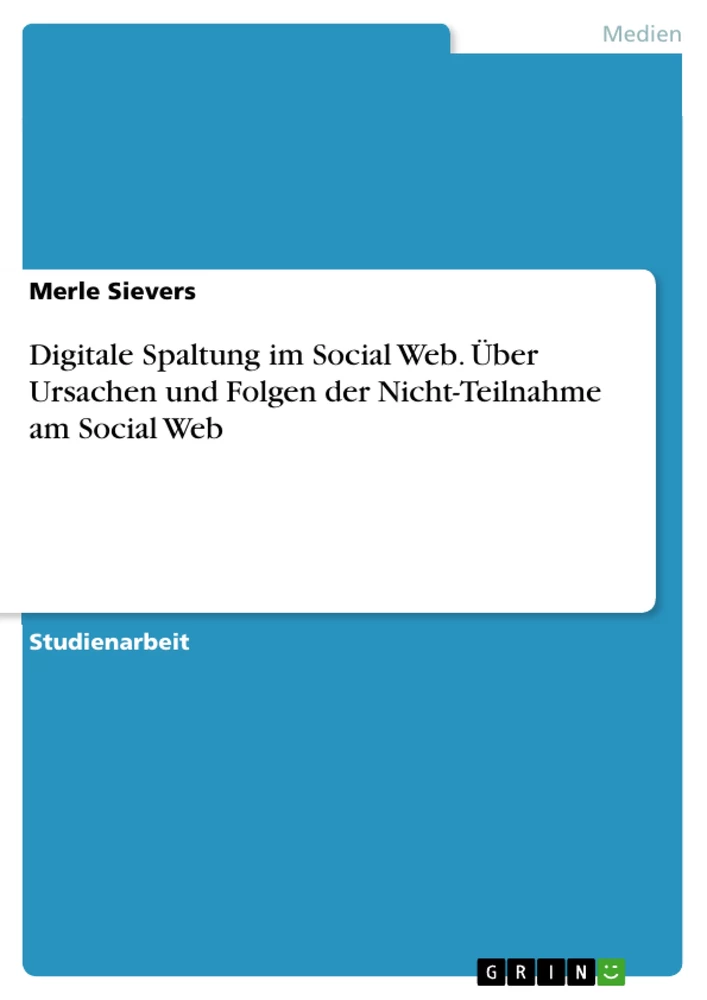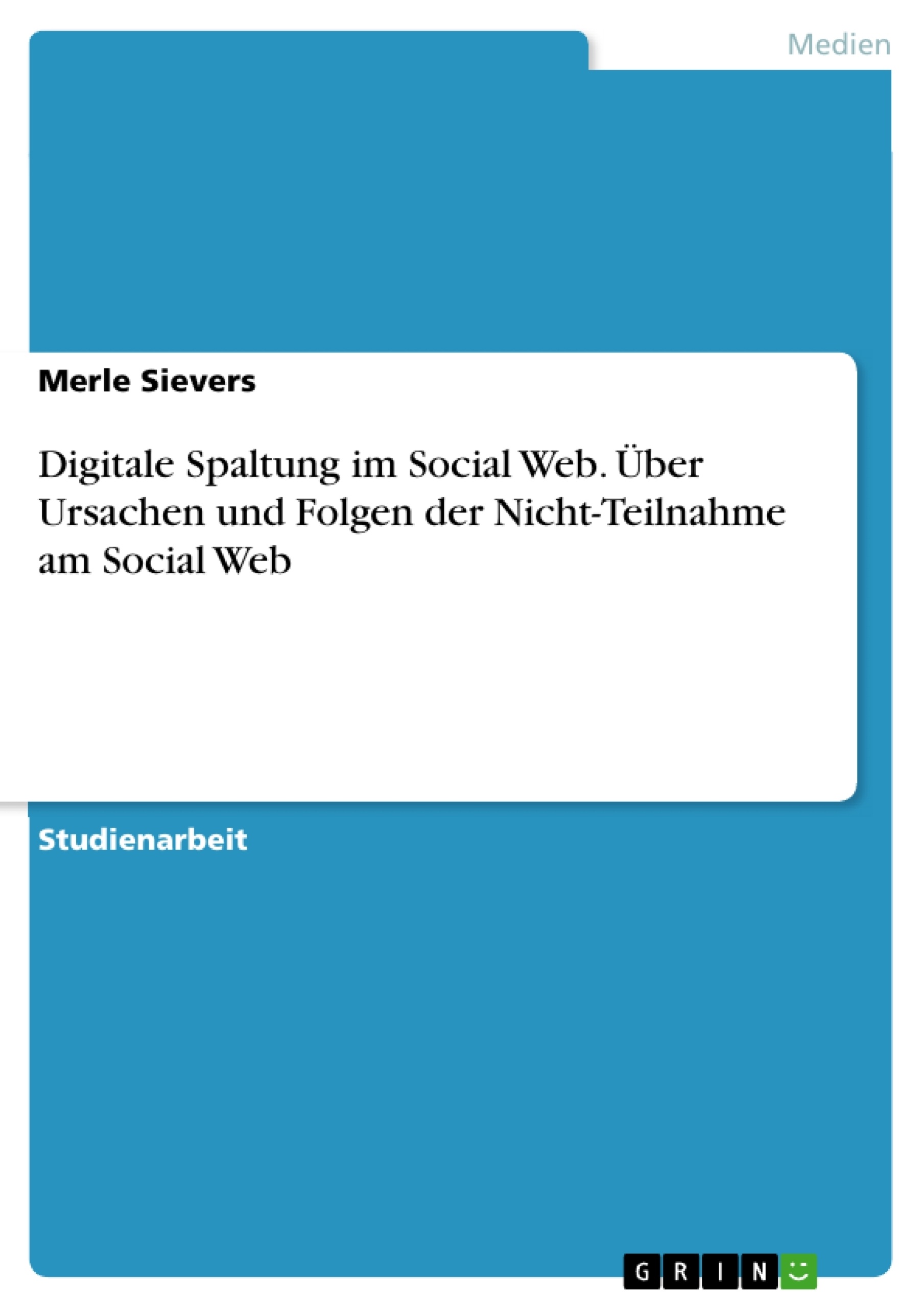Die Nutzung und Wahrnehmung des Web haben sich in den letzten 20 Jahren stark gewandelt. Das Web 2.0 bindet den Nutzer sehr viel stärker in die Gestaltung mit ein. User erstellen, bearbeiten und verteilen Inhalte im entscheidenden Maße selbst, beispielsweise in Form von Wikis, Blogs, Social Bookmarks und in sozialen Netzwerken. Inhalte werden nicht nur zentral von großen Medienunternehmen erstellt und bereitgestellt, sondern auch durch eine Vielzahl von Nutzern. Das Web 2.0 bietet also einen multilateralen Austausch von Informationen und viele
Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Nutzern. Es ist quasi „sozialisiert”.
Die Theorie der digitalen Spaltung besagt, dass der Zugang
beziehungsweise Nicht-Zugang zum Internet für eine Wissenskluft verantwortlich ist, die erhebliche soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten innerhalb der Bevölkerung nach sich zieht. In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Rolle der „sozialisierte” Teil des Web, das Social Web, inzwischen dabei spielt. Wer sind die Menschen, die eine Teilnahme am Social Web verweigern? Welche Gründe haben sie dafür? Um die Ursachen in Relation setzen zu können, werden die Offliner als eine weitere Gruppe der Verweigerer zum Vergleich herangezogen. Außerdem soll untersucht werden, inwieweit die Nichtteilhabe an sozialen Netzwerken das Leben der Menschen beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Digitale Spaltung
2.1. Begriffserklärung
3. Das Social Web
3.1. Die Entwicklung des Social Web
3.2. Das Web als sozialer Treffpunkt
3.3. Die Offliner
3.4. Die Social-Media-Verweigerer
3.5. Dialektischer Ursachenvergleich
3.5.1. Technischer Zugang
3.5.2. Datenklau
3.5.3. Zeitverlust
3.5.4. Mangelndes Interesse
4. Fazit: Der Social-Media-Verweigerer im Vergleich
5. Prognose zur Entwicklung des Social Web
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie der digitalen Spaltung?
Sie besagt, dass ungleicher Zugang zum Internet zu einer Wissenskluft führt, die soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten verstärkt.
Warum verweigern manche Menschen das Social Web?
Hauptgründe sind Sorgen um den Datenschutz („Datenklau“), die Angst vor Zeitverlust, mangelndes Interesse oder fehlender technischer Zugang.
Was unterscheidet „Offliner“ von „Social-Media-Verweigerern“?
Offliner nutzen das Internet gar nicht, während Social-Media-Verweigerer zwar online sein können, aber die Teilnahme an interaktiven Netzwerken wie Facebook ablehnen.
Hat die Nicht-Teilnahme am Social Web soziale Folgen?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit Menschen durch die Verweigerung von sozialem Austausch im Netz von Informationen oder gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden.
Wie hat sich die Internetnutzung gewandelt?
Vom rein passiven Konsum hin zum Web 2.0, bei dem Nutzer Inhalte selbst erstellen, bearbeiten und in Wikis oder Blogs verteilen.
- Quote paper
- Merle Sievers (Author), 2012, Digitale Spaltung im Social Web. Über Ursachen und Folgen der Nicht-Teilnahme am Social Web, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267450