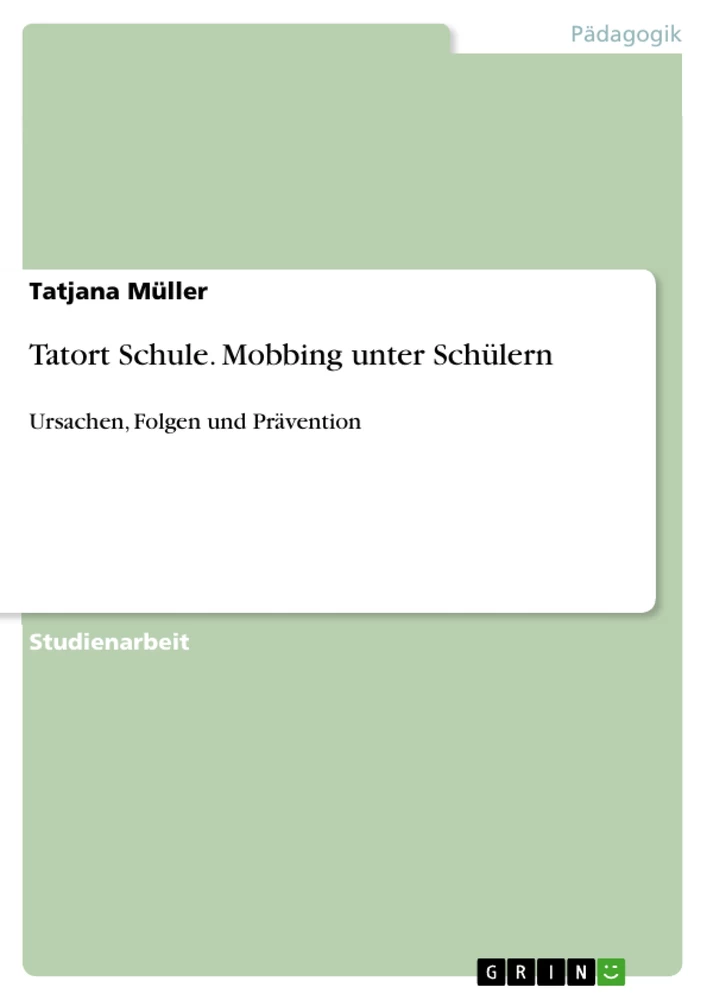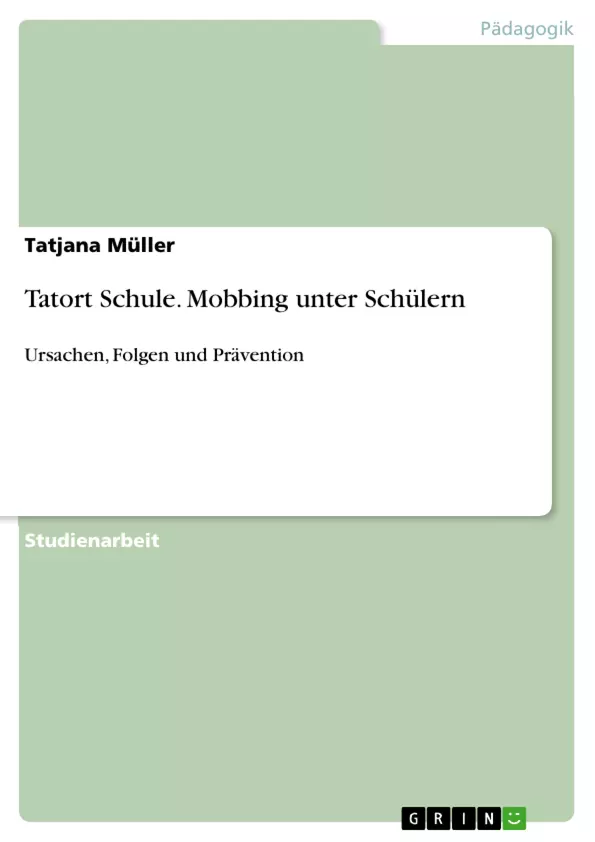Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Mobbing unter Schülern“ als ein schulisches Gewaltphänomen, das ein aktuelles Thema in den Medien darstellt und immer häufiger öffentlich diskutiert wird. Mobbing findet in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft statt und ist in den letzten Jahren zu einem „Modebegriff“ geworden (vgl. Kasper 1998, S.21). Mobbing unter Kindern und Jugendlichen lässt sich im Kontext Schule besser beobachten und bearbeiten, da sie sich durch eine feste Struktur auszeichnet, in der jedes Kind sowie jeder Jugendliche eine bestimmte Position einnimmt (vgl. Schallenberg 2004, S. 11f). So nimmt auch beim Mobbing jeder Einzelne eine bestimmte Rolle ein. Mobbing wird also zunehmend als Gruppenphänomen betrachtet, in der nicht nur Täter und Opfer eine Rolle spielen, sondern auch andere Gleichaltrige, die passiv beim Mobbing beteiligt sind. Gewalt gab es schon immer an Schulen, doch verändert haben sich nach Kohn die Wahrnehmung sowie die Intensität von Gewalt, welche sich zunehmend erweitern (vgl. Kohn 2012, S. 12).
Im zweiten Kapitel wird das Phänomen „Mobbing in der Schule“ aufgegriffen. Zu Beginn wird kurz dargestellt, um was es sich bei dem Begriff „Mobbing“ handelt. Weiter wird die Verbreitung in Schulen anhand einer Studie in den Blick genommen und die Ursachen sowie die Folgen von Mobbing näher betrachtet.
Im dritten Kapitel geht es um die Kooperation von Schule und Jugendhilfe in Form von Schulsozialarbeit. Zunächst werden hier mehrere Definitionen gegenübergestellt und erläutert, um was es sich dabei handelt. Danach wird auf den rechtlichen Rahmen der Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) beziehungsweise Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und den Schulgesetzen eingegangen. Anschließend werden die Aufgaben der Schulsozialarbeit vorgestellt.
Im vierten Kapitel geht es schließlich um die Mobbingprävention und in wieweit die Schulsozialarbeit in Bezug auf Mobbing tätig werden kann. Dabei wird zunächst der Begriff der Prävention erklärt und definiert. Schließlich wird nach den allgemeinen Handlungsmöglichkeiten der SchulsozialarbeiterInnen auf die Methode des „No Blame Approach“ näher eingegangen.
In der vorliegenden Arbeit werden folgende Fragen bearbeitet: Wie verbreitet ist Mobbing? Welche Ursachen und Folgen ergeben sich? Warum ist die Kooperation von Schule und Jugendhilfe in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung und was kann die Schulsozialarbeit dagegen tun, um eine nachha
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobbing unter Schülern
- Was ist Mobbing?
- Häufigkeit von Mobbing in der Schule
- Ursachen von Mobbing
- Folgen von Mobbing
- Schulsozialarbeit
- Definitionen von Schulsozialarbeit
- Rechtliche Grundlagen der Schulsozialarbeit
- Aufgaben der Schulsozialarbeit
- Mobbingprävention der Schulsozialarbeit
- Der Begriff Prävention
- Was die Schulsozialarbeit tun kann
- Die Methode des "No Blame Approach"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Mobbing unter Schülern" als ein schulische Gewaltphänomen, das ein aktuelles Thema in den Medien darstellt und immer häufiger öffentlich diskutiert wird. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Folgen von Mobbing in der Schule und untersucht die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Prävention von Mobbing. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für das Mobbingphänomen zu entwickeln und Handlungsmöglichkeiten für die Schulsozialarbeit aufzuzeigen.
- Das Mobbingphänomen in der Schule
- Ursachen und Folgen von Mobbing
- Die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Prävention
- Die Bedeutung von Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- Das „No Blame Approach" als Methode der Mobbingprävention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Mobbing unter Schülern" ein und stellt die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft dar. Im zweiten Kapitel wird das Phänomen „Mobbing in der Schule" näher betrachtet. Es werden verschiedene Definitionen von Mobbing vorgestellt und die Häufigkeit von Mobbing in Schulen anhand einer Studie beleuchtet. Außerdem werden die Ursachen und Folgen von Mobbing ausführlich analysiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Schulsozialarbeit als Kooperationsfeld von Schule und Jugendhilfe. Es werden unterschiedliche Definitionen von Schulsozialarbeit vorgestellt und die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) erläutert. Außerdem werden die Aufgaben der Schulsozialarbeit im Detail dargestellt.
Im vierten Kapitel geht es um die Mobbingprävention der Schulsozialarbeit. Der Begriff der Prävention wird definiert und die Handlungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit bei der Mobbingprävention werden auf drei Handlungsebenen (individuelle Schülerebene, Klassenebene und Schulebene) dargestellt. Außerdem wird die Methode des „No Blame Approach" näher erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Mobbing, Schulsozialarbeit, Prävention, Jugendhilfe, Schule, Kooperation, "No Blame Approach", Ursachen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten, Schüler, Lehrer, Eltern, Sozialklima, Gewalt, Gesundheitsrisiken, psychische Belastungen, Integration, Zusammenarbeit, Schulentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was genau versteht man unter Mobbing in der Schule?
Mobbing wird als Gruppenphänomen betrachtet, bei dem ein Schüler wiederholt und über längere Zeit schikaniert wird. Es beteiligen sich nicht nur Täter und Opfer, sondern oft auch passive Mitschüler.
Welche Folgen hat Mobbing für die Betroffenen?
Die Folgen reichen von psychischen Belastungen und Ängsten bis hin zu ernsthaften Gesundheitsrisiken und einer Verschlechterung der schulischen Leistungen.
Was ist die Aufgabe der Schulsozialarbeit bei Mobbing?
Schulsozialarbeit agiert an der Schnittstelle von Schule und Jugendhilfe. Sie berät Schüler, Lehrer und Eltern und führt Präventionsmaßnahmen auf individueller, Klassen- und Schulebene durch.
Was ist der "No Blame Approach"?
Dies ist eine Interventionsmethode, die ohne Schuldzuweisungen arbeitet. Ziel ist es, gemeinsam mit einer Unterstützungsgruppe Lösungen zu finden, um das Mobbing zu beenden und das Opfer zu schützen.
Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert die Schulsozialarbeit?
Die rechtlichen Grundlagen finden sich primär im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bzw. dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie in den jeweiligen Schulgesetzen der Länder.
Warum ist Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe so wichtig?
Weil Mobbing ein komplexes Problem ist, das sowohl pädagogische als auch sozialarbeiterische Expertise erfordert, um nachhaltig ein positives Sozialklima an der Schule zu schaffen.
- Citar trabajo
- Tatjana Müller (Autor), 2013, Tatort Schule. Mobbing unter Schülern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267582