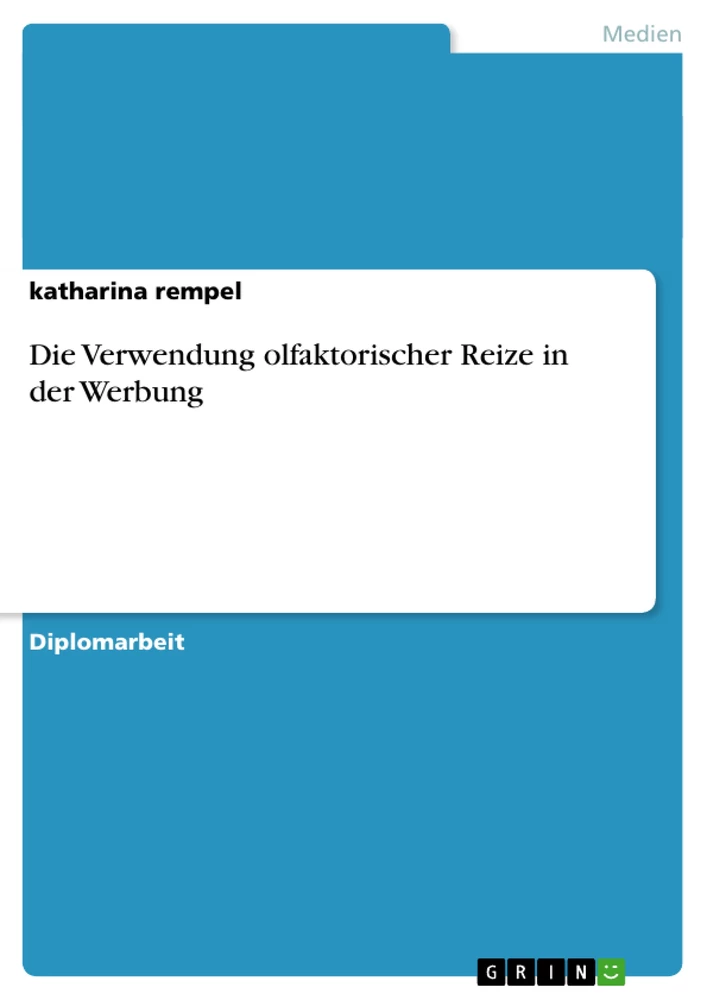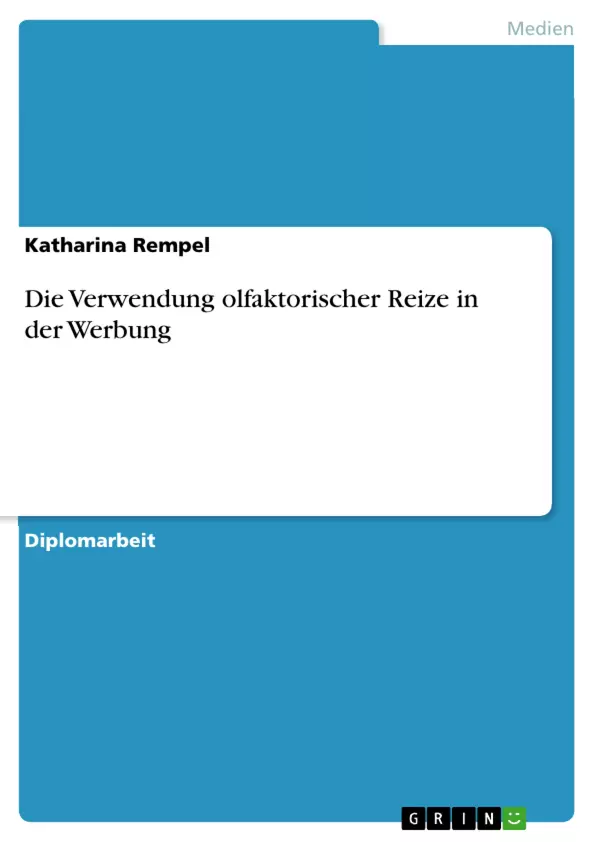In den letzten 50 Jahren haben sich die Märkte von ehemals Angebots- zu Verbrauchermärkten entwickelt. Mittlerweile herrscht ein signifikantes Überangebot von
Waren und Dienstleistungen, d.h. das potenzielle Marktvolumen gilt als ausgeschöpft.
Im Jahr 2009 verzeichnete das Deutsche Patent- und Markenamt 69.069 neue Markeneinträge. Somit sind allein in Deutschland insgesamt 778.008 Marken in das
Markenregister eingetragen. Der Konsument sieht sich aufgrund der Angebotsvielfalt einer stetig wachsenden Kommunikationsflut durch u.a. Werbeanzeigen, E-Mails und
Werbespots ausgesetzt. Damit Unternehmen dennoch erfolgreich am Markt bestehen und sich von der Konkurrenz abgrenzen können, ergibt sich die Notwendigkeit, alle
Unternehmensaktivitäten sowie insbesondere die kommunikationspolitischen Maßnahmen am Absatzmarkt auszurichten. Daraus resultiert die Fragestellung, durch welche Techniken aus dem Bereich des Marketings die eigenen Werbemaßnahmen gegenüber denen der Konkurrenz abgegrenzt und hervorgehoben werden können. Eine mögliche
Antwort könnte im Bereich des Erlebnismarketings gefunden werden. Erlebnismarketing wird als die Schaffung multisensualer Konsumerlebnisse betrachtet. Unter multisensual sind die Sinnesmodalitäten Hören, Riechen, Sehen, Tasten und Schmecken zu verstehen. Schließlich kauft ein Konsument „Marken, die Erlebnisse und Gefühle
vermitteln und weniger Produkte mit funktionalen Eigenschaften“. KOTLER hebt in diesem Zusammenhang hervor: „The combination of visual and audio stimuli delivers a 2 + 2 = 5 impact. It pays even more to trigger other sensory channels – taste, touch, smell to enhance the total impact.“
Im Rahmen einer Studie von BROWN/ LINDSTROM wurden Konsumenten nach der Wichtigkeit der fünf Sinne für die Bewertung von Kaufentscheidungen befragt. Die visuelle Sinneseigenschaft konnte mit einem Wert von 58 Prozent Platz eins erzielen und mit einer nicht übermäßig starken Diskrepanz folgte die Sinneseigenschaft des Riechens, die sog. Olfaktorik mit 45 Prozent auf Platz zwei der Wichtigkeitsskala. [...]
CD-ROM-Anhänge sind nicht in Datei enthalten
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Grundlagen der Werbung und Integration olfaktorischer Reize
- 2.1 Werbung als Instrument der Kommunikationspolitik
- 2.1.1 Definition und Intentionen
- 2.1.2 Formen der Werbung
- 2.1.3 Erlebnisorientierte Gestaltung der Werbung
- 2.1.4 Kommerzielle und rechtliche Grenzen der Werbung
- 2.1.5 Ökonomische und psychologische Werbeziele
- 2.2 Olfaktorische Reize
- 2.2.1 Definition und Bedeutung
- 2.2.2 Physiologischer Prozess der Duftwahrnehmung
- 2.2.3 Einflussfaktoren auf die Duftwahrnehmung
- 2.3 Integration olfaktorischer Reize in die Werbung
- 2.3.1 Inhaltlich-konzeptionelle Ebene
- 2.3.2 Formal-gestalterische Ebene
- 2.3.3 Zusammenhang und Bewertung
- 3 Erkenntnisse zur Wirkung olfaktorischer Reize in der Werbung
- 3.1 Das umweltpsychologische Duftwirkungsmodell
- 3.1.1 Das S-O-R Modell
- 3.1.2 Das umweltpsychologische Verhaltensmodell
- 3.2 Stand der Forschung über die aktivierende Wirkung von Duftstoffen
- 3.3 Auf olfaktorischen Reizen basierende psychologische Reaktionstypologien
- 3.3.1 Aroma Chology
- 3.3.2 Affektive Wirkungsreaktionen olfaktorischer Reize
- 3.3.3 Durch olfaktorische Reize induzierte kognitive Reaktionen
- 3.3.4 Durch olfaktorische Reize induzierte Verhaltensreaktionen
- 3.4 Zusammenfassung und Bewertung
- 4 Implikationen für die Verwendung olfaktorischer Reize in unterschiedlichen Werbemedien
- 4.1 Verwendung olfaktorischer Reizen in der Werbung
- 4.1.1 Inhaltlich-konzeptionelle Implikationen bei der theoretischen Anwendung in verschiedenen Werbeformen
- 4.1.1.1 Spezifische Eigenschaften der Printmedien
- 4.1.1.2 Spezifische Eigenschaften des Verkaufsraumes
- 4.1.1.3 Spezifische Eigenschaften der multimedialen Kommunikation
- 4.1.2 Formal-gestalterische Implikationen bei der praktischen Integration olfaktorischer Reize in verschiedenen Werbeformen
- 4.1.2.1 Gestaltungsempfehlungen für die Printmedien
- 4.1.2.2 Gestaltungsempfehlungen für die Verkaufsraumbeduftung
- 4.1.2.3 Gestaltungsempfehlungen für die multimediale Kommunikation
- 4.1.3 Zusammenfassung
- 4.2 Manipulation des Konsumenten durch den Einsatz von Duftstoffen
- 4.3 Berücksichtigung rechtlicher Besonderheiten beim Einsatz von Duftstoffen
- 4.4 Negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumenten
- 4.5 Kritische Würdigung
- 4.6 Handlungsempfehlungen und zukünftiger Einsatz olfaktorischer Reize in der Werbung
- 5 Zusammenfassende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Verwendung olfaktorischer Reize in der Werbung. Ziel ist es, die Grundlagen der Duftwahrnehmung und deren Integration in verschiedene Werbeformen zu analysieren und die Wirkung auf das Konsumentenverhalten zu bewerten. Die Arbeit berücksichtigt sowohl theoretische als auch praktische Aspekte.
- Wirkung olfaktorischer Reize auf Konsumenten
- Integration von Düften in verschiedene Werbemedien (Print, Verkaufsraum, Multimedia)
- Psychologische und physiologische Prozesse der Duftwahrnehmung
- Kommerzielle und rechtliche Aspekte der Duftwerbung
- Kritische Bewertung der Anwendung olfaktorischer Reize in der Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, beschreibt die Problemstellung und definiert die Zielsetzung sowie die Vorgehensweise der Untersuchung. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
2 Grundlagen der Werbung und Integration olfaktorischer Reize: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen. Es definiert Werbung, erläutert verschiedene Formen und deren Gestaltung, beschreibt die ökonomischen und psychologischen Werbeziele und geht detailliert auf die Definition, den physiologischen Prozess und die Einflussfaktoren der olfaktorischen Wahrnehmung ein. Schließlich analysiert es, wie olfaktorische Reize inhaltlich-konzeptionell und formal-gestalterisch in die Werbung integriert werden können.
3 Erkenntnisse zur Wirkung olfaktorischer Reize in der Werbung: Dieses Kapitel präsentiert bestehende Forschungsergebnisse zur Wirkung von Düften. Es beschreibt relevante Modelle der Duftwirkung, wie das S-O-R-Modell und das umweltpsychologische Duftwirkungsmodell, und beleuchtet den Forschungsstand zur aktivierenden Wirkung von Duftstoffen. Es untersucht verschiedene psychologische Reaktionstypen (affektiv, kognitiv, verhaltensbezogen), die durch olfaktorische Reize induziert werden können, und bietet eine zusammenfassende Bewertung der bisherigen Erkenntnisse.
4 Implikationen für die Verwendung olfaktorischer Reize in unterschiedlichen Werbemedien: In diesem Kapitel werden die Implikationen der vorherigen Kapitel für die praktische Anwendung von Duftstoffen in verschiedenen Werbemedien untersucht. Es werden spezifische Eigenschaften von Printmedien, Verkaufsräumen und multimedialer Kommunikation berücksichtigt und entsprechende Gestaltungsempfehlungen formuliert. Das Kapitel befasst sich auch mit der potenziellen Manipulation von Konsumenten durch Duftstoffe, relevanten rechtlichen Aspekten, negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und bietet abschließende Handlungsempfehlungen.
Schlüsselwörter
Olfaktorische Reize, Werbung, Duftmarketing, Duftwahrnehmung, Konsumentenverhalten, Werbewirkung, Printmedien, Verkaufsraum, Multimediale Kommunikation, Sensorisches Marketing, Psychologie, Physiologie, Rechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Verwendung olfaktorischer Reize in der Werbung
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Verwendung olfaktorischer Reize (Düfte) in der Werbung. Sie analysiert die Grundlagen der Duftwahrnehmung, deren Integration in verschiedene Werbeformen und die Wirkung auf das Konsumentenverhalten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Grundlagen der Duftwahrnehmung und deren Integration in verschiedene Werbeformen zu analysieren und die Wirkung auf das Konsumentenverhalten zu bewerten. Dabei werden sowohl theoretische als auch praktische Aspekte berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Wirkung olfaktorischer Reize auf Konsumenten, Integration von Düften in verschiedene Werbemedien (Print, Verkaufsraum, Multimedia), psychologische und physiologische Prozesse der Duftwahrnehmung, kommerzielle und rechtliche Aspekte der Duftwerbung und eine kritische Bewertung der Anwendung olfaktorischer Reize in der Werbung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Werbung und Integration olfaktorischer Reize, Erkenntnisse zur Wirkung olfaktorischer Reize in der Werbung, Implikationen für die Verwendung olfaktorischer Reize in unterschiedlichen Werbemedien und eine zusammenfassende Betrachtung.
Was wird im Kapitel "Grundlagen der Werbung und Integration olfaktorischer Reize" behandelt?
Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen. Es definiert Werbung, erläutert verschiedene Formen und deren Gestaltung, beschreibt die ökonomischen und psychologischen Werbeziele und geht detailliert auf die Definition, den physiologischen Prozess und die Einflussfaktoren der olfaktorischen Wahrnehmung ein. Schließlich analysiert es die inhaltlich-konzeptionelle und formal-gestalterische Integration olfaktorischer Reize in die Werbung.
Was wird im Kapitel "Erkenntnisse zur Wirkung olfaktorischer Reize in der Werbung" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert bestehende Forschungsergebnisse zur Wirkung von Düften. Es beschreibt relevante Modelle der Duftwirkung (S-O-R-Modell, umweltpsychologisches Duftwirkungsmodell) und beleuchtet den Forschungsstand zur aktivierenden Wirkung von Duftstoffen. Es untersucht verschiedene psychologische Reaktionstypen (affektiv, kognitiv, verhaltensbezogen), die durch olfaktorische Reize induziert werden können, und bietet eine zusammenfassende Bewertung der bisherigen Erkenntnisse.
Was wird im Kapitel "Implikationen für die Verwendung olfaktorischer Reize in unterschiedlichen Werbemedien" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Implikationen für die praktische Anwendung von Duftstoffen in verschiedenen Werbemedien (Print, Verkaufsraum, Multimedia). Es berücksichtigt spezifische Eigenschaften der Medien und formuliert Gestaltungsempfehlungen. Es befasst sich auch mit der potenziellen Manipulation von Konsumenten, rechtlichen Aspekten, negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und bietet Handlungsempfehlungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Olfaktorische Reize, Werbung, Duftmarketing, Duftwahrnehmung, Konsumentenverhalten, Werbewirkung, Printmedien, Verkaufsraum, Multimediale Kommunikation, Sensorisches Marketing, Psychologie, Physiologie, Rechtliche Aspekte.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Problemstellung und Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
- Citation du texte
- Katharina Rempel (Auteur), 2010, Die Verwendung olfaktorischer Reize in der Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267637