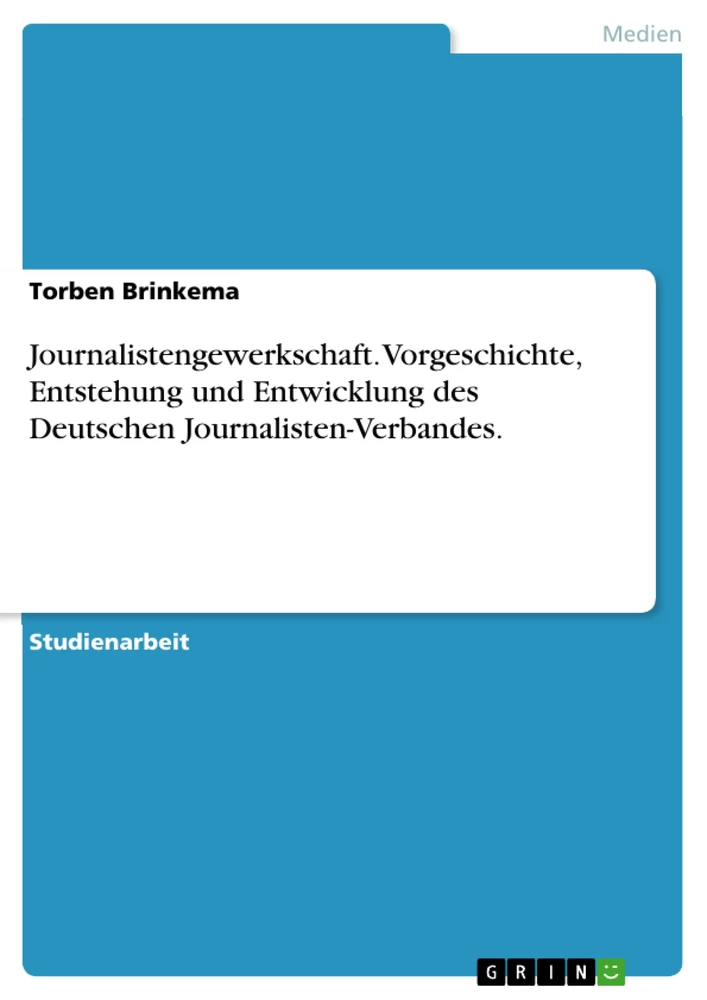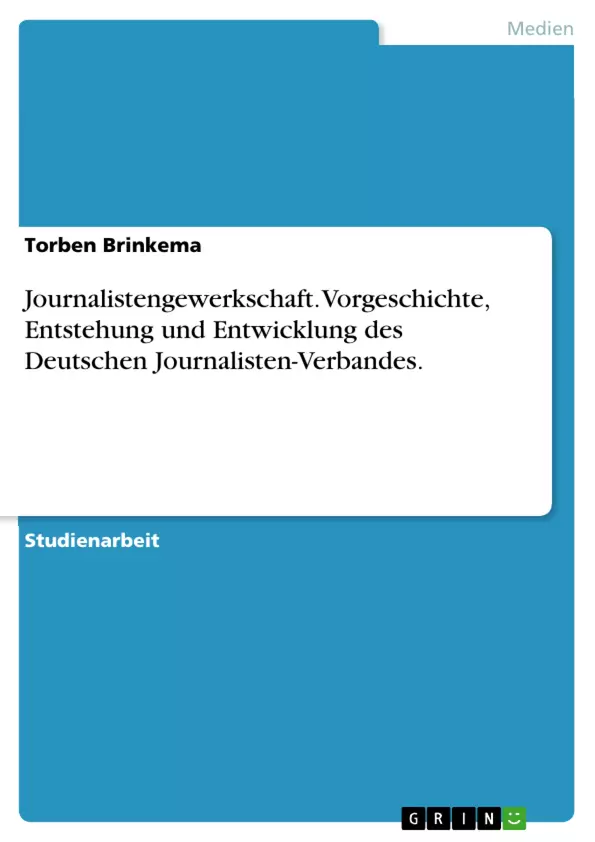Bereits im 19. Jahrhundert hat die Berufssoziologie die Berufsorganisationen als ein Kriterium für den Grad der Professionalisierung eines Metiers bezeichnet. Das schreibende Gewerbe fand mit der Gründung des Leipziger Literaten-Vereins im Jahr 1842 erstmals eine Anlaufstelle, in der sich Journalisten organisieren konnten. Bei weitem kein Vergleich mit dem jetzt existierenden Deutschen Journalisten-Verband, der sich erst über 100 Jahre später gründen sollte. (...)
Immer wieder neu aufkommende Hoffnungen auf die feste Organisation von Journalisten, die die Pressefreiheit gegenüber dem Staat durchsetzen können, wurden im Keim erstickt. Nicht durch Zensur in den einzelnen Bundesländern, aber Mittel wie Kautionsleistung, Beschlagnahme, Konzessionszwang und Entzug des Postvertriebes wurden voll ausgeschöpft. (...)
Unter Vorsitz von Karl Biedermann, leitender Redakteur der Leipziger „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ (...), fand schließlich am 22. Mai 1864 in Eisenach der 1. Deutsche Journalistentag statt. (...) Die Hauptthemen dieses ersten Journalistentages waren die Abschaffung steuerlicher Belastungen für die Presse (...), eine Bundespressegesetzgebung sowie der Postvertrieb. (...) Zudem wurde ein Komitee zur Entgegennahme von Stellengesuchen gebildet sowie Probleme der Altersversicherung und der Altersversorgung besprochen.
Arbeitsgebiete, die bis heute Bestand haben. Deshalb stelle ich in diesem Zusammenhang die These, dass die genannten Problemfelder nur in Form einer Journalistengewerkschaft wie dem Deutschen Journalisten-Verband bearbeitet werden können. Dabei stellt sich im Folgenden dieser Hausarbeit die Frage, ob es Sinn macht beziehungsweise hilfreich ist für ganz Deutschland eine einheitliche Mediengewerkschaft ins Leben zu rufen.
Der erste Teil dieser Hausarbeit beschäftigt sich im Wesentlichen mit den theoretischen Grundlagen, der Näherungsfunktion an das Thema Journalistengewerkschaft, fokussiert auf den Deutschen Journalisten-Verband. Ferner wird die Problemstellung behandelt, ob es notwendig ist oder Sinn macht für ganz Deutschland eine einheitliche Mediengewerkschaft ins Leben zu rufen. Gegenstand sind Aufzeichnungen, die es in bisher vergleichsweise wenigen Büchern und Dokumentationen von Journalisten und Kommunikationswissenschaftlern beschrieben werden. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den zukunfts¬orientierten Aufgaben des Deutschen Journalisten-Verbandes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Näherung an das Thema Journalistengewerkschaft
- Arbeit des Reichsverbandes
- Erste Schritte des neuen Deutschen Journalisten-Verbandes
- Das Verhältnis zum Deutschen Gewerkschaftsbund
- Die Bildung einer Mediengewerkschaft
- Das Vorzeitige Ende der Mediengewerkschaft
- Das Verbandsmodell
- Schlussbemerkung
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Vorgeschichte, Entstehung und Entwicklung des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV). Sie untersucht die Herausforderungen und Chancen der Organisation von Journalisten in Deutschland, insbesondere im Kontext der Pressefreiheit und der Sicherung der Berufsinteressen.
- Die Rolle von Berufsorganisationen für die Professionalisierung des Journalismus
- Die Geschichte der Journalistengewerkschaften in Deutschland, insbesondere des Reichsverbandes der Deutschen Presse und des DJV
- Das Verhältnis des DJV zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und die Diskussion um eine Mediengewerkschaft
- Das Verbandsmodell des DJV und seine Aufgabenfelder, wie Rechtsschutz, Tarifpolitik, Beratung und Weiterbildung
- Die Herausforderungen des Journalismus, wie Pressekonzentration und Zeitungssterben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These auf, dass die Herausforderungen und Chancen des Journalismus nur durch eine Journalistengewerkschaft wie den DJV bewältigt werden können. Sie führt in das Thema ein und gibt einen Überblick über die Struktur der Hausarbeit.
Das Kapitel „Näherung an das Thema Journalistengewerkschaft" beleuchtet die frühen Versuche der Organisation von Journalisten in Deutschland. Es beschreibt die Gründung des Leipziger Literaten-Vereins, des Deutschen Journalisten- und Schriftstellervereins und schließlich des Reichsverbandes der Deutschen Presse. Es wird die Bedeutung der Pressefreiheit und die Herausforderungen der frühen Journalistengewerkschaften im Kampf gegen Zensur und staatliche Eingriffe in die Pressefreiheit dargestellt.
Das Kapitel „Arbeit des Reichsverbandes" analysiert die Aktivitäten des Reichsverbandes der Deutschen Presse in der Weimarer Republik. Es beschreibt die Bedeutung des ersten allgemeinverbindlichen Presse-Tarifvertrages und die Herausforderungen der Organisation in der Zeit des Nationalsozialismus. Es zeigt, wie der Reichsverband zu einem Erfüllungsgehilfen der Reichspressekammer wurde und die Pressefreiheit unterdrückt wurde.
Das Kapitel „Das Verhältnis zum Deutschen Gewerkschaftsbund" beleuchtet die Diskussion um eine Mediengewerkschaft. Es beschreibt die Bemühungen des DJV um einen Beitritt in die IG Druck und Papier und die Schwierigkeiten bei der Bildung einer gemeinsamen Mediengewerkschaft mit anderen Gewerkschaften. Es wird die Bedeutung der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit von Journalisten in Bezug auf politische Einflussnahme diskutiert.
Das Kapitel „Das Verbandsmodell" beschreibt die Aufgabenfelder und Strukturen des DJV. Es erläutert die föderale Struktur des Verbandes, seine Rolle in der Tarifpolitik, im Rechtsschutz und in der Medienpolitik. Es wird die Bedeutung der Meinungsfreiheit und die Herausforderungen der digitalen Transformation für den Journalismus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Deutschen Journalisten-Verband, die Journalistengewerkschaft, die Pressefreiheit, die Medienpolitik, den Deutschen Gewerkschaftsbund, die Mediengewerkschaft, die Tarifpolitik, die Herausforderungen des Journalismus, die Pressekonzentration, das Zeitungssterben und die digitale Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptaufgaben des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV)?
Der DJV fungiert als Gewerkschaft und Berufsverband. Seine Aufgaben umfassen die Tarifpolitik, Rechtschutz für Mitglieder, medienpolitische Interessenvertretung sowie Beratung und Weiterbildung.
Wann fand der erste Deutsche Journalistentag statt?
Der 1. Deutsche Journalistentag fand am 22. Mai 1864 in Eisenach unter dem Vorsitz von Karl Biedermann statt.
Wie verhält sich der DJV zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB)?
Die Arbeit beleuchtet die Diskussionen um den Beitritt zur IG Druck und Papier und die Bestrebungen zur Bildung einer gemeinsamen Mediengewerkschaft, wobei die Unabhängigkeit der Journalisten stets ein zentraler Streitpunkt war.
Was war der Reichsverband der Deutschen Presse?
Dies war die Vorgängerorganisation in der Weimarer Republik, die den ersten allgemeinverbindlichen Presse-Tarifvertrag aushandelte, jedoch im Nationalsozialismus gleichgeschaltet wurde.
Welche aktuellen Herausforderungen für Journalisten werden thematisiert?
Die Hausarbeit behandelt Themen wie Pressekonzentration, Zeitungssterben und die Auswirkungen der digitalen Transformation auf den Berufsstand.
- Quote paper
- Torben Brinkema (Author), 2004, Journalistengewerkschaft. Vorgeschichte, Entstehung und Entwicklung des Deutschen Journalisten-Verbandes., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267736