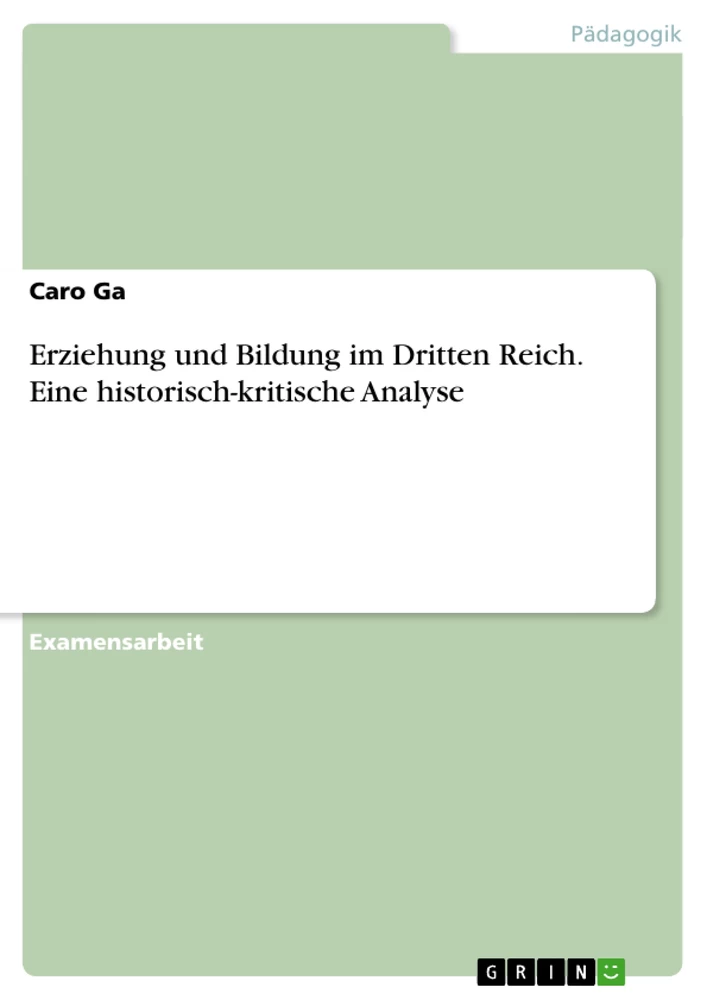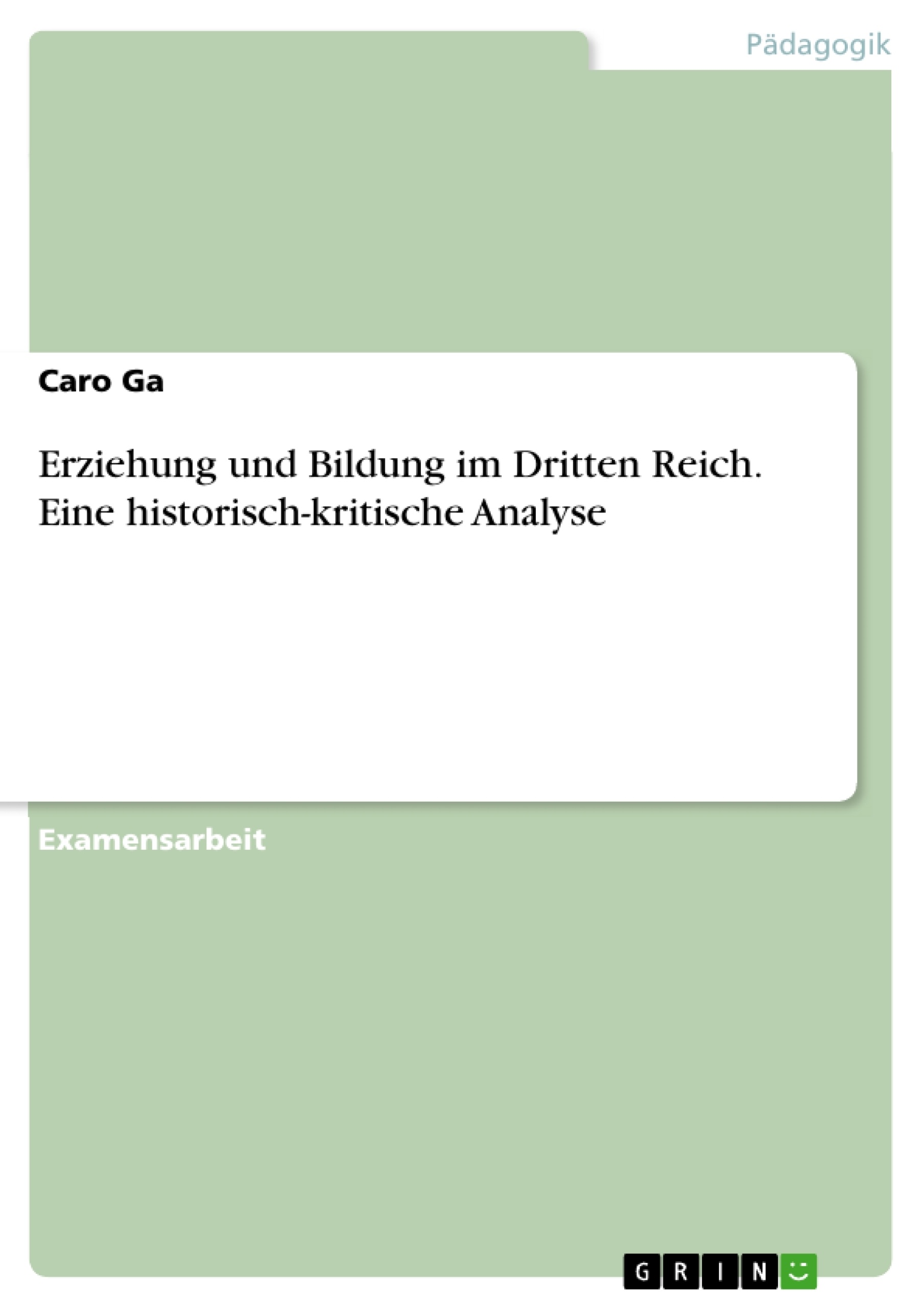Vor dem Hintergrund des bisherigen Forschungsstands entstand die Überlegung, mit dieser Arbeit Aufschlüsse über die Ursachen zu gewinnen, die zu einer heterogenen Gestalt des Schullebens unter der NS-Herrschaft führten. Dabei soll das Blickfeld durch eine Verknüpfung der zeitlichen Einflüsse, die auf institutionelle Erziehungstraditionen wirkten, mit den damaligen politischen Geschehnissen und deren Auswirkungen auf die Haltungen der Beteiligten erweitert werden. Entscheidend ist, inwieweit diese komplexe Ursachenlage das Verhältnis der Erzieher zum Nationalsozialismus beeinflussen konnte.
Giesecke zeigt mit seiner Arbeit (1999), dass es im Nationalsozialismus keine „partei- und staatsoffizielle pädagogische Doktrin“ gegeben hat. Vor diesem Hintergrund erscheint eine genauere Analyse Hitlers, in „Mein Kampf“ formulierten, erziehungspolitischen Maximen als sinnvoll. In der Dissertation von Döpp (2002) wird die „Uneindeutigkeit der NS-Ideologie auch und gerade in Bezug auf pädagogische Fragestellungen“ hervorgehoben. Hitlers Erziehungsideale stehen konträr zu den eigentlichen traditionellen pädagogischen Vorstellungen, die von einer freien, individuellen Entwicklung des Kindes ausgehen.
Die erkenntnisleitende Problemstellung, an der sich diese Arbeit orientieren wird, lautet daher:
Weshalb konnte die Pädagogik anfällig gegenüber einer Sichtweise werden, die im Widerspruch zu den pädagogischen Erziehungsdogmen stand?
Eine aus der politischen Ideologie abgeleitete nationalsozialistische Didaktik wurde von Scholtz widerlegt und gilt nicht mehr als Begründung oder gar Entlastung des Verhaltens der Lehrerschaft im „Dritten Reich“.
Bei dieser Untersuchung wird die Schule im Mittelpunkt stehen, da sie im Gegensatz zu neu aufgebauten nationalsozialistischen Erziehungsinstitutionen, wie der Hitlerjugend, als eine traditionell fest verankerte Erziehungsinstitution gilt. Die „pädagogischen“ Erziehungslinien können somit am Beispiel der Schule, ausgehend von der Weimarer Republik, nachvollzogen werden.
Die Analyse der nationalsozialistischen Schulpolitik beschränkt sich auf die Jahre von 1933 und 1936, da schon in diesem Zeitraum die Veränderung des Schulwesens auf der „inneren“ und „äußeren“ Ebene ersichtlich wird. Das Ziel der NS-Schulpolitik war die Funktionsminderung der Schule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Ende der Weimarer Republik: Bildungspolitische Probleme und nationalsozialistische Tendenzen
- Die pädagogische Lage vor 1933
- Auswirkungen der Weimarer Krise auf die Schule
- Politische Bewusstseinshaltungen der Pädagogen
- Widerstand versus manipulative Beeinflussung
- Erziehungspolitik und Weltanschauung: Die Schule als machtpragmatisches Instrument
- Hitlers „Mein Kampf" als Grundlage der NS-Ideologie
- Der nationalsozialistische Rassebegriff
- Das Auslese-Prinzip
- Das Führer-Gefolgschaftsprinzip
- Vorstellung einer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft
- Hitlers nationalpolitische Erziehungsgrundsätze und -ziele
- Umbruch traditioneller Erziehungswerte
- „Körperliche Ertüchtigung"
- Charaktererziehung
- Wissensbildung
- Umerziehung durch einen totalitären Erziehungsstaat
- Die Schule im Positionsgefüge des nationalsozialistischen Erziehungssystems
- Umbruch traditioneller Erziehungswerte
- Hitlers „Mein Kampf" als Grundlage der NS-Ideologie
- Die erste Phase des nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungswesens in der Dynamik der Machtergreifung und Machtsicherung am Beispiel der Schule
- Politische Maßnahmen und Erlasse zur äußeren Umgestaltung der Schule (1933-1936)
- Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
- Prozess der Gleichschaltung durch den NSLB
- Anpassungsbereitschaft der Lehrerschaft
- Umbruch in der Lehrerbildung
- Gesetz gegen Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen
- Umsetzung der NS-Ideologie in Unterrichtsinhalten und -mitteln
- Umgestaltung der Unterrichtsfächer
- Funktion der Schulbücher im „Dritten Reich"
- Emotionale Beeinflussung der Schüler- und Lehrerschaft
- Politische Maßnahmen und Erlasse zur äußeren Umgestaltung der Schule (1933-1936)
- Unterrichtswirklichkeit und Grenzen der nationalsozialistischen Schulpolitik
- Verhalten der Lehrerschaft im „Dritten Reich"
- Grenzen der Schulpolitik unter dem NS-Regime
- Auswirkungen der NS-Schulpolitik auf die Schüler
- Zeugenaussagen über die Schulzeit im „Dritten Reich"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der historischen und kritischen Analyse der Erziehung und Bildung im Dritten Reich. Sie untersucht die Ursachen, die zu einer heterogenen Gestalt des Schullebens unter der NS-Herrschaft führten, und analysiert die Auswirkungen der nationalsozialistischen Erziehungspolitik auf die Schule, die Lehrerschaft und die Schüler.
- Die Rolle der Pädagogik im Dritten Reich und die Herausforderungen der historischen Forschung
- Die pädagogische Lage vor 1933 und die Einflüsse der Weimarer Republik
- Die nationalsozialistische Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Erziehung
- Die Gleichschaltung des Schulwesens und die Anpassungsbereitschaft der Lehrerschaft
- Die Grenzen der nationalsozialistischen Schulpolitik und die Auswirkungen auf die Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und erläutert den bisherigen Forschungsstand zur Erziehung im Dritten Reich. Sie zeigt die unterschiedlichen Ansätze auf, die in der Forschung verwendet werden, und beleuchtet die Kontroversen und die Komplexität des Themas.
Das zweite Kapitel untersucht die Bildungspolitik und die pädagogische Lage in der Weimarer Republik. Es werden die Herausforderungen der Reformpädagogik und die Entwicklung konkurrierender Positionen dargestellt, die bereits Elemente des nationalsozialistischen Gedankenguts enthielten. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Schule und die Lehrerschaft werden ebenfalls analysiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der nationalsozialistischen Ideologie, die in Hitlers „Mein Kampf" formuliert wurde. Es werden die zentralen Elemente der NS-Weltanschauung, wie der Rassegedanke, das Auslese-Prinzip und das Führer-Gefolgschaftsprinzip, erläutert. Hitlers Erziehungsgrundsätze und -ziele werden anhand von Zitaten aus „Mein Kampf" analysiert, wobei die Umwertung traditioneller Erziehungswerte und die Bedeutung der „körperlichen Ertüchtigung", der „Charaktererziehung" und der „Wissensbildung" im nationalsozialistischen Sinne beleuchtet werden.
Das vierte Kapitel widmet sich der ersten Phase des nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungswesens in der Dynamik der Machtergreifung und Machtsicherung. Es werden die politischen Maßnahmen und Erlasse zur äußeren Umgestaltung der Schule, wie das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" und der Prozess der Gleichschaltung durch den NSLB, dargestellt. Die Anpassungsbereitschaft der Lehrerschaft und die Umgestaltung der Lehrerbildung werden ebenfalls analysiert.
Das fünfte Kapitel untersucht die Unterrichtswirklichkeit und die Grenzen der nationalsozialistischen Schulpolitik. Es werden das Verhalten der Lehrerschaft im „Dritten Reich", die Grenzen der NS-Schulpolitik und die Auswirkungen auf die Schüler sowie die Zeugenaussagen über die Schulzeit im „Dritten Reich" analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erziehung und Bildung im Dritten Reich, die nationalsozialistische Ideologie, die Gleichschaltung des Schulwesens, die Anpassungsbereitschaft der Lehrerschaft, die Grenzen der nationalsozialistischen Schulpolitik, die Auswirkungen auf die Schüler und die Rolle der Pädagogik in einer Diktatur. Empirische Forschungsergebnisse und Zeitzeugenberichte werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der Erziehung und Bildung unter der NS-Herrschaft zu beleuchten. Der Text analysiert die unterschiedlichen Ansätze der Forschung und beleuchtet die Kontroversen und die Komplexität des Themas.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der NS-Schulpolitik?
Das Hauptziel war die „Gleichschaltung“ des Schulwesens und die Funktionsminderung der Schule als Ort freier Bildung, um sie stattdessen als machtpragmatisches Instrument zur Indoktrination zu nutzen.
Welche Erziehungsgrundsätze formulierte Hitler in „Mein Kampf“?
Hitler priorisierte die „körperliche Ertüchtigung“ und Charaktererziehung (Gehorsam, Willenskraft) weit vor der rein wissenschaftlichen Wissensbildung, basierend auf dem Rassebegriff und dem Führerprinzip.
Warum war die Lehrerschaft anfällig für die NS-Ideologie?
Viele Pädagogen waren bereits durch die Krisen der Weimarer Republik und antidemokratische Tendenzen geprägt. Der Prozess der Gleichschaltung durch den NS-Lehrerbund (NSLB) verstärkte die Anpassungsbereitschaft.
Was bedeutete das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ für Schulen?
Dieses Gesetz ermöglichte es dem NS-Regime, jüdische, politisch unliebsame oder „unzuverlässige“ Lehrkräfte aus dem Schuldienst zu entfernen und die ideologische Konformität sicherzustellen.
Gab es Grenzen der nationalsozialistischen Schulpolitik?
Ja, die Unterrichtswirklichkeit entsprach nicht immer der totalitären Theorie. Es gab Spannungen zwischen traditionellen Bildungsansprüchen und den neuen ideologischen Inhalten sowie Unterschiede im Verhalten einzelner Lehrer.
- Quote paper
- Caro Ga (Author), 2010, Erziehung und Bildung im Dritten Reich. Eine historisch-kritische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267835