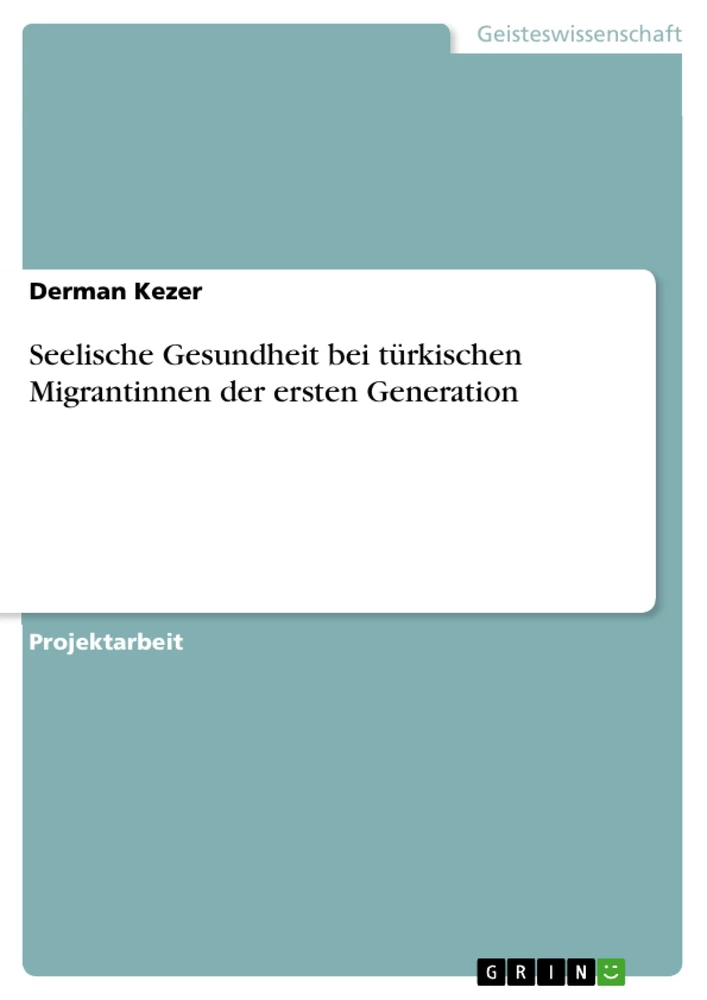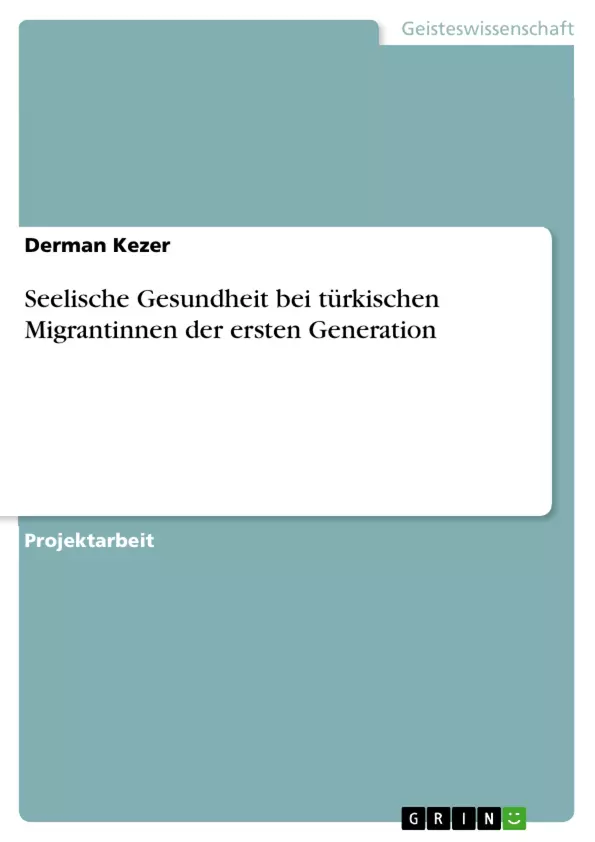Dieses Projekt befasst sich mit der Zielgruppe der türkischen Migrantinnen der ersten Generation. Im Zentrum steht die Frage, wie sie damals mit ihrer seelischen Situation umgegangen sind bzw. erlebt haben, und welche Veränderungen sie sich wünschen und es heute besser machen könnten. Um auch deren seelisches Empfinden herauszuarbeiten basiert die Methodik des Projektes auf eine autobiographische Herangehensweise, welche die Lebenssituation in den Blick nimmt. In diesem Zusammenhang werden die Schwerpunkte auf familiäre Erziehungsmuster, Sozialisation, Bildungsverlaufbahn und sozialer Status festgelegt. Ferner geht es in die theoretischen Grundlagen und dann um die Konsensfindung in Bezug auf die Ziele, die man im Projekt erreichen will. Dann wird die genaue Projektplanung mit der speziellen Ausgangslage des Praxisprojektes geplant und anschließend durchgeführt. Im letzten Teil werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Ausgangsfragestellung evaluiert und die Ergebnisse auf ihre Aussagekräftigkeit geprüft. Zum Schluss werden alle Ergebnisse in eigenen Worten im Fazit zusammengefasst.
Trotz des wachsenden Bevölkerungsanteils der türkischen Migranten in Deutschland, gibt es bisher nur wenige Erkenntnisse über dessen seelischen Zustand. Die Frage, ob Menschen mit Migrationshintergrund mehr an seelischen Störungen leiden als der Durchschnitt gegenüber der deutschen Bevölkerung, gibt es nun bisher immer wieder recht kontroverse theoretische Aussagen. Tatsache ist aber, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der deutschen Bevölkerung, größere Hindernisse überwinden müssen, um einigermaßen adäquat behandelt zu werden. Meist mangelt es an sprachlichen Barrieren oder an kulturellem Verständnis des Behandelnden.
Es ist mir in diesem Projekt wichtig, ein Verständnis für Schwierigkeiten in Bezug auf seelische Gesundheitsprobleme der türkischen Migrantinnen der ersten Generation aufzubringen und zu eruieren, Defizite festzustellen, und mit ihnen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Ambitioniert ist, dass Schweigen der türkischen Migrantinnen zu durchbrechen. Sie alle sollen hier die Chance bekommen sich über die Auswanderung und die damit verbundenen Probleme auseinander zu setzen. Sie alle sollen nicht schweigen, weil sie schweigen wollen, sondern weil sie vielleicht nie gefragt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Ein kurzer Überblick über die Aleviten und das Alevitentum
- Migrationsgeschichte in Deutschland
- Migration und Risiken psychischer Störungen
- Hintergrund des Projekts
- Ausgangslage
- Handlungsziele des Praxisprojekts:
- Der organisatorische Rahmen
- Projektmanagement
- Zielgruppen
- Projektumfang (Meilensteine)
- Projektdurchführung
- Auswertung und Ergebnisse
- Ergebnisse der Auswertung
- Woher sie kamen: Verschiedenheiten in den Migrationsbiographien
- Emigrationserwartungen
- Die Frauen erwarben ihre Schulbildung nicht in Deutschland
- Arbeit.
- Wie sie leben: Soziale Bedingungen und räumliches Wohnumfeld
- Zusammenfassung der Erhebung
- Evaluation.
- Fazit.
- Leitfaden für die Interviews mit den türkischen Migrantinnen..
- Fragebogen
- Fragebogen
- Fragebogen
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Praxisprojekt "Seelische Gesundheit bei türkischen Migrantinnen der ersten Generation" befasst sich mit der psychischen Situation von türkischen Migrantinnen der ersten Generation in Deutschland. Ziel ist es, ein Verständnis für deren Schwierigkeiten in Bezug auf seelische Gesundheitsprobleme zu entwickeln, Defizite festzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erforschung der Lebenssituation und Lebensorientierung der Frauen im kulturellen Kontext, sowie auf deren Wünschen und Bereitschaft, eine Verbesserung ihrer Situation anzustreben.
- Die Auswirkungen von Migration auf die seelische Gesundheit türkischer Migrantinnen der ersten Generation
- Die Rolle von familiären Erziehungsmustern, Sozialisation und Bildungsverlauf in Bezug auf die psychische Gesundheit
- Die Herausforderungen der Integration und die damit verbundenen Belastungen für die Migrantinnen
- Das Informationsdefizit und der Bedarf an seelischer Unterstützung bei türkischen Migrantinnen der ersten Generation
- Die Bedeutung von Sprache und Kultur für die psychische Gesundheit und die Versorgung von Migrantinnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Seelische Gesundheit bei türkischen Migrantinnen der ersten Generation" dar und verdeutlicht die Notwendigkeit, sich mit den psychischen Bedürfnissen dieser Gruppe auseinanderzusetzen. Der Fokus liegt auf der mangelnden Erkenntnis über den seelischen Zustand von türkischen Migrantinnen in Deutschland und den Herausforderungen, die sie im Integrationsprozess bewältigen müssen.
Das Kapitel „Theoretische Grundlagen" liefert einen Überblick über die Aleviten und das Alevitentum, beleuchtet die Migrationsgeschichte in Deutschland und analysiert die Risiken psychischer Störungen im Zusammenhang mit Migration. Es wird deutlich, dass Migration ein komplexer Prozess ist, der mit zahlreichen Herausforderungen verbunden ist und die psychische Gesundheit von Migrantinnen belasten kann.
Der Abschnitt „Hintergrund des Projekts" erläutert die Ausgangslage des Projekts und beschreibt die Situation türkischer Migrantinnen der ersten Generation in Deutschland. Es wird auf die spezifischen Belastungen hingewiesen, denen diese Frauen ausgesetzt sind, wie z.B. Isolation, Diskriminierung und mangelnde Sprachkenntnisse. Die Verbindung zwischen Migration, gesellschaftlichen Normen und psychischer Gesundheit wird hergestellt.
Die „Handlungszielsetzung des Praxisprojekts" definiert die Ziele des Projekts, die darauf abzielen, die psychische Gesundheit der türkischen Migrantinnen der ersten Generation zu verbessern. Es werden konkrete Punkte wie die Abbau von Unkenntnissen in Bezug auf die psychische Versorgung, der Aufbau eines gleichberechtigten Zugangs zu psychischer Unterstützung und die Verbesserung des psychosozialen Wohlbefindens der Frauen genannt. Die Bedeutung der Auflösung von Tabus und die Förderung eines nicht-fatalistischen Umgangs mit psychischen Problemen wird betont.
Der Abschnitt „Der organisatorische Rahmen" beschreibt die Projektmanagementstruktur und die Zielgruppe des Projekts. Es wird auf die Rolle des Alevitischen Kulturzentrums in Duisburg-Marxloh als Träger des Projekts und die spezifische Zielgruppe der türkischen Migrantinnen der ersten Generation aus dem Ballungsraum Ruhrgebiet eingegangen.
Das Kapitel „Projektdurchführung" schildert die Durchführung des Projekts in drei Gruppensitzungen. Es wird auf die Herausforderungen bei der Arbeit mit der Zielgruppe, die spezifischen Bedürfnisse der Frauen und die angewandten Methoden wie narrative Interviews und Gruppendiskussionen eingegangen. Die Ergebnisse der Gruppensitzungen werden detailliert dargestellt.
Die „Auswertung und Ergebnisse" des Projekts analysieren die Daten, die im Rahmen der Interviews und Gruppendiskussionen gewonnen wurden. Es werden Informationen über die Migrationsbiographien der Frauen, ihre Erwartungen an die Emigration, ihre Bildung und Arbeitssituation sowie ihre sozialen Bedingungen und ihr räumliches Wohnumfeld präsentiert. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen die Herausforderungen, die die Frauen im Integrationsprozess bewältigen mussten, und die Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit.
Die „Evaluation" des Projekts bewertet die Ergebnisse und die Erreichung der gesetzten Ziele. Es wird auf die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit der Zielgruppe, die Herausforderungen bei der Nutzung psychologischer Betreuung und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Frauen hingewiesen. Die Ergebnisse des Projekts werden im „Fazit" zusammengefasst. Es wird deutlich, dass die türkischen Migrantinnen der ersten Generation mit zahlreichen Belastungen konfrontiert waren und sind, die ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die seelische Gesundheit, türkische Migrantinnen, erste Generation, Integration, Diskriminierung, Isolation, Sprachbarrieren, familiäre Erziehungsmuster, Sozialisation, Bildungsverlauf, psychische Störungen, psychosomatische Erkrankungen, traditionelle Helfer, Kultur, Religion, Informationsdefizit, Bedarf an seelischer Unterstützung, psychosoziale Versorgung, Alevitische Gemeinde, Duisburg-Marxloh, Ruhrgebiet.
Häufig gestellte Fragen
Welche seelischen Belastungen erleben türkische Migrantinnen der ersten Generation?
Häufige Belastungen sind Isolation, Sprachbarrieren, Diskriminierungserfahrungen und der Konflikt zwischen traditionellen Werten und der neuen Gesellschaft.
Warum nehmen diese Frauen seltener psychologische Hilfe in Anspruch?
Sprachliche Barrieren, kulturelle Missverständnisse seitens der Behandler und ein Tabu innerhalb der eigenen Kultur erschweren den Zugang.
Welche Rolle spielt das Alevitentum in dieser Studie?
Die theoretischen Grundlagen bieten einen Überblick über das Alevitentum als kulturellen und religiösen Hintergrund vieler Teilnehmerinnen.
Was war das Ziel des Praxisprojekts in Duisburg-Marxloh?
Das Projekt wollte das Schweigen brechen, die Frauen über Versorgungsmöglichkeiten aufklären und Verbesserungsvorschläge für ihr Wohlbefinden erarbeiten.
Wie wurde die Untersuchung methodisch durchgeführt?
Die Methodik basierte auf einer autobiographischen Herangehensweise mit narrativen Interviews und Gruppendiskussionen.
- Quote paper
- Derman Kezer (Author), 2011, Seelische Gesundheit bei türkischen Migrantinnen der ersten Generation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267842