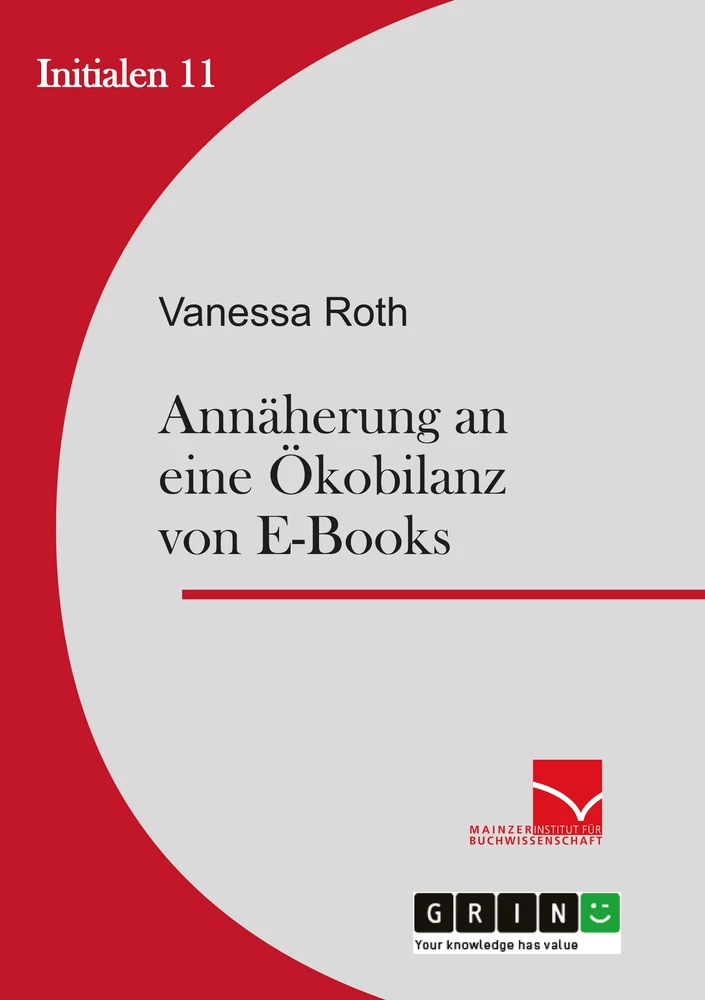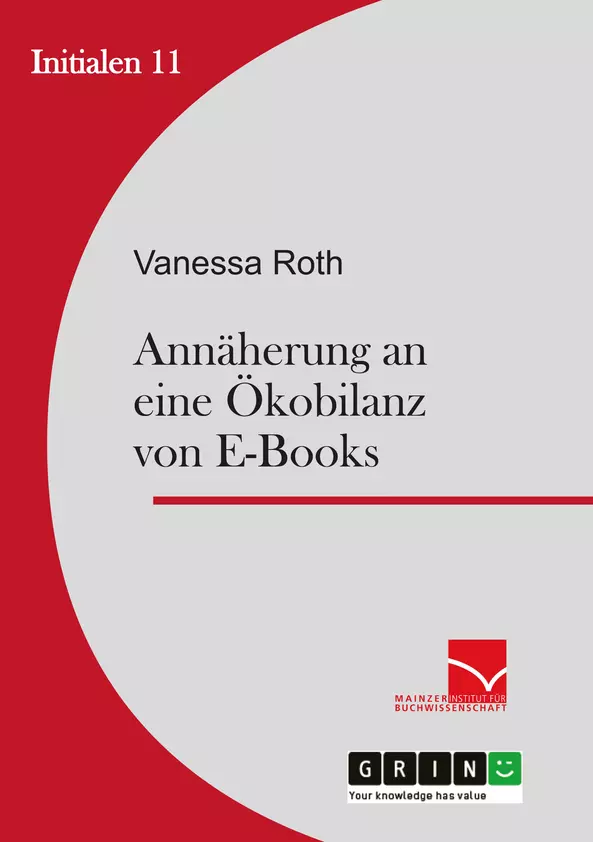Nachhaltigkeit und Umweltschutz, in allen gesellschaftlichen Bereichen viel diskutierte Themen, sind auch in der Buchbranche vor allem in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt worden. Doch wie kann man die These, ein E-Reader und das E-Book seien umweltfreundlicher als das klassische Buch, belegen bzw. wiederlegen?
Vanessa Roth analysiert und vergleicht in ihrer Bachelorarbeit das gedruckte Buch und das E-Book. Sie zeigt Problematiken, auftretende Fehler und die Voraussetzungen auf, die in der Buchbranche gegeben sein müssen, um eine Ökobilanz aufstellen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definitionen und theoretische Grundlagen
2.1 Definition der Begriffe Buch und E-Book
2.2 Ökobilanzen
2.2.1 Definition und Charakteristika der Ökobilanzierung
2.2.2 Gründe und Ziele einer Bilanzierung
2.2.3 Abgrenzung zu weiteren Bewertungsmethoden
2.2.4 Aufbau einer Ökobilanz
2.2.5 Probleme bei der Ökobilanzierung
2.2.6 Empirische Befunde zum Einsatz von Ökobilanzen
2.2.7 Einsatzpotenziale im Buchmarkt
3 Analyse bisheriger Ökobilanzierungen von E-Books
3.1 Moberg, Borggren und Finnveden: Books from an environmental perspective
3.2 Öko-Institut Freiburg: PROSA E-Book-Reader
3.3 Kritische Analyse der Bilanzierungsversuche
4 Exemplarische Annäherung an eine Ökobilanz von E-Books
4.1 Zielsetzung, Funktion und funktionelle Einheit
4.2 Herleitung der Produktlebenswege aus der Struktur des Buchmarktes
4.2.1 Der Buchmarkt und der Lebenszyklus des gedruckten Buches
4.2.2 Der Buchmarkt und der Lebenszyklus des E-Books
4.3 Probleme der Identifikation von Einflussfaktoren
4.3.1 Probleme der Identifikation von Einflussfaktoren und der Datenerfassbarkeit innerhalb des Lebenszykluses von E-Books
4.3.2 Probleme der Identifikation von Einflussfaktoren und der Datenerfassbarkeit innerhalb des Lebenszykluses von E-Book-Readern
5 Fazit und Ausblick: Ökobilanzen von E-Books
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Ist ein E-Book umweltfreundlicher als ein gedrucktes Buch?
Die Arbeit analysiert diese These kritisch und untersucht die Voraussetzungen, unter denen eine solche Aussage belegt oder widerlegt werden kann.
Was ist der Schwerpunkt der Analyse von Vanessa Roth?
Sie vergleicht das gedruckte Buch und das E-Book hinsichtlich ihrer Ökobilanz und zeigt Problematiken sowie Fehlerquellen bei der Bilanzierung auf.
Welche Studien zur Ökobilanz von E-Books werden herangezogen?
Es werden unter anderem Untersuchungen von Moberg, Borggren und Finnveden sowie des Öko-Instituts Freiburg (PROSA E-Book-Reader) analysiert.
Welche Faktoren erschweren eine exakte Ökobilanzierung?
Schwierigkeiten liegen in der Identifikation von Einflussfaktoren über den gesamten Lebenszyklus und der Datenerfassbarkeit bei Readern und digitalen Inhalten.
Wie ist eine Ökobilanz im Buchmarkt aufgebaut?
Die Arbeit beschreibt den Aufbau einer Ökobilanz, definiert Ziele und grenzt sie von anderen Bewertungsmethoden im Buchmarkt ab.
- Quote paper
- Vanessa Roth (Author), 2013, Annäherung an eine Ökobilanz von E-Books, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267858