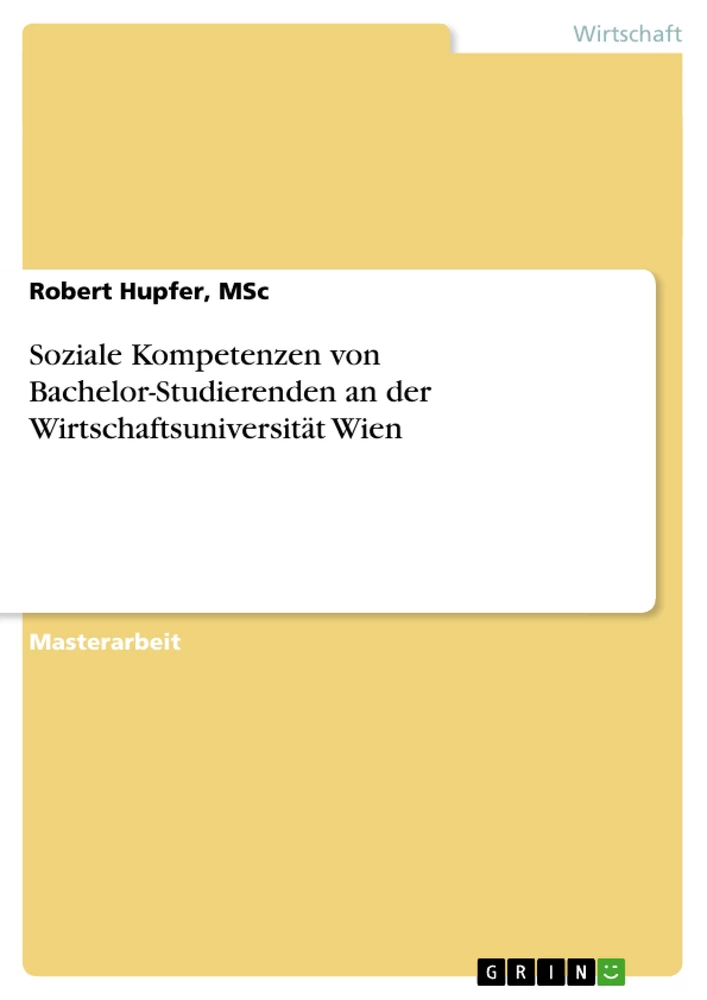Mit dem Begriff der sozialen Kompetenz werden häufig Eigenschaften wie teamfähig, kommunikativ oder konfliktfähig in Verbindung gebracht. Jemand gilt
als ein sozial kompetenter Mensch, wenn er gut mit anderen umgehen und schwierige soziale Situationen bewältigen kann. Daher erscheint es logisch, dass
soziale Kompetenzen nicht nur privat, sondern auch beruflich eine wesentliche Anforderung darstellen (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008, S. 67).
Der berufliche Erfolg einer Person kann sehr unterschiedlich definiert werden. Mögliche Indikatoren wären z. B. das Gehalt, die Geschwindigkeit des
hierarchischen Aufstiegs in einem Unternehmen, die eigene Arbeitszufriedenheit oder die Zufriedenheit von Kund/innen und nachgeordneten Mitarbeiter/innen. Der
Erfolg ist, wie auch immer er im konkreten Fall definiert wird, das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels vieler Faktoren. Bei einem Versicherungsvertreter ist
er z. B. nicht nur zu 100 % durch dessen Fähigkeit zur Perspektivenübernahme oder durch Extraversion determiniert, sondern auch fachliche Kompetenzen, eine
hohe Leistungsmotivation, die Arbeitsumwelt etc. spielen eine Rolle. Jede einzelne soziale Kompetenz ist somit nur ein Baustein des beruflichen Erfolgs (vgl. Kanning
2005, S. 16f.). Dennoch wird soziale Kompetenz häufig als Schlüsselqualifikation bezeichnet (vgl. z. B. Wellhöfer 2004, S. 1). Ein Blick auf für Absolvent/innen eines
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums relevante Stellenanzeigen (z. B. in Tageszeitungen) bestätigt, dass soziale Kompetenzen für zahlreiche Berufsfelder
als wesentlich angesehen werden. Es existieren kaum Stellenausschreibungen, welche nicht zumindest einzelne den sozialen Kompetenzen zurechenbare Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen oder Eigeninitiative
anführen. Dies betrifft nicht nur Positionen, deren Tätigkeitsprofil zahlreiche soziale Kontakte umfasst. Auch Mitarbeiter/innen im Backoffice-Bereich oder im
internen Rechnungswesen sollen z. B. konfliktfähig, teamfähig oder kommunikativ sein (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008, S. 67).
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. PROBLEMSTELLUNG
1.1. BEDEUTUNG VON SOZIALEN KOMPETENZEN
1.2. ZIELSETZUNGEN DER ARBEIT
1.3. AUFBAU DER ARBEIT
2. SOZIALE KOMPETENZ
2.1. EINORDNUNG UND DEFINITION DES BEGRIFFS
2.1.1. Kompetenzdimensionen
2.1.2. Abgrenzung zu anderen Begriffen
2.1.3. Dimensionen sozialer Kompetenz
2.2. AUSGEWÄHLTE KATEGORIEN SOZIALER KOMPETENZ
2.2.1. Kommunikationsfähigkeit Exkurs: Transaktionsanalyse
2.2.2. Kooperationsfähigkeit
2.2.3. Konfliktfähigkeit
2.2.4. Verhandlungsführung
2.2.5. Sensitivität
2.2.6. Kontaktfähigkeit
2.2.7. Soziabilität
2.2.8. Teamorientierung
2.2.9. Durchsetzungsstärke Exkurs: Soziale Kompetenz bei Führungskräften
2.3. ENTWICKLUNG SOZIALER KOMPETENZ
2.3.1. Behavioristische Lerntheorien
2.3.2. Kognitive Lerntheorien
2.3.3. Sozial-kognitive Lerntheorien
2.3.4. Handlungstheoretische und konstruktivistische Didaktikansätze
2.3.5. Wissensorientierte Verfahren
2.3.6. Verhaltensorientierte Verfahren
2.3.7. Beratungsorientierte Verfahren
2.3.8. Selbsterfahrungsorientierte Verfahren Exkurs: Gruppenarbeit
2.3.9. Lernphasen zur Entwicklung von Sozialkompetenzen
2.4. MESSUNG UND DIAGNOSE SOZIALER KOMPETENZ
2.4.1. Gütekriterien der Sozialkompetenzmessung
2.4.2. Methoden zur Messung sozialer Kompetenzen
2.5. SOZIALE KOMPETENZ AN DER UNIVERSITÄT
2.5.1. Soziale Kompetenz an der WU
2.5.2. Bedeutung der Eingangsvoraussetzungen der Studierenden für die Förderung der „sozialen Kompetenz“
3. EMPIRISCHE ANALYSE
3.1. ZIELSETZUNG DER ANALYSE
3.2. UNTERSUCHUNGSDESIGN UND METHODE
3.3. UMGEBUNG
3.4. QUALITATIVE ANALYSE
3.4.1. Erhebungsverfahren
3.4.2. Art von Daten
3.4.3. Auswertung
3.4.4. Interpretation
3.5. QUANTITATIVE ANALYSE
3.5.1. Erhebungsverfahren
3.5.2. Auswertung
3.5.3. Interpretation
4. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE
4.1. THEORETISCHER BEZUG
4.2. ERHEBUNG
4.3. WESENTLICHE ERGEBNISSE DER ERHEBUNGEN
4.3.1. Qualitativer Teil
4.3.2. Quantitativer Teil
4.4. GRENZEN DER ERHEBUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG 169
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Häufigkeit internationaler Publikationen zum Konzept der sozialen Kompetenz
Abbildung 2: Struktur der Handlungskompetenz
Abbildung 3: Beziehung zwischen sozialer Kompetenz und verwandten Konzepten .
Abbildung 4: Individuum, Unternehmen und Gesellschaft
Abbildung 5: Allgemeine soziale Kompetenzen
Abbildung 6: Zwei-Ebenen-Modell der Kommunikation
Abbildung 7: 4 Seiten der Kommunikation - ein Modellstück der zwischenmenschlichen Kommunikation
Abbildung 8: Ansatzpunkte zur Verbesserung sozial kompetenten Verhaltens
Abbildung 9: Lernschritte in der Entwicklung von Sozialkompetenzen
Abbildung 10: Konzept für das Erlernen sozialer Kompetenz
Abbildung 11: Methodische Zugänge zur Erfassung sozialer Kompetenzen
Abbildung 12: Beispiel für eine Richtig/Falsch-Aufgabe
Abbildung 13: Beispiel für eine Mehrfachwahl-Aufgabe
Abbildung 14: Beispiel für ein Item zur Interpretation von Stimmungen
Abbildung 15: Beispiele für Bewertungsskalen
Abbildung 16: Beispiele für soziale Kompetenzen und ihre mögliche
Abbildung 17: Beispiele für Fragebogenitems zur Messung sozialer Kompetenzen .
Abbildung 18: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse
Abbildung 19: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung
Abbildung 20: Assoziationen mit dem Begriff "Soziale Kompetenz", n = 90
Abbildung 21: Fähigkeiten einer Person, die "sozial kompetent" ist, n = 91
Abbildung 22: Begründung der Selbsteinschätzung für die eigene soziale Kompetenz, n = 92
Abbildung 23: Vorbereitung auf Verhandlungsgespräch, n = 92
Abbildung 24: Vorbereitung auf eine Präsentation, n = 90
Abbildung 25: Mögliche Konfliktursache bei Beschreibung der Situation zu Frage 6, n = 72
Abbildung 26: Umgang mit Konflikten, n = 91
Abbildung 27: In der Gruppe arbeiten, n = 92
Abbildung 28: Anzahl der Kategorien der Fragen der qualitativen Analyse
Abbildung 29: Beurteilungen für das MSA-Kriterium
Abbildung 30: Anzahl der genannten Werte bei der offenen Frage
Abbildung 31: Anzahl der genannten Werte bei der offenen Frage nach Geschlecht
Abbildung 32: Anzahl der genannten Werte bei der offenen Frage nach Studiendauer
Abbildung 33: Einteilung der Begründung der Selbsteinschätzung in „positive“ und „negative“ Eigenschaften
Abbildung 34: Einteilung der Begründung der Selbsteinschätzung in Kategorien ...
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Themenblöcke der Ringvorlesung
Tabelle 2: Workshops im Bereich sozialer Kompetenz
Tabelle 3: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung der 5 häufigsten Kategorien zu Frage 1
Tabelle 4: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung der 5 häufigsten Kategorien zu Frage 2
Tabelle 5 Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung zu Frage 3
Tabelle 6 Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung zu Frage 4
Tabelle 7: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung zu Frage 5
Tabelle 8: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung zu Frage (Konfliktursache)
Tabelle 9: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung zu Frage 6 (Umgang mit Konflikt)
Tabelle 10: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung zu Frage 7
Tabelle 11: Häufigkeiten - Geschlecht der Studierenden
Tabelle 12: Sensitivität sortiert nach Mittelwerten (alle Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert 122 Tabelle 13: Häufigkeiten - Sensitivität (einzelne Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 14: Kontaktfähigkeit sortiert nach Mittelwerten (alle Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 15: Häufigkeiten - Kontaktfähigkeit (einzelne Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert 127 Tabelle 16: Soziabilität sortiert nach Mittelwerten (alle Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert 129 Tabelle 17: Häufigkeiten - Soziabilität (einzelne Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 18: Teamorientierung sortiert nach Mittelwerten (alle Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 19: Häufigkeiten - Teamorientierung (einzelne Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 20: Durchsetzungsstärke sortiert nach Mittelwerten (alle Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 21: Häufigkeiten - Durchsetzungsstärke (einzelne Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 22: Zusatzitems sortiert nach Mittelwerten (alle Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert 139 Tabelle 23: Häufigkeiten - Zusatzitems (einzelne Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 24: Gruppenstatistik nach dem Geschlecht (signifikante Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 25: Häufigkeiten - Studiendauer
Tabelle 26: Gruppenstatistik nach der Studiendauer (signifikante Items), negativ formulierte Items umcodiert, 1 entspricht dem günstigsten, 6 dem ungünstigsten Wert
Tabelle 27: KMO- und Bartlett-Test - Sensitivität
Tabelle 28: KMO- und Bartlett-Test - Kontaktfähigkeit
Tabelle 29: KMO- und Bartlett-Test - Soziabilität
Tabelle 30: KMO- und Bartlett-Test - Teamorientierung
Tabelle 31: KMO- und Bartlett-Test - Durchsetzungsstärke
Tabelle 32: Ergebnisse der Kategorienbildung zur offenen Frage nach „positiven“ und „negativen“ Eigenschaften
Tabelle 33: Ergebnisse der Kategorienbildung zur offenen Frage
Tabelle 34: Übersicht über die Anzahl nicht beantworteter Fragen
Tabelle 35: Zusammenfassende Darstellung der absoluten Häufigkeiten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Problemstellung
1.1. Bedeutung von sozialen Kompetenzen
Mit dem Begriff der sozialen Kompetenz1 werden häufig Eigenschaften wie teamfähig, kommunikativ oder konfliktfähig in Verbindung gebracht. Jemand gilt als ein sozial kompetenter Mensch, wenn er gut mit anderen umgehen und schwierige soziale Situationen bewältigen kann. Daher erscheint es logisch, dass soziale Kompetenzen nicht nur privat, sondern auch beruflich eine wesentliche Anforderung darstellen (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008, S. 67).
Der berufliche Erfolg einer Person kann sehr unterschiedlich definiert werden. Mögliche Indikatoren wären z. B. das Gehalt, die Geschwindigkeit des hierarchischen Aufstiegs in einem Unternehmen, die eigene Arbeitszufriedenheit oder die Zufriedenheit von Kund/innen und nachgeordneten Mitarbeiter/innen. Der Erfolg ist, wie auch immer er im konkreten Fall definiert wird, das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels vieler Faktoren. Bei einem Versicherungsvertreter ist er z. B. nicht nur zu 100 % durch dessen Fähigkeit zur Perspektivenübernahme oder durch Extraversion determiniert, sondern auch fachliche Kompetenzen, eine hohe Leistungsmotivation, die Arbeitsumwelt etc. spielen eine Rolle. Jede einzelne soziale Kompetenz ist somit nur ein Baustein des beruflichen Erfolgs (vgl. Kanning 2005, S. 16f.).
Dennoch wird soziale Kompetenz häufig als Schlüsselqualifikation bezeichnet (vgl.z. B. Wellhöfer 2004, S. 1). Ein Blick auf für Absolvent/innen eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums relevante Stellenanzeigen (z. B. in Tageszeitungen) bestätigt, dass soziale Kompetenzen für zahlreiche Berufsfelder als wesentlich angesehen werden. Es existieren kaum Stellenausschreibungen, welche nicht zumindest einzelne den sozialen Kompetenzen zurechenbare Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen oder Eigeninitiative anführen. Dies betrifft nicht nur Positionen, deren Tätigkeitsprofil zahlreiche soziale Kontakte umfasst. Auch Mitarbeiter/innen im Backoffice-Bereich oder im internen Rechnungswesen sollen z. B. konfliktfähig, teamfähig oder kommunikativ sein (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008, S. 67).
Dieses große Interesse an sozialen Kompetenzen wurde durch eine Reihe von Veränderungen gesellschaftlicher und technologischer Art ausgelöst (vgl.Schuler/Barthelme 1995, S. 78). So führen z. B. der gesamtwirtschaftliche Strukturwandel, die Internationalisierung von Märkten und Unternehmen oder die Einführung neuer Technologien zu einer Umgestaltung von Tätigkeiten und Arbeitsabläufen und wirken sich somit auf die beruflichen Anforderungen an die Beschäftigten aus. Der Mensch nimmt dadurch eine zentralere Rolle im Betriebsgeschehen ein und erweist sich zunehmend als „Motor des Fortschritts, der die Gangart und die Geschwindigkeit bestimmt“ (Faix/Laier 1991, S. 7). Dabei rücken die sozialen Kompetenzen immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses.
Auch die Zunahme der Publikationen, die sich mit dem Thema der sozialen Kompetenz beschäftigen, bestätigt diesen Trend (vgl. Abbildung 1). Ein Großteil der Forschungsarbeiten davon stammt aus der klinischen Psychologie und der Entwicklungspsychologie, nur ein relativ geringer Teil kann der Personalpsychologie zugeordnet werden. Es gibt jedoch auch viele Untersuchungen, welche zwar nicht explizit das Label „soziale Kompetenz“ tragen, sich aber dennoch intensiv mit dem Sozialverhalten von Menschen im beruflichen Kontext beschäftigen. Ein Beispiel hierfür bietet die umfangreiche Literatur zum Thema Führungsverhalten (vgl. Kanning 2005, S. 1f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Häufigkeit internationaler Publikationen zum Konzept der sozialen Kompetenz (Quelle: Kanning 2005, S. 2)
Dass soziale Kompetenz als eine wesentliche Voraussetzung für persönliche und wirtschaftliche Erfolge gesehen wird, schlägt sich auch auf den Bildungssektor durch. So wurde z. B. vom Land Oberösterreich im Rahmen des Wirtschaftsprogramms „Innovatives Oberösterreich 2010“ eine eigene Maßnahme zur Förderung von sozialer Kompetenz ins Leben gerufen. Diese soll Pädagog/innen, Kindergartenkinder, Schüler/innen, Lehrlinge, Student/innen sowie Kursteilnehmer/innen unterschiedlichster Fortbildungseinrichtungen erfassen. Ziel ist es, die Förderung sozialer Kompetenz langfristig als einen fixen Bestandteil in das Bildungssystem zu integrieren (vgl.Knierzinger/Pöchhacker/Krippner 2007, S. V).
Im Studienplan für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) wird beschrieben, dass das Studium für anspruchsvolle betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Tätigkeiten sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Wirtschaft und bei Nonprofit-Organisationen qualifiziert. Weiters wird darauf hingewiesen, dass neben der Vermittlung der für die Praxis relevanten Kompetenzen sowie systematischer Grundlagen und Zusammenhänge in den einzelnen wirtschafts-, rechts- und sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen, die Fachkompetenz der Studierenden durch die Entwicklung von analytischen Fähigkeiten, Sozialkompetenz sowie Sprachkompetenz ergänzt werden soll. Diese Ausbildung soll es den Absolvent/innen ermöglichen, sich in eine Vielzahl von wirtschaftsbezogenen Tätigkeitsbereichen rasch einzuarbeiten, der Entwicklung und den Innovationen der Praxis mit ihrem wirtschaftlichen Hintergrund zu folgen und durch Weiterbildung zusätzliche Expertise zu erwerben (vgl. Wirtschaftsuniversität Wien 2009, S 1f.).
Deshalb wurde an der WU ein entsprechendes Programm entwickelt, welches den Studierenden die (Weiter-) Entwicklung sozialer Kompetenzen ermöglichen soll (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008, S. 67). Die Studierenden kommen mit sehr heterogenen Eingangsvoraussetzungen an die WU. Für die Studierenden in Masterprogrammen können grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten aus dem Bereich der sozialen Kompetenz angenommen werden, da diese bereits ein Bachelorstudium absolviert haben. Da im Gegensatz dazu für die Studierenden der Bachelor-Studien keine besonderen Eingangsvoraussetzungen angenommen werden, gibt es unterschiedliche Programme für das Bachelor- und das Masterstudium, wobei nur die Vorlesung im Bachelor-Programm eine Pflichtlehrveranstaltung darstellt (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008, S. 74). Es stellt sich daher die Frage, welche Eingangsvoraussetzungen im Bereich der sozialen Kompetenz die Studierenden eines Bachelorstudiums der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU tatsächlich mitbringen.
1.2. Zielsetzungen der Arbeit
Die Zielsetzung der Arbeit liegt daher darin zu untersuchen, über welche Kenntnisse und Fähigkeiten die Bachelor-Studierenden an der WU im Bereich der sozialen Kompetenz am Beginn der Vorlesung Soziale Kompetenz verfügen. Dazu werden qualitative und quantitative Daten ausgewertet, die von Fuhrmann während der ersten Vorlesung für das Themenfeld der sozialen Kompetenz durch eine qualitative sowie eine quantitative Befragung erhoben wurden. Die Forschungsfrage kann somit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und untersucht werden.
Bei der qualitativen Erhebung wird untersucht, welche Eigenschaften und Fähigkeiten von den Studierenden mit dem Begriff der sozialen Kompetenz assoziiert und welche Problemlösungsstrategien in vorgegebenen Situationen angewendet werden. So kann untersucht werden, wie Studierende Problemsituationen ohne konkrete Vorbildung in diesem Bereich subjektiv einschätzen und zu lösen versuchen. Die Untersuchung soll außerdem zeigen, ob die Vorstellungen bzw. Assoziationen der Studierenden sehr heterogen sind oder ob sie als homogen bezeichnet werden können.
Bei der quantitativen Erhebung wird unter Zuhilfenahme des Bochumer Inventars zur berufsbezogenen Pers ö nlichkeitsbeschreibung (BIP) untersucht, wie die Studierenden ihre sozialen Kompetenzen in den Bereichen Sensitivität, Soziabilität, Kontaktfähigkeit, Teamorientierung und Durchsetzungsstärke bewerten. Dieser vorgefertigte Teil des Fragebogens wurde von Fuhrmann durch zehn weitere Items sowie eine offene Frage zur allgemeinen Einschätzung der eigenen sozialen Kompetenz ergänzt.
1.3. Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei große Teile. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen zum Begriff der sozialen Kompetenz näher erläutert. Dafür wird im ersten Schritt eine Einordnung und Definition des Begriffs vorgenommen. Danach werden ausgewählte Kategorien der sozialen Kompetenz bestimmt und beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel wird näher auf die Entwicklung und Förderung von Sozialkompetenzen eingegangen. Der nächste Abschnitt gibt einen Einblick in die Messung und Diagnose sozialer Kompetenz. Im letzten Abschnitt des theoretischen Teils wird soziale Kompetenz an der Wirtschaftsuniversität besprochen und die Bedeutung der Eingangsvoraussetzungen der Studierenden für die Förderung von Sozialkompetenzen erklärt.
Die verwendeten Forschungsdesigns, mit denen die Eingangsvoraussetzungen der Studierenden im Bereich der sozialen Kompetenz festgestellt werden, bilden den zweiten Teil der Arbeit. Zuerst werden die Ziele der Forschungsarbeit betrachtet und anschließend dem jeweiligen Forschungsdesign zugeordnet. Danach werden die verwendeten Forschungsdesigns begründet und die Ergebnisse der Analysen dargestellt und interpretiert. Dafür werden das Erhebungsverfahren und die erhobenen Daten beschrieben. Den Kern dieses Kapitels stellt jeweils die Auswertung und Interpretation der jeweiligen Ergebnisse dar.
Den Abschluss der Arbeit bildet ein Kapitel, in dem die Ergebnisse der Analysen noch einmal zusammengefasst und reflektiert werden. Dafür werden die wesentlichen Ergebnisse der Analyse angegeben, aber auch die Grenzen der Erhebung aufgezeigt.
2. Soziale Kompetenz
2.1. Einordnung und Definition des Begriffs
Obwohl sich unter dem Begriff der sozialen Kompetenz die meisten Personen (irgend)etwas vorstellen können, gibt es für diesen keine allgemein gültige Definition oder einheitliche Verwendung (vgl. Greimel-Fuhrmann/Pachlinger 2008,S. 68). Im Folgenden sollen daher zunächst eine Einordnung der sozialen Kompetenz sowie eine Abgrenzung zu verwandten Begriffen vorgenommen werden. Anschließend sollen die Ansätze verschiedener Autoren kurz beleuchtet werden, um einen Überblick über die Dimensionen bzw. wichtige Charakteristika des Begriffs zu erhalten.
2.1.1. Kompetenzdimensionen
Individuelle Kompetenzen können im Allgemeinen als ein Netzwerk von zusammenhängenden Aspekten wie Wissen, Fähigkeiten, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation verstanden werden. Sie stellen die Voraussetzung für die Bewältigung einer spezifischen Problemsituation dar (vgl. BM:BWK 2006, S. 13). Der Begriff der Sozialkompetenz wurde im Jahr 1971 von Roth in die deutsche Pädagogik eingeführt (vgl. Wellhöfer 2004, S. 1). Er sieht soziale Kompetenz als einen Aspekt der Kompetenz für eine verantwortliche Handlungsfähigkeit (Mündigkeit) und definiert sie als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig zu sein. Als weitere Elemente der Mündigkeit nennt Roth die Selbstkompetenz - die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können - und die Sachkompetenz - die Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig zu sein (vgl. Roth 1971, S. 180).
Auch bei Wellh ö fer (2004) findet sich eine vergleichbare Einteilung des allgemeinen Kompetenzbegriffs des menschlichen Handelns in die Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz. Dabei bestehen starke Überschneidungen (vgl. Abbildung2). Unter Selbst-, Ich- bzw. personaler Kompetenz versteht Wellh ö fer (2004) die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen. Es gibt enge Berührungspunkte mit der Fähigkeit, Belastungssituationen zu steuern, das eigene (Arbeits-)Verhalten zu strukturieren und zu planen sowie eigene gefühlsmäßige Reaktionen an realen Gegebenheiten auszurichten. Im Unterschied zu sozialen Kompetenzen, welche nur in einem sozialen Feld durch erlebnisorientiertes Lernen mit anderen erfahren und weiterentwickelt werden können, kann an der Selbstkompetenz auch alleine gearbeitet werden. Es wird jedoch ebenfalls Feedback, bspw. von Freund/innen oder Kolleg/innen benötigt (vgl. Wellhöfer 2004, S. 16f.).
Die häufig auch gesondert angeführte Methodenkompetenz wird in allen drei Bereichen als erforderlich und dort integriert angesehen (vgl. Wellhöfer 2004,S. 5). Sie ermöglicht es, verschiedenste Hilfsmittel zur Problemlösung heranzuziehen, effektiv zu verwenden und so vorhandenes Fachwissen besser zu nutzen, um sich in der Wissensflut besser zurechtfinden zu können (vgl. Faix/Laier 1991, S. 36f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Struktur der Handlungskompetenz (Quelle: Wellhöfer 2004, S. 5)
2.1.2. Abgrenzung zu anderen Begriffen
In Forschung und Praxis finden sich mehrere Begriffe, welche als Synonym oder als spezifischer Aspekt der sozialen Kompetenz verwendet werden. Kanning (2005) grenzt drei der wichtigsten folgendermaßen ab (vgl. Kanning 2005,S. 10ff.):
Soziale Intelligenz: Thorndike definiert soziale Intelligenz bereits 1920 als die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und „weise“ zu handeln. Sie umfasst nach dieser Definition also nicht nur Aspekte der kognitiven Informationsverarbeitung, sondern auch das Handeln an sich, was eine Verwendung als Synonym zur sozialen Kompetenz ermöglicht. In der Forschung werden jedoch bei der Testung sozialer Intelligenz überwiegend sehr abstrakte, rein kognitive Leistungsaufgaben verwendet (z. B. die richtige Deutung nonverbaler Signale oder die Ordnung von Bildern zu einer sinnvollen Bildgeschichte). In diesem reduzierten Sinne kann soziale Intelligenz jedoch nur noch als eine Facette der sozialen Kompetenz gelten.
Emotionale Intelligenz: Dieser Begriff hat vor allem durch eine populärwissenschaftliche Veröffentlichung von Goleman im Jahr 1995 große öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Daran werden jedoch die willkürliche Auswahl unterschiedlichster Fähigkeiten des Menschen (z. B. Optimismus, Gewissenhaftigkeit, Motivation, soziale Verantwortung, Empathie, Selbstvertrauen, Belastbarkeit etc.) sowie das Fehlen des verbindenden Elements dieser Fähigkeiten kritisiert. Das Konzept der emotionalen Intelligenz wurde ursprünglich von Salovey und Mayer eingeschränkter definiert. Personen mit hoher emotionaler Intelligenz können eigene Emotionen sowie die Emotionen anderer Menschen korrekt interpretieren. Zudem können sie eigene Emotionen regulieren, ausdrücken und nutzbringend einsetzen. Da die Nutzbarmachung von Emotionen auf Handlungen verweist, welche in der Folge kognitiver Operationen stehen, schlägt Asendorpf den allgemeiner gehaltenen Begriff der „emotionalen Kompetenz“ vor. Messinstrumente stehen jedoch auch hier in der Tradition der Intelligenzmessung und setzen abstrakte Leistungsaufgaben ein, die sich mit der kognitiven Verarbeitung von emotionsbezogenen Inhalten beschäftigen. Die emotionale Intelligenz scheint somit lediglich eine Teilmenge der sozialen Kompetenz zu sein und große Überschneidungen mit der sozialen Intelligenz aufzuweisen.
Soziale Fertigkeiten: Darunter können erlernte, mitunter sehr spezifische Kompetenzen verstanden werden, die notwendig für das Gelingen sozialer Interaktionen sind (z. B. Höflichkeitsrituale, Verhaltensregeln gegenüber Vorgesetzten oder Tischsitten). Dabei werden behaviorale, kommunikative und kognitive Fertigkeiten erfasst. Auch die sozialen Fertigkeiten stellen somit eine Teilmenge der sozialen Kompetenz dar.
Kanning (2005) hält demnach eine wechselseitige Abgrenzung der Begriffe für möglich und auch notwendig. Die soziale Kompetenz erscheint dabei als ein Oberbegriff, dem die übrigen angesprochenen Konzepte untergeordnet werden können (vgl. Abbildung 3). Die soziale Intelligenz bezieht sich z. B. auf das Wissen um soziale Normen, die Fähigkeit zur richtigen Interpretation nonverbaler Hinweisreize oder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und bietet somit die Basis für die Verarbeitung sozialer Informationen und die Steuerung des Sozialverhaltens. Die emotionale Intelligenz umfasst die kognitive Verarbeitung sozialer Informationen und die Steuerung des Sozialverhaltens. Beispiele hierfür sind die Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Befindlichkeit oder die Kontrolle heftiger emotionaler Reaktionen wie z. B. Aggressivität. Außerhalb des Konzeptbereichs der sozialen Intelligenz liegt die Nutzbarmachung eigener Emotionen im sozialen Kontext (z. B. zur Einforderung von Hilfe in Tränen ausbrechen). Soziale Fertigkeiten sind konkret und insbesondere zur praktischen Umsetzung eines Sozialverhaltens notwendig. Aufgrund des Bezugs zum kognitiven Bereich weisen sie Überschneidungen mit der sozialen und der emotionalen Intelligenz auf (vgl. Kanning 2005, S. 12).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Beziehung zwischen sozialer Kompetenz und verwandten Konzepten (Quelle: Kanning 2005, S. 13)
2.1.3. Dimensionen sozialer Kompetenz
Nach Faix/Laier (1991) bezeichnet soziale Kompetenz im menschlichen Miteinander „das Ausmaß, in dem der Mensch fähig ist, im privaten, beruflichen und gesamtgesellschaftlichen Kontext selbständig, umsichtig und nutzbringend zu handeln“ (Faix/Laier 1991, S. 62). Sie ist somit der Erfolgsfaktor für den Einzelnen, die Unternehmen und die Gesellschaft (vgl. Abbildung 4). Sie steht und entsteht in einem Spannungsfeld zwischen Individuum und Gemeinschaft, d.h. soziale Kompetenz ist immer ein Balanceakt zwischen Selbstverwirklichung und gelungener Anpassung an die Normen, Werte und Anforderungen der Gesellschaft. Sie bildet außerdem die Grundvoraussetzung für das Leben mit anderen, wie z. B. Familie, Freundeskreis, Schule, Unternehmen oder Gesellschaft. Durch diese Sozialisationsinstanzen wird sie auch entscheidend beeinflusst (vgl. Faix/Laier 1991, S. 62ff.).
Somit gibt es zwei Hauptaspekte, welche sich auf das Ausmaß an sozialer Kompetenz auswirken, nämlich die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit als Voraussetzung für selbständiges und selbstbewusstes Handeln sowie die Fähigkeit, in einer Gemeinschaft (Familie, Schule, Unternehmen, Gesellschaft) zu leben, zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und an gesellschaftlichen Entwicklungen aktiv als mündige Person mitzuwirken (vgl. Faix/Laier 1991, S. 62f.). Daraus ergeben sich für Faix/Laier (1991) folgende Dimensionen sozialer Kompetenz (vgl. Faix/Laier 1991, S. 63f.):
Umgang mit sich selbst: Dazu zählen Aufrichtigkeit, Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz, Ambiguitätstoleranz, Sensibilität für eigene Bedürfnisse, Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub, Selbststeuerung und Rollendistanz.
Verantwortungsbewusstsein: Dazu sollen die eigene Verantwortung gegenüber den gesellschaftlichen Gemeinschaften und der Natur erkannt, die Moral und die Ethik der gesellschaftlichen Gemeinschaften respektiert und die eigene Moral aktiv entwickelt werden.
Umgang mit anderen: Dazu zählen Kooperationsfähigkeit,Kommunikationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Kompromissfähigkeit,Toleranz, Achtung vor anderen, Verständnisbereitschaft, Vorurteilsfreiheit, Vertrauensbereitschaft, Bindungsfähigkeit, Partnerschaft, Solidarität, Offenheit, Transparenz sowie Fairness und Einfühlungsvermögen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Individuum, Unternehmen und Gesellschaft (Quelle: Faix/Laier 1991, S. 71)
Schuler/Barthelme (1995) weisen darauf hin, dass es sinnvoller ist, statt von sozialer Kompetenz von sozialen Kompetenzen zu sprechen, da es sich beim Begriff der sozialen Kompetenz genau genommen um ein ganzes Bündel von Kompetenzen handelt (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 80). Sie arbeiten vier Charakteristika als Komponenten eines Definitionsversuchs für den Begriff der sozialen Kompetenz heraus (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 81):
Interaktionskontext: Einzelne Fähigkeiten, welche dieses Charakteristikum ausmachen, zeigen sich in der Interaktion von Individuen, in der Art und Weise ihres interpersonalen Handelns. Auch seltene Interaktionen oder Kontaktvermeidung liefern Hinweise auf die soziale Kompetenz. Das jeweilige Handeln bzw. Verhalten in einem sozialen Kontext wird dabei aus einem verfügbaren Verhaltensrepertoire, entsprechend den konkreten Gegebenheiten und Erfordernissen, ausgewählt.
Situationsspezifität: Diesem Element ist die Annahme zugrunde gelegt, dass Verhaltensweisen hohe Ähnlichkeit aufweisen, wenn in unterschiedlichen Situationen gleiche oder sehr ähnliche Gegebenheiten und Erfordernisse festgestellt werden. Die Angemessenheit eines Verhaltens definiert sich im Wesentlichen anhand von Regeln und Erwartungen an das Verhalten der anderen. Normen und Rollenvorgaben bilden dabei die Grundlage für die Regelungen zwischenmenschlichen Verhaltens. Ein Individuum richtet sein Handeln im Interaktionszusammenhang an vorfindbaren Rollenvorgaben aus und gestaltet diese entsprechend den spezifischen Anforderungen der Situation aus.
Zielrealisierung: Mit der Interaktion wird versucht, eine bestimmte Zielsetzung zu erreichen, ein Ziel anzusteuern und mehr oder weniger konsequent zu verfolgen.
Zweckrationalität: Dieser Faktor bezeichnet die Berücksichtigung und Auswahl der Mittel, welche der Zielrealisierung dienlich sind und ist daher eng mit der Zielrealisierung verknüpft. Zu beachten gilt, dass nicht jedes Mittel als zweckmäßig anzusehen oder sozial akzeptiert ist.
Durch diese Festlegung zentraler Charakteristika sollen der Rahmen des Bedeutungsumfangs des Begriffs der sozialen Kompetenz klarer abgesteckt sowie der Bedeutungsgehalt präziser festgelegt werden. Außerdem formulieren Schuler/Barthelme (1995) einige Facetten sozialer Kompetenz als berufliche Anforderung. Sie identifizieren zwei Gruppen bei der Betrachtung der Anforderungen, die an das interpersonale Verhalten von Individuen gestellt werden. Eine Gruppe umfasst diejenigen Facetten, welche einen konkreten Verhaltensbezug aufweisen und aus dem Handeln von Personen direkt zu ersehen sind. Dazu zählen kommunikative Fähigkeiten, Kooperations- und Koordinationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Teamfähigkeit. Die zweite Gruppe beinhaltet Facetten von sozialer Kompetenz, welche eher für das Zustandekommen des Sozialverhaltens verantwortlich sind. Damit kommt dieser Gruppe eine erklärende Rolle zu; die Anforderungen sind nicht direkt beobachtbar, sondern werden aus der Art des Verhaltens zu erschließen versucht. Dazu zählen interpersonale Flexibilität, Rollenflexibilität, Durchsetzungsfähigkeit, Sensibilität und Empathie (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 82ff.).
Kronenberg (1996) bietet folgende Auflistung von Grundvoraussetzungen bzw. Verhaltensweisen, die eine Person mit sozialer Kompetenz zeigt und die aus seiner Sicht für den Praxisalltag von Führungskräften und Mitarbeitern in Unternehmen relevant sind (vgl. Kronenberg 1996, S. 124f.):
Sie kann auf ihre Mitmenschen zugehen, ihnen Vertrauen und nicht an eine Bedingung geknüpfte Wertschätzung entgegenbringen.
Sie kann offen mit Menschen sprechen, konstruktive Kritik üben und ertragen.
Sie ist als Führungskraft bereit und fähig, Konflikte mit Mitarbeitern zu lösen.
Sie lässt Untergebene wissen, was von ihnen erwartet wird, gibt ausführliche Informationen und hört Betroffene an.
Sie sieht sich als Führungskraft als gleichwertiges Mitglied einer Arbeitsgruppe, ohne jedoch die Führung dabei anderen zu überlassen.
Sie ist höflich in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, da das Prinzip der Umkehrbarkeit gilt.
Wertorientierungen, Maßstäbe und Bewertungstendenzen werden nicht als allgemeingültig betrachtet, da jede wahrgenommene Situation eine subjektive Umgestaltung erfährt. Die eigenen Emotionen sind einer sozial kompetenten Person bewusst. Sie weiß, wie sie auf andere wirkt und warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält.
Aus gezeigtem Vertrauen heraus werden Aufgaben delegiert und Machtbefugnisse abgegeben. Außerdem werden Mitarbeiter/innen zu selbständigem Handeln ermuntert.
Anweisungen werden begründet und sachlich formulierter Widerspruch zugelassen.
Die fachliche Fähigkeit und die Selbständigkeit von Mitarbeiter/innen wird gefördert und Rücksichtnahme auf die persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen wird gezeigt.
Da sich soziale Kompetenzen erst durch entsprechendes Verhalten zeigen, wird bei Kanning (2005) explizit zwischen sozialer Kompetenz und sozial kompetentem Verhalten unterschieden. Ersteres wird definiert als „Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens - im Sinne der Definition sozial kompetenten Verhaltens - fördert“; Letzteres als „Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird“ (Kanning 2005, S. 4). Die sozialen Kompetenzen liegen also als ein Potenzial im Verborgenen und wirken auf das sozial kompetente Verhalten, welches immer in konkreten Situationen stattfindet,z. B. bei Kundengesprächen, bei einer Auseinandersetzung mit Kolleg/innen oder bei der Präsentation einer Projektarbeit vor Vorstandsmitgliedern. Das Verhalten gilt dann als sozial kompetent, wenn die betreffende Person einerseits eigene Ziele verwirklichen kann (z. B. dem/der Kund/in ein bestimmtes Produkt verkaufen) und dabei andererseits das Verhalten im sozialen Kontext akzeptabel ist (z. B. wäre lügen im Gegensatz zum Austausch von Argumenten nicht akzeptabel). Daraus leitet Kanning (2005) drei Prinzipien der Definition sozial kompetenten Verhaltens ab (vgl. Kanning 2005, S. 4f.):
Sozialer Bezugspunkt: In Abhängigkeit vom gewählten Bezugspunkt kann das gleiche Verhalten als kompetent oder als inkompetent gelten. Das Belügen eines/einer Kunden/Kundin wird bspw. in einem zwielichtigen Unternehmen akzeptiert werden, aus Kundensicht wird dieses Verhalten jedoch als inakzeptabel und damit als inkompetent gelten.
Evaluativer Bezugspunkt: Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Wertesysteme kann ein und dasselbe Verhalten als mehr oder weniger sozial kompetent bewertet werden. So bedient sich z. B. das zwielichtige Unternehmen offensichtlich eines anderen Wertesystems als der/die Kunde/Kundin, wobei die Wahl des Wertesystems nicht an einen bestimmten sozialen Bezugspunkt gebunden ist. Der/die Kunde/Kundin könnte ja auch das unehrliche Verhalten akzeptieren, wenn er/sie Verkaufsgespräche bspw. als sportlichen Wettstreit betrachtet, bei dem die Person mit der geschicktesten Taktik zu Recht gewinnt.
Temporaler Bezugspunkt: Die Definition sozial kompetenten Verhaltens nimmt immer auf einen bestimmten Zeitabschnitt Bezug. Führt z. B. das unehrlich geführte Verkaufsgespräch zum Verkauf eines Produkts, so wird das Verhalten des/der Mitarbeiters/in als sozial kompetent angesehen. Wird jedoch langfristig das Image des Unternehmens beschädigt, so wird dieses
Verhalten in der langfristigen Perspektive als inkompetent bewertet werden. Demnach gibt es nicht das sozial kompetente Verhalten, und jedes Unternehmen, das zum Zweck der Personalauswahl oder -entwicklung mit dem Konzept der sozialen Kompetenz arbeitet, muss für sich selbst entsprechende Bezugspunkte, in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz bzw. der beruflichen Aufgabe, definieren (vgl. Kanning 2005, S. 5).
Die soziale Kompetenz liefert die Basis für sozial kompetentes Verhalten und wird situationsübergreifend definiert. Sie umfasst Bestandteile des Wissens sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person. Sozial relevantes Wissen bezieht sich nicht nur auf eine einzelne Situation, sondern ist viel weitreichender (z. B. weiß ein/e Personalberater/in, dass es angemessen wäre, den/die Personalchef/in bei dem erstmaligen Besuch in einem Unternehmen auf die Schulter zu klopfen). Fähigkeiten sind abstrakte Verhaltenspotenziale eines Menschen, welche situationsübergreifend bestehen und diesen in die Lage versetzen, unterschiedlichste Aufgaben zu bewältigen (z. B. rhetorische Fähigkeiten oder grundsätzliche Teamorientierung). Fertigkeiten sind hingegen weniger Abstrakte, erlernte Verhaltenspotenziale (z. B. Begrüßungs- oder Höflichkeitsrituale). Sie beziehen sich ebenfalls nicht nur auf eine nicht wiederkehrende Situation, sondern zumindest auf eine Klasse von Situationen wie z. B. für viele Begrüßungsrituale an verschiedenen Orten mit immer wieder anderen Menschen (vgl. Kanning 2005,S. 6f.).
Da die soziale Kompetenz ein multidimensionales Konzept ist, fasst Kanning (2005) häufig zitierte Kompetenzkataloge zu 15 Kompetenzen zusammen. Da es sich dabei um sehr abstrakte Konzepte ohne direkten Bezug zu einer beruflichen Tätigkeit handelt, bezeichnet er sie in Anlehnung an Reschke als „allgemeine soziale Kompetenzen“ (vgl. Abbildung 5). Für die Praxis des Personalmanagements sind sie daher auch eher von untergeordneter Bedeutung, da hier in der Regel mit Kompetenzen gearbeitet werden wird, welche sich vor dem Hintergrund von Anforderungs- oder Bedarfsanalysen für den konkreten Anwendungsfall als bedeutsam erwiesen haben. Von den allgemeinen Kompetenzen können daher bereichsspezifische soziale Kompetenzen abgegrenzt werden, die für ein ganz konkretes (berufliches) Setting von Bedeutung sind. Sie werden durch praktische Tätigkeit oder durch Berufsausbildung erworben und stellen spezifische Ausformungen allgemeiner Kompetenzen dar. Ein Beispiel hierfür wäre der Vergleich eines/einer Managers/Managerin mit einem/einer Kindergärtner/in. Beide Personen benötigen für die Ausübung ihres Berufs ein gewisses Maß an Durchsetzungsfähigkeit, die berufsspezifische Ausformung dieser allgemeinen Kompetenz ist jedoch sehr unterschiedlich. Ein Austausch wäre daher auch bei gleicher Fachkompetenz nicht ohne weiteres möglich (vgl. Kanning 2005, S. 7ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Allgemeine soziale Kompetenzen (Quelle: Kanning 2005, S. 9)
2.2. Ausgewählte Kategorien sozialer Kompetenz
Die vorangegangen Ausführungen machen deutlich, dass in der Literatur eine Vielzahl von Eigenschaften genannt werden, die sich auf soziale Kompetenz beziehen. Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben, wird von Kanning (2007) zwischen Kompetenzen und kompetentem Verhalten unterschieden. Kompetenzen helfen einem Menschen, eine bestimmte Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Die Aufgabe wird aber erst dann gelöst, wenn diese Fähigkeiten in Verhalten umgesetzt werden. Kompetenzen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für kompetentes Verhalten, sie bieten aber keine Gewähr dafür. Die Grundlage für sozial kompetentes Verhalten bildet aber auf jeden Fall die soziale Kompetenz (vgl. Kanning, 2007, S. 14f.). Soziale Kompetenz kann aber prinzipiell nicht auf eine Fähigkeit alleine reduziert werden (vgl. Faix/Laier 1991, S. 62). Sie ist kein Begriff mit einem klar definierten Inhalt, sondern besteht aus vielen verschiedenen Bausteinen (vgl. Langmaack 2004, S. 16). Die Bandbreite dieser sozialen Fähigkeiten reicht zum Beispiel, nur um einige zu nennen, von Empathie, sozialer Sensibilität, Rollendistanz über die Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, Vertrauen und viele andere (vgl. Jetter/Skrotzki 2005, S. 51). Edinsel (1998) beschreibt die Darstellung sozialer Kompetenzen als einen offenen Katalog, der jederzeit diskutiert und ergänzt werden kann (vgl. Edinsel 1998, S. 123). Die Frage um welche Kompetenzen es sich im speziellen handelt, ist schwer zu beantworten, da dieses Thema bislang nicht ausreichend erforscht und daher nicht vollständig wissenschaftlich belegbar ist (vgl. Kanning 2005, S. 7). Schuler/Barthelme (2005) beschreiben die Problematik in diesem Zusammenhang so, dass der überwiegenden Zahl der aufgestellten Anforderungen an soziale Kompetenz der Bezug zu theoretisch und empirisch fundierten Konzepten und Ansätzen fehlt (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 79). Auch Langmaarck (2004) beschreibt soziale Kompetenz als „theoretisch wie empirisch eher wenig fundiert, vor allem aber als nur unscharf definiertes Konstrukt“ (Langmaarck 2004, S. 21). Euler (2007) beschreibt Sozialkompetenzen gar als „Wieselwörter“, die häufig zitiert, aber nur selten präzisiert werden (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 215).
Nichtsdestotrotz steht neben der Fach- und der Methodenkompetenz die Vermittlung sozialer Qualifikationen im Vordergrund vieler Trainingsveranstaltungen (vgl. Lenzen 1998, S. 47). Denn ungeachtet der beschriebenen Problematik wird unter Sozialkompetenz erfolgreiches Verhalten in sozialen Situationen verstanden. Dabei können verschiedene Verhaltensweisen in den einzelnen Situationen erfolgreich sein (vgl. Wellhöfer 2004, S. 4). Da soziale Kompetenz aus sehr vielen Facetten von Verhaltensweisen besteht, werden dementsprechend viele Seminare dafür angeboten (vgl. Crisand 2002, S. 88).
Auch ein Ziel der Wirtschaftsuniversität Wien ist es, neben Fach- und Methodenkompetenz, den Studierenden Sozialkompetenz zu vermitteln. Dabei werden vor allem Kompetenzen im behavioralen Bereich gefördert. Die Fähigkeiten der Studierenden werden zum Beispiel in den Bereichen der Kommunikation, Präsentation oder Konfliktlösung geschult. Auf der Grundlage dieses Lehrveranstaltungsangebotes wurden die sozialen Qualifikationen ausgewählt, die nun näher beschrieben werden. Die Auswahl der sozialen Kompetenzen beziehungsweise Qualifikationen entspricht außerdem den überwiegend gewünschten Erfordernissen des Beschäftigungssystems (vgl. Seyfried 1995, S. 8). Dazu gehören ungeachtet der unterschiedlichen Wesensmerkmale der verschiedenen Auflistungen von sozialen Fähigkeiten, die regelmäßig als Bestandteile der Sozialkompetenz genannte Kommunikations- und die Kooperationsfähigkeit (vgl. Lenzen 1998, S. 47) sowie die fünf Dimensionen des etablierten BIP. Ergänzt werden die Erläuterungen um die Beschreibung der Konfliktfähigkeit sowie der Verhandlungsführung. Auf diese neun Teilfertigkeiten wird daher im Folgenden näher eingegangen.
2.2.1. Kommunikationsfähigkeit
Versucht man sozial kompetentes Verhalten zu bestimmen, ist ein wesentliches Merkmal dafür die Interaktion mit anderen Menschen (vgl. Karkoschka 1998,S. 23). Information und Kommunikation sind für den Menschen lebensnotwendig, da ein Mensch ohne Kommunikation nicht leben kann (vgl. Donnert, 2003, S. 59). Alle zwischenmenschlichen Interaktionen laufen im beruflichen Alltag oder der Ausbildung im Wesentlichen über Kommunikation ab (vgl. Lenzen 1998, S. 54). Um in sozialen Situationen erfolgreich handeln zu können, müssen soziale Interaktionsprozesse analysiert und überlegt werden (vgl. Wellhöfer 2004, S. 116). Daraus lässt sich schließen, dass der Kommunikation im Zusammenhang mit sozialer Kompetenz eine große Bedeutung zukommt. Walzik (2004) bezeichnet Kommunikation in einem Beitrag als „Kernelement sozialer Kompetenz“ (vgl. Walzik 2004, S. 221). Auch Euler/Hahn (2007) sehen als Ausgangsperspektive für das Verständnis von Sozialkompetenzen die soziale Kommunikation. Sie gilt als die Basis und Bezugspunkt für die Anwendung von Sozialkompetenzen (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 262). Sie beschreiben dies folgendermaßen (Euler/Hahn 2007, S. 218):
„Die soziale Kommunikation vollzieht sich in unterschiedlichen Situationskontexten (zum Beispiel Konflikt, Teamarbeit, Verhandlung, Moderation), deren Ausprägung die Anforderungen an die Kommunizierenden konkretisiert. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die Präzisierung von Sozialkompetenzen auf einem bestimmten Verständnis von sozialer Kommunikation aufbaut.“
Soziale Kompetenz hat folglich immer etwas mit Kommunikation zu tun (vgl. Kanning 2005, S. 68). Kommunikationsfähigkeit erscheint dabei als zentraler Bestandteil der sozial-kommunikativen Kompetenz (vgl. Heyse/Erpenbeck 2004,S. 289). Kommunikationsfähigkeit wird im Allgemeinen als die Fähigkeit verstanden, Informationen auszutauschen sowie sich verbal und nichtverbal zu verständigen. Dabei ist jeder Mensch Sender und Empfänger (vgl. Lang 2000,S. 407). Mit anderen zu kommunizieren ist ein komplexes Geschehen der menschlichen Sinne. Kommunikation kann nicht nur auf das gesprochene oder geschriebene Wort beschränkt werden, da sie in ihren Erscheinungsformen sehr vielschichtig ist. (vgl. Lenzen 1998, S. 50). Um die Hintergründe von Kommunikationsprozessen zu verstehen, muss im ersten Schritt immer eine Auseinandersetzung mit den grundlegenden Erkenntnissen der Kommunikationspsychologie erfolgen (vgl. Mangels, 1995, S. 54).
Kronenberg (1996) beschreibt den Vorgang der Kommunikation als System, das im Wesentlichen aus Sender und Empfänger besteht. Dabei wird vom Sender die Botschaft kodiert und mit Hilfe von Symbolen dem Empfänger zugeleitet. Der Austausch von Informationen erfolgt dann über die Dekodierung durch den Empfänger (vgl. Kronenberg 1996, S. 128).
Lenzen (1998) beschreibt Kommunikationsfähigkeit als „das Beherrschen der Praxis und Theorie sprachlicher und symbolischer Kommunikationsprozesse“ (Lenzen 1998, S. 50). Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Kommunikationsvorgang eine sachliche, inhaltliche und eine persönliche, emotionale Ebene hat. Bei diesem Zwei-Ebenen-Modell der Kommunikation entspricht die Botschaft auf der Inhaltsebene der sachlichen Mitteilung, die verbal gesendet wird. Auf der Beziehungsebene werden die Botschaften sprachfrei gesendet. Für erfolgreiche Kommunikation muss die Nachricht unverfälscht beim Empfänger ankommen. Es sollten dabei keine Informationsverluste auftreten, und das Gesagte sollte mit dem nonverbalen Verhalten übereinstimmen (vgl. Lenzen 1998, S. 49ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Zwei-Ebenen-Modell der Kommunikation (Quelle: Lenzen 1998, S. 51)
Schulz von Thun (1994) erstellte ein Kommunikationsmodell, das auf der Annahme basiert, dass jede Nachricht ein Paket vieler Botschaften ist. Eine Nachricht kann gleichzeitig vier Botschaften enthalten: den Sachaspekt, den Selbstoffenbarungsaspekt, den Beziehungsaspekt und den Appellaspekt. Die vier Seiten einer Nachricht werden als Quadrat dargestellt (vgl. Abbildung 7). Der Sender sendet immer gleichzeitig auf allen vier Seiten. Eine Nachricht enthält zunächst eine Sachinformation. Damit wird vermittelt, worüber man in der Nachricht informiert. Bei der Selbstoffenbarung werden Informationen über die Person des Senders weitergegeben. Außerdem geht aus einer Nachricht hervor, wie der Sender zum Empfänger steht oder was er von ihm hält. Der Empfänger hat dafür in der Regel ein besonders empfindliches Ohr. Diese Seite der Nachricht wird als Beziehungsaspekt bezeichnet und kann Auslöser für Probleme in der zwischenmenschlichen Kommunikation sein. Der Grund liegt darin, dass nicht nur „Ich-Botschaften“ gesendet werden, sondern andererseits auch „Wir-Botschaften“. Der Empfänger kann sich in bestimmter Weise be- oder misshandelt fühlen. Fast alle Nachrichten haben neben diesen Informationen die Funktion, auf den Empfänger Einfluss zu nehmen, das heißt, sie haben eine Appellwirkung. Damit wird der Empfänger veranlasst, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. Der Appell kann offen oder versteckt gesendet werden. Bei einem versteckten Appell spricht man von Manipulation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: 4 Seiten der Kommunikation - ein Modellstück der zwischenmenschlichen Kommunikation
(Quelle: Schulz von Thun 1994, S. 14)
Dieses Quadrat kann auch aus der Sicht des Empfängers betrachtet werden. Genau diese Tatsache kann Kommunikation sehr kompliziert machen, denn der Empfänger hat die freie Auswahl, auf welche Seite der Nachricht er reagiert. Schulz von Thun (1994) weist aber darauf hin, dass der Vorteil dieses Modells darin liegt, dass es hilft, die Vielfalt möglicher Kommunikationsstörungen besser einzuordnen und so den Blick öffnet für Trainingsziele zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit (Schulz v. Thun 1994, S. 25ff.).
Lang (2000) beschreibt Kommunikationsfähigkeit als Verständigung, bei der möglichst keine Fehler oder Missverständnisse entstehen. Man hält sich an vereinbarte Regeln, weiß dass es verschiedene Kommunikationsebenen gibt und achtet darauf, dass sich die nicht-verbale Kommunikation auf der subjektiven Ebene auswirkt. Außerdem versucht man seinen Gesprächspartner zu verstehen und zu akzeptieren, hört aufmerksam zu und kann durch Argumente überzeugen. Man ist im Gespräch offen und drückt sich knapp und verständlich aus (vgl. Lang 2000, S. 412f.). Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine Bewusstmachung der Prozesse auf der Beziehungsebene erfolgen. Um die Problematik von Kommunikationsprozessen zu erkennen und zu beheben, muss das eigene Handeln reflektierter und effektiver gestaltet werden. Der Kommunikationsprozess muss mit geschultem Auge wahrgenommen werden, um Störungen bemerken und beheben zu können (vgl. Lenzen 1998, S. 54).
Die Fähigkeit erfolgreich zu kommunizieren ist in ihrer Bedeutung sehr hoch anzusiedeln (vgl. Mangels, 1995, S. 54). Kommunikationsfähigkeit bildet zum Beispiel die Grundlage für erfolgreiches Präsentieren oder Moderieren. Bei der Beschreibung der zentralen Aufgaben eines Moderators wird darauf hingewiesen, dass dieser die Regeln der Kommunikation vorstellen und überwachen sollte (vgl. Wellhöfer 2004, S. 206). Auch als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Präsentieren ist es von zentraler Bedeutung zu wissen, was der Zuhörer erwartet und welche Ziele er hat (vgl. Wellhöfer 2004, S. 215). Kommunikationsfähigkeit bildet daneben ebenso die Grundlage um kooperativ und teamorientiert zusammenzuarbeiten, da alle Vermittlungsprozesse über das Element Kommunikation erfolgen. Sie kann daher als Basis für alle weiteren beschriebenen sozialen Kompetenzen betrachtet werden (vgl. Lenzen 1998, S. 48).
Exkurs: Transaktionsanalyse
In Seminaren wird im Zusammenhang mit Kommunikationsinhalten häufig das Modell der Transaktionsanalyse vorgestellt (vgl. Faix/Laier 1991, S. 133). Dabei handelt es sich um eine einfache Methode der bildhaften Darstellung von Kommunikationsprozessen (Crisand 2002, S. 92). Sie geht zurück auf die amerikanischen Psychiater Eric Berne und Thomas A. Harris. Man geht davon aus, dass jeder Mensch drei Persönlichkeitsinstanzen besitzt: das Eltern-Ich, das Kindheits-Ich und das Erwachsenen-Ich. Das Eltern-Ich speichert alles ab, was die Eltern oder andere Autoritäten (etwa Lehrkräfte) dem Kind während seiner Kindheit vermitteln, z. B. Regeln oder Ermahnungen. Das Kindheits-Ich speichert alle Gefühle und Reaktionen aus der Kindheit. Das Erwachsenen-Ich kann verglichen werden mit einem Computer. Es wertet die Tatsachen der Realität aus und überprüft die Impulse aus dem Eltern- und Kindheits-Ich auf Angemessenheit (vgl. Schulz von Thun 1994, S. 169ff.). Dieses Modell macht deutlich, dass unsere Persönlichkeit keine integrierte Einheit ist, sondern aus einem dynamischen Motivgefüge besteht (vgl. Wellhöfer 2004, S. 152). Diese drei Zustände sind voneinander abgegrenzt und widersprechen sich zum Teil sogar. Bei Kommunikationsprozessen wird eine dieser Instanzen zum Ausdruck gebracht. Die Transaktionsanalyse kann helfen, den Kommunikationspartnern bewusst zu machen, auf welchem Ich-Niveau sie sich befinden. Für eine gute Beziehung bzw. Verständigung ist es wichtig, das Niveau des Gegenübers zu erkennen und dieses einzuhalten oder zu akzeptieren (vgl. Faix/Laier 1991, S. 134f.).
2.2.2. Kooperationsfähigkeit
Sehr eng verbunden mit kommunikativen Fähigkeiten ist die Kooperationsfähigkeit. Kooperation kann definiert werden als „Tätigkeit von zwei oder mehr Individuen, die bewusst und planvoll aufeinander abgestimmt ist und die Zeilerreichung eines jeden beteiligten Individuums in gleichem Maße gewährleistet“ (Piepenburg, U.: Rechnergestütztes kooperatives Arbeiten (Mitteilung Nr. 197). Hamburg: Universität, Fachbereich Informatik. 1991; zitiert nach Schuler/Barthelme 1995, S. 83). Bei der Kooperation werden Handlungsabläufe von Kooperanden koordiniert, und es sollte eine Einigung zustande kommen, wann und wie die Beteiligten aufeinander abgestimmt eingreifen (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 83). Wichtig für die Fähigkeit zu kooperieren ist die Bereitschaft dafür (vgl. Mangels 1995, S. 58). Neben der Bereitschaft ist Vertrauen eine wichtige Grundvoraussetzung, um sich kooperativ zu verhalten (vgl. Lenzen 1998, S. 55).
Faix/Laier (1991) zählen zur Kooperationsfähigkeit unter anderem die Fähigkeit, zu anderen Menschen befriedigende Beziehungen aufzubauen, die eine Zusammenarbeit erleichtern bzw. ermöglichen. Diese Fähigkeit kann dabei weit über rhetorische Bemühungen hinausgehen. Kooperationsfähigkeit beinhaltet nicht nur den Aufbau von Beziehungen, sondern auch die Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen und Kontakte herzustellen (vgl. Faix/Laier 1991, S. 45f.).
Niermeyer (2008) beschreibt kooperationsfähige Menschen als Personen, die zum Beispiel in Diskussionen verschiedene Lösungswege finden und gemeinsam mit der Gruppe eine Lösung finden wollen. Sie sind kompromissfähig und legen Wert darauf, alle beteiligten Personen in die Lösungsfindung miteinzubeziehen. Kooperationsfähige Menschen haben die Begabung, die Fähigkeiten anderer für die Lösungsfindung einzusetzen (vgl. Niermeyer, 2008, S. 24). Oft wird Kooperationsfähigkeit im Zusammenhang mit Teamfähigkeit genannt. Zweifellos ist es für funktionierende Teamarbeit wichtig, dass die Gruppenmitglieder kooperationsfähig sind (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 83f.). Wenn allerdings z. B. eine Kompromisslösung über eine qualitativ gute Lösung gestellt wird, kann sich eine übertriebene Kooperationsbereitschaft negativ auf die Lösungsfindung auswirken. Es gilt also auch für diese soziale Kompetenz, das richtige Maß zu finden (vgl. Niermeyer, 2008, S. 24).
In der heutigen Gesellschaft erscheinen Eigenschaften wie Rücksichtslosigkeit oder Egoismus oft als erstrebenswerte Tugenden, allerdings bedeutet Kooperation mit anderen letztendlich immer, der Konkurrenz überlegen zu sein und sollte somit angestrebt werden (vgl. Lenzen 1998, S. 54). Die Zusammenarbeit mit anderen Personen ist unverzichtbar, wenn es z. B. um komplizierte Entscheidungen geht. Kooperation mit anderen kann zur Arbeitserleichterung sowie zu einer individuellen Entlastung führen. Außerdem kann die Produktivität aufgrund der Leistung mehrerer gesteigert werden (vgl. Heyse/Erpenbeck 2004, S. 297).
2.2.3. Konfliktfähigkeit
Wenn Menschen über längere Zeit zusammenarbeiten oder miteinander zu tun haben, kann es zu Konflikten kommen (vgl. Niermeyer 2008, S. 26). Konflikte entstehen grundsätzlich dann, „wenn gleichzeitig zwei oder mehrere Ziele, die nicht miteinander vereinbar sind, angestrebt werden“ (Wellhöfer 2004, S. 190). Durch Spannungen in und zwischen Personen und Gruppen werden Betroffene eventuell verunsichert oder belastet und viel Energie wird verbraucht. Sie gelten außerdem als unangenehm, haben aber trotzdem nicht nur Nachteile (vgl. Lang 2000, S. 442ff.). Die Frage, warum sie entstehen, ist schwer zu beantworten. Man sollte sich daher eher fragen, welchen Sinn ein Konflikt haben kann (vgl. Schwarz 2005, S. 16).
Wellh ö fer (2004) bietet folgende Auflistung von Punkten, wie Konflikte produktiv nutzbar sind (vgl. Wellhöfer 2004, S. 190):
Konflikte können zum Reflektieren der Situation anregen und zu neuen Ideen führen.
Probleme, die schon länger bestehen, können durch Konflikte entdeckt werden.
Konfliktsituationen können verschiedene Partner ins Gespräch bringen und dies kann dazu führen, sich besser zu verstehen.
Eigene Interessen können klarer gemacht oder in Frage gestellt werden.
Konflikte können dazu führen, eigene und organisatorische Entwicklungen anzustoßen.
Sie sollten als Herausforderung gesehen werden (vgl. Wellhöfer 2004, S. 190), aus denen, wenn sie konstruktiv gelöst werden, Chancen erwachsen können (vgl. Lang 2000, S. 442).
Schwarz (2005) führt außerdem an, dass der Sinn von Konflikten darin besteht, vorhandene Unterschiede und die Vielfalt und Verschiedenheit von Ansichten und Sachverhalten zu verdeutlichen und fruchtbar zu machen. Sie können die Einheitlichkeit einer Gruppe herstellen und Einigkeit bewirken. Konflikte können außerdem Gemeinsamkeit und Veränderung bzw. Weiterentwicklung garantieren (vgl. Schwarz 2005, S. 16ff.).
Die Fähigkeit sich Konflikten zu stellen bzw. nicht zu verschließen, sondern sie zu akzeptieren, kann als Konfliktfähigkeit bezeichnet werden. Man versucht den Konflikt aktiv zu bearbeiten und konstruktiv zu einer Lösung zu gelangen (vgl. Mangels 1995, S. 60). Konflikte, die zum Beispiel durch langes Zögern oder Unentschlossenheit entstehen, könnten dadurch vermieden werden (vgl. Niermeyer 2008, S. 26). Konfliktfähigkeit bedeutet auch, dass man Konflikte bereits im Vorfeld vermeiden kann und imstande ist, bereits aufgetretene Konflikte zu lösen. (vgl. Crisand 2002, S. 71).
Von der Linde/von der Heyde (2007) beschreiben die Merkmale einer konfliktfähigen Person folgendermaßen (vgl. von der Linde/von der Heyde, 2007,S. 16):
Sie geht Konflikten nicht aus dem Weg.
Sie erkennt, dass die eigene Meinung bzw. „Auffassung“ nicht automatisch der Richtigkeit oder Wahrheit entspricht.
Die Lösung von Konflikten und die Vermittlung zwischen den Konfliktpartnern sind wichtiger als die Analyse des Konflikts und Schuldzuweisungen.
Sie spricht negative Punkte offen an und kann als Führungskraft Konflikte zielorientiert ansprechen.
Sie bleibt bei Konflikten ruhig und sachlich und stellt ihre Position sicher und umfassend dar.
Bei Konflikten wirkt sie nicht rechthaberisch, aggressiv oder schwer einschätzbar, ist kritikfähig und lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen.
Sie geht bei Konflikten stets ziel- und lösungsorientiert vor.
Für die Bewältigung von Konflikten ist es wichtig, die Folgen für alle Parteien zu bedenken. Es sollte stets angestrebt werden, den Konflikt gemeinsam kooperativ zu bewältigen (vgl. Thomas 1976, S. 892).
2.2.4. Verhandlungsführung
Die Fähigkeit zum Verhandeln/Aushandeln kann der Lösung von Konflikten dienen und ist damit eng an die Konfliktfähigkeit geknüpft (Schuler/Barthelme 1995, S. 84). Wie auch die Kommunikation ist „Verhandeln Bestandteil unseres Lebens“ (Fisher/Ury/Patton 2004, S. 19). Verhandeln kann beschrieben werden als soziale Interaktion, „in deren Verlauf die Parteien Forderungen und Angebote solange austauschen, bis eine Vereinbarung erzielt wird“ (Schuler/Barthelme 1995, S. 84). Das heißt, zwei oder mehrere Verhandlungspartner mit unterschiedlichen Interessen versuchen ein gemeinsames Ziel zu finden und einen gemeinsamen Nutzen zu erreichen. Der Verlauf einer Handlung kann dabei sehr stark von der Beziehung der Verhandlungspartner abhängen (vgl. Niermeyer 2006, S. 80).
Verhandlungen können sowohl Konflikte als auch Kooperation beinhalten. Sie sind ein Kommunikationsprozess, bei dem versucht wird, durch eine sprachliche Auseinandersetzung die jeweiligen Interessen durchzusetzen (vgl. Erbacher 2005,S. 21ff.).
Eine Methode für das erfolgreiche Führen von Verhandlungen ist das HarvardKonzept, das Wege beschreibt um erfolgreich verhandeln zu lernen. Beim „Harvard Negotiation Project“ handelt es sich um ein Forschungsprojekt der Harvard Universität, das sich mit Fragen der Verhandlungsführung beschäftigt (vgl. Fisher/Shapiro 2007, S. 293). Im Folgenden wird das Harvard-Konzept kurz erklärt und die wichtigsten Prinzipien werden hervorgehoben. Als Grundprinzipien für diese Methode werden von den Autoren Fisher/Ury/Patton (2004) folgende Punkte angegeben (vgl. Fisher/Ury/Patton 2004, S. 43 bis 139):
Menschen und Probleme sollten getrennt voneinander behandelt werden: Man sollte sich stets vor Augen führen, dass die Gegenseite auch ein Mensch ist. Außerdem ist es wichtig, die persönliche Beziehung von der Sachfrage zu trennen. Hier gilt es zu beachten, dass jeder Verhandlungspartner zwei Grundinteressen hat: den Verhandlungsgegenstand und die persönliche Beziehung. Eine wichtige Fertigkeit in diesem Zusammenhang ist das Versetzen in die Lage der anderen. Emotionen sollten in Verhandlungsgesprächen erkannt und verstanden werden. Bei der Kommunikation während der Verhandlung ist es wichtig, dass man versuchen sollte aufmerksam zuzuhören, deutlich und über sich selbst mit einer bestimmten Absicht zu sprechen.
Man soll sich auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen: Bei diesem Prinzip geht es darum, die Interessen der Verhandlungspartner in Einklang zu bringen und nicht die Positionen. Dabei geht es darum, Interessen zu erkennen und darüber zu sprechen.
Man sollte Entscheidungsmöglichkeiten (Optionen) zum beiderseitigen Vorteil entwickeln: Hier kann zum Beispiel ein Brainstorming oder die Erweiterung der Basis der Wahlmöglichkeiten helfen. Es sollte ein Vorteil für beide Seiten gesucht werden.
Man sollte auf die Anwendung neutraler Beurteilungskriterien bestehen: Der erste Schritt könnte hier die Entwicklung objektiver Kriterien sein. Mit diesen Kriterien sollte dann verhandelt werden.
Die Fähigkeit in einer Verhandlung „Verhandlungsgeschick“ zu beweisen, bezeichnet Niermeyer (2006) als „die Fähigkeit unterschiedliche Interessen abzuwägen und einen Interessensausgleich zu schaffen“ (Niermeyer 2006, S. 80). Für den Erfolg bei Verhandlungen ist nicht ein ganz bestimmter Stil wichtig, sondern die Fähigkeit, dass je nach Situation oder Konflikt zwischen Verhandlungsstilen variiert werden kann (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 85, zitiert nach Berkel, K.: a.a.O.).
2.2.5. Sensitivität
Um andere besser verstehen zu können, muss man ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen besitzen (vgl. Mangels 1995, S. 60). Einfühlungsvermögen sollte nicht mit Empfindsamkeit verwechselt werden, denn die Empfindsamkeit bezieht sich auf die eigene Störbarkeit und Labilität, während das Einfühlungsvermögen die Sensibilität der Wahrnehmung meint (vgl. Niermeyer 2008, S. 25).
„Einfühlungsvermögen ist die Fähigkeit einer Person, das Denken, Fühlen und Wollen anderer Menschen nachvollziehen zu können. Jemand der als „einfühlend“ beschrieben wird, zeigt häufig nicht nur die Fähigkeit, sondern auch den Willen, sich in andere einzufühlen (von der Linde/von der Heyde 2007, S. 16). Folgende Kennzeichen von einfühlenden Menschen können genannt werden (von der Linde/von der Heyde 2007, S. 17):
Einfühlende Personen hören in Gesprächen genau zu, beobachten ihren Gesprächspartner und versuchen, Schlüsse zu ziehen.
Sie können sich in ihrer Art zu sprechen, im Vokabular und ganz allgemein im Verhalten auf ihr Gegenüber einstellen.
Sie sind in der Lage, im Gespräch die Sichtweise anderer einzunehmen.
Solche Menschen haken bei möglichen, unausgesprochenen Konfliktquellen und Differenzen nach.
Auch schwache Signale anderer Menschen nehmen sie gut wahr.
Sie sind sich der Wirkung ihrer eigenen expliziten und non-verbalen Signale bewusst.
Sie interessieren sich generell für andere Menschen, deren Sichtweisen und Formen der Argumentation.
Einfühlvermögen meint die Fähigkeit eines Menschen, das Denken, Fühlen und Wollen anderer nachvollziehen zu können (Niermeyer 2008, S. 24). Gutes Einfühlungsvermögen kann folgendermaßen erkannt werden (Niermeyer 2008,S. 25):
In Gesprächen und Diskussionen hören einfühlsame Personen sehr gut und aktiv zu.
Sie beobachten ihre Kommunikationspartner genau und berücksichtigen dabei nicht nur verbale, sondern auch nonverbale Signale. Auch schwache Signale bleiben ihnen nicht verborgen.
Sie versuchen, aus ihren Beobachtungen Schlüsse zu ziehen, bewerten sie aber nicht. Ihnen geht es nicht darum, Urteile zu fällen, sondern die Motive des anderen zu verstehen.
Einfühlsame Menschen sind in der Lage, „über den Tellerrand“ zu blicken und die Sichtweise anderer anzunehmen.
Für das BIP wird Sensitivität mit einem guten Gespür auch für schwache Signale in sozialen Situationen, großem Einfühlungsvermögen und einer sicheren Interpretation und Zuordnung der Verhaltensweisen anderer definiert (vgl. Hossiep/Paschen 1998, S. 18).
2.2.6. Kontaktfähigkeit
Kontakte im Sinne von qualitativ guten Beziehungen sind eine Basis für gute
Zusammenarbeit mit Kund/innen, Kolleg/innen und anderen
Geschäftspartner/innen und somit nicht nur eine Quelle für motiviertes und zufriedenstellendes Arbeiten, sondern auch für beruflichen bzw. wirtschaftlichen Erfolg (vgl. Schaper 2002, S. 7). Neben der Bezogenheit als Fähigkeit, sich mit anderen verbunden zu fühlen, und Empathie nennt Hauser (2002) folgende Eigenschaften, welche eine Person zum erfolgreichen Knüpfen von Beziehungen benötigt (vgl. Hauser 2002, S. 32ff.):Offenheit und Vielseitigkeit: Für Neues offen und den Mitmenschen gegenüber tolerant zu sein gilt als Voraussetzung für ein reicheres Leben. Die Vielseitigkeit einer Person spiegelt sich darin wider, dass sie ein interessanter Gesprächs- und Diskussionspartner ist, die in vielen unterschiedlichen Themenbereichen kompetent mitreden kann.
Freundlichkeit: Dabei geht es zum einen um den freudigen Umgang mit anderen Personen, was z. B. durch Lächeln ausgedrückt werden kann, zum anderen geht es um das Zeigen von Dankbarkeit.
Guter Ruf: Ein schlechter Ruf, der durch Mundpropaganda in der Regel verstärkt wird, kann dem beruflichen Erfolg hinderlich sein. Dies kann vor allem durch Ehrlichkeit vermieden werden.
Neugierde: Auf andere Personen neugierig zu sein ist eine Grundvoraussetzung für das Eingehen neuer Beziehungen und hilft dabei, Menschen mit anderen Berufen, Hobbys oder Lebenserfahrungen kennenzulernen.
Ehrgeiz: Neue Kontakte zu knüpfen erfordert ein gewisses Maß an Motivation, fremde Menschen überhaupt kennen lernen zu wollen.
Bereitschaft, sich aus der Komfortzone herauszubewegen: Die Komfortzone bezeichnet denjenigen Bereich, in dem sich Menschen wohl fühlen. Bei einem ersten Treffen mit anderen Personen gilt es, etwaige Angst oder Nervosität zu überwinden und diese Zone zu verlassen.
Frustrationstoleranz: Dabei soll akzeptiert werden, dass manche Bemühungen um neue Kontakte auf Ablehnung stoßen.
Geduld: Nicht jeder neue Kontakt, in den Zeit, Kreativität oder vielleicht auch finanzielle Mittel investiert wurden, macht sich sofort bezahlt. Geduld und Gelassenheit haben sich dabei als vorteilhaft für das Pflegen von Beziehungen erwiesen.
Bei der Kontaktfähigkeit lassen sich Überschneidungen zum Begriff der Extraversion aus dem F ü nf-Faktoren-Modell feststellen, welches zudem die Faktoren Verträglichkeit, emotionale Stabilität, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrungen beinhaltet. Personen, welche die charakteristischen Verhaltensmerkmale der Extraversion aufweisen, sind gesellig, gesprächig, großzügig, bestimmt, dominant, aktiv und impulsiv, was teilweise für die Aufnahme sozialer Interaktionen eine Erleichterung darstellen kann (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 90).
Für das BIP wird Kontaktfähigkeit als die ausgeprägte Fähigkeit und Präferenz des Zugehens auf bekannte und unbekannte Menschen sowie des Aufbaus und der Pflege von Beziehungen definiert. Berufliche wie private Netzwerke werden dabei aktiv aufgebaut und gepflegt (vgl. Hossiep/Paschen 1998, S. 18).
2.2.7. Soziabilität
Als Soziabilität wird die Fähigkeit zur Aufnahme und zum Erhalt von sozialen Beziehungen bezeichnet. Sie wird durch verschiedene Eigenschaften bestimmt, wie z. B. die Fähigkeiten eines Menschen zur Kommunikation und zur Ko- Orientierung, also zur gedanklichen Koordination des Handelns. Diese hängen wiederum mit intellektuellen Potenzialen einer Person zusammen. Dazu gehören die Fähigkeit zur Erinnerung und damit verbunden der Anreicherung von gemeinsamen Erfahrungen, die dadurch gegebene Möglichkeit des Aufbaus von gemeinsamen Erwartungen und sozial geteiltem Wissen, z. B. über die speziellen Bedingungen bestimmter Verhaltensbereitschaften, Empathie sowie die Fähigkeit zur symbolisch vermittelten Kommunikation über das Medium der Sprache (vgl. Esser 1999, S. 161f.).
Als Empathie wird die Fähigkeit zur reflektierenden Einnahme des Standpunktes anderer bezeichnet (vgl. Esser 1999, S. 162). Dieses Einfühlungsvermögen stellt die Grundlage für das bessere Verständnis anderer dar, weil das am Anfang eines sozialen Kontakts stehende „Abtasten“ einer Person allein nicht genügt, um Voraussetzungen für eine funktionierende Kooperation oder soziale Beziehung zu schaffen. Die Entwicklung von Empathie wird nur über entsprechende Selbsterfahrung und die Sensibilisierung für andere Personen gelingen (vgl. Mangels 1995, S. 56). Die Soziabilität ermöglicht somit auch, dass sich Menschen genau aufeinander einstellen können und prinzipiell in der Lage sind, die jeweils andere Person in ihren Beweggründen zu verstehen und ihr so das Gefühl zu vermitteln, dass sie richtig handelt (vgl. Esser 1999, S. 162).
Soziabilität erlaubt jedoch nicht nur die Aufnahme und den Unterhalt sozialer Beziehungen, sie kann auch deren Ausbeutung und strategische Nutzung gestatten. Empathiefähigkeit etwa kann zur strategisch nutzbaren Vorwegnahme des Handelns einer anderen Person verleiten, und mittels impulsgehemmter Kontrolle von Reaktionen ist es möglich, andere zu täuschen und deren Sozialität auszunutzen. Diese bezeichnet die Angewiesenheit und Abhängigkeit des Menschen von sozialer Unterstützung, Anerkennung, Orientierung und Verhaltensbestätigung. Obwohl aber Soziabilität das Ausnutzen dieser Sozialität ermöglicht, ermöglicht erst sie das Eingehen sozialer Beziehungen sehr individueller Art und damit auch eine Lösung des Problems der Sozialität (vgl. Esser 1999, S. 161ff.).
Für das BIP wird Soziabilität als eine ausgeprägte Präferenz für Sozialverhalten, welches durch Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Großzügigkeit im Bezug auf Schwächen von Interaktionspartnern und dem ausgeprägten Wunsch nach einem harmonischen Miteinander gekennzeichnet ist, definiert (vgl. Hossiep/Paschen 1998, S. 18).
2.2.8. Teamorientierung
Von Teamarbeit kann dann gesprochen werden, wenn die Arbeit in Gruppen erledigt wird, welche sich als Teams mit einem eigenständigen Planungs-, Entscheidungs- und Handlungsspielraum beschreiben lassen. Innerhalb eines Unternehmens haben sie unterschiedliche Aufgabenstellungen und verschiedene funktionale Bedeutung für die jeweiligen Ziele, wie z. B. eine Steigerung der Effizienz oder der Arbeitsproduktivität. Auch sozioemotionale Bedürfnisse können durch die Bildung von Teams befriedigt werden (vgl. Seyfried 1995, S. 16).
Je nach Arbeitsaufgabe, Gruppenart und Dauer einer Gruppenarbeit zeigen sich unterschiedliche Interaktionsformen, welche mit spezifischen Handlungsweisen verbunden sind. Da sich also die Anforderungsmerkmale von Organisation zu Organisation und auch zwischen den einzelnen Berufen unterscheiden, ist eine Festlegung von Standardanforderungsprofilen nicht möglich. Teamfähigkeit kann daher nicht als invariantes Verhaltensmuster definiert und einem „objektiven“ Bewertungsmaßstab unterworfen werden (vgl. Seyfried 1995, S. 16f.).
Die Fähigkeit im Team zu arbeiten, bildet sich aus mehreren sozialen Fähigkeiten (vgl. Crisand 2002, S. 26). Es handelt sich dabei nicht um eine einzelne Fähigkeit, sondern um ein Bündel von Verhaltensweisen. Sie wird erst in sozialen Beziehungen sichtbar und äußert sich je nach Kontext in unterschiedlichen Verhaltensweisen (vgl. Lenzen 1998, S. 56). Da es bei Definitionsversuchen häufig zu Überschneidungen mit Begriffen wie Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Sensibilität oder Durchsetzung kommt, kann Teamfähigkeit auch als eine Zusammenfassung mehrerer Facetten sozialer Kompetenzen für den speziellen Fall der Interaktion innerhalb einer Gruppe aufgefasst werden. Sie ist eine Voraussetzung dafür, Konfliktsituationen erfolgreich zu regeln, beinhaltet Vertrauen und Akzeptanz zwischen den Teammitgliedern und bildet eine Basis für gute Zusammenarbeit (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 83f.).
Die Teamgröße ist die am häufigsten diskutierte Voraussetzung für das Arbeiten in Gruppen. Bei zu kleinen Teams werden Synergien kaum wirksam, bei zu großen kann der Zusammenhalt leiden, Untergruppen können sich bilden oder die Möglichkeiten einer einzelnen Person, aktiv Ideen einzubringen, sind zu sehr verringert. Außerdem besteht bei großen Teams eine erhöhte Gefahr des gruppendynamischen Effekts des „social loafing“. Dabei lässt der Arbeitseinsatz einer Person nach, da ihre Verantwortlichkeit nicht mehr klar hervortritt und die Bedeutung des Einzelbeitrags nicht deutlich messbar und erfahrbar ist. Dadurch kann es zu einer Verringerung der Motivation und der Leistungsbereitschaft kommen (vgl. Kriz/Nöbauer 2002, S. 33f.). Gruppenmitglieder können somit dann als teamorientiert bezeichnet werden, wenn sie ihre Anstrengungen bei der Erfüllung kollektiver Aufgaben im Vergleich zu ihrem Einsatz bei Einzelarbeiten nicht reduzieren (vgl. Jülicher 2000, S. 30). Dies wird vor allem durch den direkten Kontakt und die direkte Kommunikation zwischen den Teammitgliedern unterstützt. Dadurch wird jeder Person die eigene Wichtigkeit und Verantwortung sowie im besten Fall auch die Wertschätzung anderer für die eigene Leistung bewusst. Dies kann dann sogar zu einem motivierenden Aufschaukeln und verstärkten Arbeitseinsatz führen (vgl. Kriz/Nöbauer 2002, S. 34).
Für das BIP wird Teamorientierung als hohe Wertschätzung von Teamarbeit und Kooperation, die Bereitschaft zur aktiven Unterstützung von Teamprozessen sowie die bereitwillige Zurücknahme eigener Profilierungsmöglichkeiten zugunsten der Arbeitsgruppe definiert (vgl. Hossiep/Paschen 1998, S. 18).
2.2.9. Durchsetzungsstärke
Der Begriff Durchsetzungsstärke bzw. -fähigkeit ist auch mit ethischen Komponenten verbunden und kann in seinem Bedeutungsumfang und -inhalt stark variieren. Wenn sich die Durchsetzungsfähigkeit einer Person in einem sozial erwünschten Verhalten niederschlägt, kann sie mit Gratifikationen verbunden sein. Sie kann aber auch nur toleriert werden bzw. Sanktionen hervorrufen, wenn ein solches Verhalten aufgrund des allgemeinen Konsens nicht erwünscht ist (vgl. Schuler/Barthelme 1995, S. 86).
Vor allem von Managern wird verstärkt Durchsetzungsvermögen und Entscheidungsstärke gefordert, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dies wird mit dem Einsatz sogenannter positiver Aggressionen verbunden, womit nicht die Anwendung von Gewalt oder Ähnliches gemeint ist, sondern die Umsetzung aggressiver Energie in wirtschaftliche und kulturelle Leistungen. Das heißt, dass natürliche, moralisch gerechtfertigte Potenzen aktiviert und dadurch proaktive Verhaltensweisen gefördert werden sollen (vgl. Weidner 2001, S. 8). Die positiven Seiten der Aggressivität zeigen sich in mehr Selbstbewusstsein, Zielstrebigkeit und Konsequenz (vgl. Weidner 2001a, S. 134). Werden Aggressionen, welche zu den stärksten Gefühlen eines Menschen zählen, jedoch nicht ausgedrückt, sondern permanent in Schach gehalten, verwandelt sich ursprünglich konstruktive oder zumindest neutrale Energie in destruktive, welche sich gegen die eigene Person oder andere Personen richten kann (vgl. Merz 2001, S. 148).
Nach Reinecke kann Durchsetzungsstärke vor allem auf drei aggressive Erfolgsfaktoren zurückgeführt werden (vgl. Wiedner 2001, S. 18):
Schnell sein, um wirkliche Gegner ins Leere laufen zu lassen. Geduldig sein und Unauflösliches aussitzen können.
Schieflagen ohne Rücksicht auf falsch verstandene Harmonie beim Namen nennen können.
In Aggressionstrainings kann gelernt werden sich besser durchzusetzen, sich gegen Arbeitgeber/innen oder Kolleg/innen zur Wehr zu setzen, sich nicht übervorteilen zu lassen, den eigenen Standpunkt besser einbringen zu können oder unkontrollierte Aggressionsäußerungen besser in den Griff zu bekommen. Im Sinne einer Strebensethik geht es dabei also um Hilfestellungen zu der Befähigung, das eigene Leben so zu gestalten, wie eine Person es „eigentlich“ will. So kann z. B. geraten werden, in einer zwischenmenschlichen Situation keine einseitigen Leistungen auf Dauer zu erbringen, Nein sagen zu können, sich nicht durch Schmeicheleien oder Lob erpressen zu lassen oder eine Beziehung nötigenfalls abzubrechen (vgl. Roos 2001, S. 98).
Für das BIP wird Durchsetzungsstärke mit der Tendenz zur Dominanz in sozialen Situationen, dem Bestreben zur nachhaltigen Verfolgung der eigenen Ziele auch gegen Widerstände sowie hoher Konfliktbereitschaft definiert (vgl. Hossiep/Paschen 1998, S. 18).
Exkurs: Soziale Kompetenz bei Führungskräften
Der Begriff „Soziale Kompetenz“ wird in der Literatur oft im Zusammenhang mit Fähigkeiten von erfolgreichen Führungskräften erwähnt. Zahlreiche Bücher, die sich mit sozialen Kompetenzen beschäftigen, werden als Handbücher oder Ratgeber für erfolgreiche Führungskräfte bezeichnet. Zweifellos ist Führung ein sehr komplexer Interaktionsprozess (vgl. Kronenberg 1996, S. 118). Soziale Kompetenz im Zusammenhang mit Führung bedeutet für den Vorgesetzten mit seinen Mitarbeiter in Kontakt-, Kommunikations-, Kooperations- und
Konfliktsituationen kompetent umzugehen (vgl. Crisand 2002, S. 17).
Führungskräfte müssen Mitarbeiter motivieren, beurteilen, Konflikte klären, informieren, präsentieren und moderieren (vgl. Wellhöfer 2004, S. 168). Die Fähigkeit, andere Menschen bzw. Mitarbeiter zu führen, gilt nicht als klassische Dimension der sozialen Kompetenz. Einer Führungskraft werden aber im Allgemeinen soziale Kompetenzen zugesprochen. „Führungskräfte benötigen verstärkt Sozialkompetenzen, um die Kreativität und aktive Mitarbeiter ihrer Mitarbeiter zu fördern und auf eine kooperativ entwickelte Unternehmenskultur auszurichten“ (Jetter/Skrotzki 2005, S.51).
2.3. Entwicklung sozialer Kompetenz
Unser Verhalten wird geprägt durch familiäre Variablen, den persönlichen sozio-ökonomischen Status, gesellschaftlich-kulturelle Faktoren und gesamtwirtschaftliche Faktoren (vgl. Faix/Laier 1991, S. 65). Die Familie und die Schule sind die ersten Sozialisationsinstanzen, in denen man sich bestimmte Fähigkeiten aneignet und Werte geprägt werden. Familiäre und schulische Sozialisation sind lebensbiographisch der beruflichen Sozialisation vorgelagert (vgl. Edinsel 1998, S. 25). Obwohl diese genannten Instanzen unser Verhalten beeinflussen und prägen, ist es trotzdem möglich, soziale Kompetenzen zu
erwerben und zu fördern (vgl. Faix/Laier 1991, S. 9). Es wird auch immer
deutlicher, dass durch veränderte Bedingungen in der Familie und der
Gesellschaft die Entwicklung der sozialen Kompetenz den Bildungsinstitutionen
als neue Aufgabe übertragen wird (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 215). Wie bereits in
Kapitel 2.1.3 über die Dimensionen sozialer Kompetenz beschrieben,
unterscheidet Kanning (2005) allgemeine soziale Kompetenzen von
bereichsspezifischen. Diese allgemeinen sozialen Kompetenzen stellt er als Fähigkeiten dar, die jeder Mensch in unterschiedlicher Ausprägung ausbilden kann (vgl. Kanning 2005 S. 8). Das heißt, allgemeine soziale Fähigkeiten sind nach dieser Definition erlernbar und trainierbar. Dabei geht man davon aus, dass Sozialkompetenzen auch im Jugend- und Erwachsenenalter noch lern- oder förderbar sind (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 469). Auch Euler/Hahn (2007) stellen sich in einem Kapitel über die Förderbarkeit von Sozialkompetenzen zuerst die Frage, ob soziale Kompetenz überhaupt förderbar sei. Sie führen die entwicklungspsychologische sowie soziologische Perspektive an und kommen auf der Grundlage der Befunde auch zu dem Schluss, dass Sozialkompetenzen lern- und damit förderbar sind (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 447f.). Soziale Kompetenz kann folglich durch systematische Schulungsmaßnahmen trainiert und entwickelt werden. Tatsächlich aber ist es sehr schwierig, soziale Kompetenz in ein Lernschema einzupassen (vgl. Jetter/Skrotzki 2005, S. 55).
Die Literatur unterscheidet zahlreiche verschiedene Ansätze zur Entwicklung sozialer Kompetenz. Im Folgenden werden die Ansätze verschiedener Autoren kurz beleuchtet.
In Kapitel 2.1.1 wurde bereits die Einteilung von Wellh ö fer (2004) für soziale Kompetenz beschrieben. Soziale Kompetenzen sind Fähigkeiten, die nur in einem sozialen Feld, durch erlebnisorientiertes Lernen mit anderen erfahren und weiter entwickelt werden können (vgl. Wellhöfer 2004, S. 16). Um Sozialkompetenz zu verbessern bzw. um in sozialen Situationen erfolgreich zu handeln, müssen soziale Interaktionsprozesse analysiert und optimal gestaltet werden. Dafür ist es notwendig, kommunikative Fähigkeiten zu schulen. Übungen für dieses Ziel konzentrieren sich vor allem auf die Verbesserung von Kommunikationsprozessen (vgl. Wellhöfer 2004, S. 116f.). An der Selbstkompetenz hingegen kann man ausschließlich alleine arbeiten. Dies könnte durch Übungsmaßnahmen im Bereich des Stress-, Zeit- und Selbstmanagements erfolgen (vgl. Wellhöfer 2004, S. 16f.).
Faix/Laier (1991) beschreiben das Erlernen sozialer Kompetenz als vierstufigen Prozess. Für sie ist der Weg zu sozialer Kompetenz mit Persönlichkeitsbildung beschreibbar. Im ersten Schritt muss das Selbstbewusstsein verbessert und trainiert werden, anschließend sollte Verantwortungsbewusstsein entwickelt werden. Danach folgt das Mündigsein, wobei es um die Fähigkeit geht, sich selbst einzubringen. Die letzte Stufe bildet das Selbst-Wirklich-Werden und sozial kompetent handeln. Um sozial kompetente Handlungsfähigkeit zu entwickeln, muss man also selbstbewusst, verantwortungsbewusst sowie mündig sein. Diese Eigenschaften bilden die Grundlage für die Entstehung sozial kompetenter Handlungsfähigkeit. Auch sie verweisen in den einzelnen Prozessen auf die herausragende Bedeutung der Kommunikation (vgl. Faix/Laier 1991, S. 109ff.).
Kanning (2005) beschreibt verschiedene Ansatzpunkte zur Verbesserung sozial kompetenten Verhaltens. Als ersten Ansatzpunkt nennt er die Aneignung von sozial relevantem Wissen. Als sozial relevantes Wissen werden Werte, Rollendefinitionen oder Verhaltensnormen verstanden. Dazu gehören zum Beispiel Werte des Unternehmens oder der Umgang mit schwierigen Kunden/innen. Dieses sozial relevante Wissen kann im Rahmen von Trainings sehr einfach erlernt werden. Die Vermittlung kann etwa in Form von Präsentationen oder eines Vortrages erfolgen. Der zweite Ansatzpunkt bezieht sich auf die Wahrnehmung bzw. Reflexion über das eigene Verhalten oder das Verhalten des Gegenübers. Dabei ist zum Beispiel die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme sehr wichtig. Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Wahrnehmung und Reflexion müssen im Training eingeübt werden.
Hier reicht zum Beispiel nur ein Vortrag nicht aus. Beim dritten Ansatzpunkt geht es um das sichtbare Verhalten des Handelnden, das heißt sehr konkrete Verhaltensäußerungen. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Begrüßungsoder Abschiedsformeln. Für diesen Inhaltsbereich wird als Methode ein Training empfohlen, bei dem die Lerninhalte praktisch angewendet und durch Wiederholungen automatisiert werden (vgl. Kanning 2005 S. 65 ff).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Ansatzpunkte zur Verbesserung sozial kompetenten Verhaltens (Quelle: Kanning 2005, S. 66)
Prinzipiell sollte bei der Entwicklung sozialer Kompetenz ganzheitliches Lernen angestrebt werden. Das Ziel sollte es sein, möglichst viele Bereiche der Persönlichkeit anzusprechen. So sollte im kognitiven Bereich zum Beispiel das selbständige Erarbeiten von Wissen gefördert werden, im emotionalen Bereich erfahrungsorientiertes Lernen und der aktionale Bereich könnte mit Verhaltensübungen gefördert werden (vgl. Jetter/Skrotzki 2005, S. 61). Trainingsmaßnahmen für das Lernen sozialer Kompetenz sind vor allem dann besonders erfolgreich, wenn die persönlichen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden (vgl. Crisand 2002, S. 83). Grundlage für die Förderung von Sozialkompetenz müssen stets klar ausgewiesene Lernziele sein. Diese Lernziele können sich in ihren Inhalts-, Verhaltens- und Situationskomponenten unterscheiden. Aufbauend auf diesen Lernzielen können Aufgaben erstellt werden (vgl. Walzik 2002, S. 14). Generell kann soziale Kompetenz ausschließlich in Gemeinschaft gebildet werden, da das Leben in der Gemeinschaft die Grundvoraussetzung für soziales Handeln bildet (vgl. Faix/Laier 1991, S. 109).
Es gibt verschiedene Methoden um das Sozialverhalten zu ändern. Die Psychologie unterscheidet grundsätzlich sehr viele verschiedene Formen des Lernens (vgl. Kriz/Nöbauer 2002 S. 75). Bevor besprochen wird, wie man soziale Kompetenz erlernt oder trainiert, muss geklärt werden, wie der Prozess des Lernens theoretisch erfolgen kann. Bei der Beschreibung von Seminar- und Bildungskonzepten für das Lernen von Sozialkompetenzen wird zwar häufig auf die Bedeutung des Lernens an Vorbildern hingewiesen, allerdings erfährt man oft wenig darüber, wie das Lernen von Sozialkompetenzen ablaufen könnte. Ein möglicher Zugang besteht in der Beschreibung von psychologischen Lerntheorien in Bezug auf das Lernen von Sozialkompetenzen (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 99).
2.3.1. Behavioristische Lerntheorien
Bei dieser Lerntheorie geht man davon aus, dass die meisten Verhaltensweisen gelernt werden, weil sie eine Bedürfnisbefriedigung für den Lernenden zur Folge haben (vgl. Kronenberg 1996, S. 161). Diese Theorie bezieht sich unter anderem auf die Prinzipien des operanten Konditionierens von Skinner. Der Lernende soll durch verschiedene Formen der Verstärkung an den Lernerfolg herangeführt werden. Dies kann als „Lernen am Erfolg“ bezeichnet werden (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 100). Das Grundprinzip des Behaviorismus lautet, dass das Verhalten eines jeden Organismus nichts anderes ist als seine Reaktion auf bestimmte Umweltreize, mit der sich der Organismus an die Umwelt anpasst (vgl. Baumgart 2007, S. 109). Euler/Hahn (2007) beschreiben diese Lerntheorie, bezogen auf das Erlernen von Sozialkompetenzen, als Anpassung des Lernenden an ein (fremd-) bestimmtes Verhaltensideal (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 450).
2.3.2. Kognitive Lerntheorien
Bei kognitiven Theorien werden die geistigen Prozesse betont, „durch die Menschen ihre Empfindungen und Wahrnehmung in strukturierte Eindrücke der Realität umwandeln“ (Zimbardo 2008, S. 525). Diese Lerntheorien gehen davon aus, dass man durch den Auf- und Ausbau kognitiver Strukturen lernt. Man beschäftigt sich mit der Frage, „wie der Mensch die Erfahrungen mit seiner Umwelt in Wissen beziehungsweise kognitive Strukturen verarbeitet“ (Euler/Hahn 2007, S. 451). Die Entwicklung kognitiver Theorien geht zurück auf Piaget. Er wollte mit seinen Forschungen aufklären, auf welche Weise sich der Mensch die Welt kognitiv aneignet (vgl. Baumgart 2007, S. 203).
2.3.3. Sozial-kognitive Lerntheorien
Diese Art der Lerntheorie wurde erstmals von Bandura beschrieben, welcher nachweisen konnte, dass alleine aufgrund von Beobachtung neue Verhaltensweisen gelernt oder schon vorhandene Handlungsweisen verstärkt
werden können (vgl. Kronenberg 1996, S. 162). Dies stellt eine Verbindung von Beobachtung und eigenem Handeln, und nicht von Instruktion und eigenem Handeln dar (vgl. Semmer/Pfäfflin 1978, S.38). Sozial-kognitive Lerntheorien können damit als „Lernen am Modell“ beschrieben werden. Dabei geht man von der Annahme aus, dass der Lernende eine Vielzahl von Verhaltensmöglichkeiten aus der Beobachtung und Imitation sozialer Modelle erwirbt (vgl. Euler/Hahn 2007,S. 451).
2.3.4. Handlungstheoretische und konstruktivistische Didaktikansätze
Dieser Ansatz beschäftigt sich vor allem mit dem Zusammenhang von Wissen und Handeln. Dabei geht man davon aus, dass sich jeder Mensch seine eigene subjektive Wahrheit „konstruiert“ (vgl. Walzik 2004, S. 229). Bei der konstruktivistischen Sicht des Lernens wird Lernen als Prozess gesehen, bei dem „personeninterne Faktoren mit personenexternen situativen Bedingungen in Wechselwirkung stehen“ (Kriz/Nöbauer 2002, S. 76f.). Bezugnehmend auf das Erlernen von Sozialkompetenzen kann dies als eine spezifische Form des Handlungslernens aufgefasst werden (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 452f.). Dabei findet Lernen in konkreten Situationen statt. Das erworbene Wissen wird in verschiedenen Situationen eingebunden und Lernen wird ein sozialer Interaktionsprozess (vgl. Kriz/Nöbauer 2002, S. 77).
Abschließend kann festgestellt werden, dass keine Lerntheorie existiert, die speziell und passgenau das Lernen von Sozialkompetenzen beschreibt. Die verschiedenen Lerntheorien bieten allerdings Ansätze und Anknüpfungspunkte für die Darstellung verschiedener Methoden, um soziale Kompetenz zu fördern (vgl. Euler/Hahn 2007, S. 469).
Um soziales Verhalten zu verändern, stehen sehr viele Methoden zur Verfügung. Meist hat man es in Trainingsprogrammen mit einer Mischung der verschiedenen Ansätze zu tun. Kanning (2005) unterteilt diese Methoden in vier Gruppen, die bei der Vermittlung sozial kompetenten Verhaltens angewendet werden: Wissensvermittlung, Verhaltenstrainings, Beratung und Selbsterfahrung (vgl. Kanning 2005, S. 72). Anhand dieser Einteilung werden nun verschiedene Verfahren besprochen, um soziale Kompetenz zu entwickeln und zu fördern. Diese Methoden finden in der Personalentwicklung Anwendung, erscheinen aber zum Teil auch für die Vermittlung sozialer Kompetenz im außerberuflichen Kontext, z. B. im universitären Bereich, anwendbar.
2.3.5. Wissensorientierte Verfahren
Bei der Wissensvermittlung werden theoretische Grundlagen vermittelt, um soziales Verhalten zu steuern (vgl. Kanning 2005, S. 72). Hier handelt es sich um eine inhaltsorientierte Vorgehensweise. Diese theoretische Unterweisung kann zum Beispiel durch einen Vortrag erfolgen (vgl. Crisand 2002, S. 84f.). Bei diesen Verfahren fokussiert man sich auf jene Wissensbestandteile, „die für die erfolgreiche Auswahl von Verhaltensoptionen und ihre Umsetzung in tatsächliches Handeln notwendig sind.“ Bei wissensorientierten Verfahren wird von vornherein der Fokus auf die Vermittlung von sozial relevantem Wissen gelegt. Dabei kann unterschieden werden zwischen sozial geteiltem Wissen und individuell entwickeltem Wissen. Bei sozial geteiltem Wissen handelt es sich um gesellschaftlich weit verbreitete Verhaltensstandards oder aber Verhaltensweisen innerhalb von Organisationen. Bei wissensorientierten Verfahren wird kein konkretes Verhalten in natürlichen Interaktionen eingeübt, sondern nur der Fokus auf sozial relevantes Wissen gelegt (vgl. Kanning 2007, S. 37f.).
2.3.6. Verhaltensorientierte Verfahren
Das Verhaltenstraining beinhaltet das Einstudieren eines gewünschten Verhaltens, das direkte Training steht im Vordergrund. Im Gegensatz zu wissensorientierten Verfahren wird konkretes Verhalten in natürlichen Situationen eingeübt (vgl. Kanning 2007, S. 38). Bei der Verhaltensübung wird prozessorientiert vorgegangen. Dies kann zum Beispiel mit einem Rollenspiel erfolgen. Diese Form des Trainings ist auf die Bewusstmachung von Empfindungen ausgerichtet und ist sehr gut geeignet, wenn es um erforschendes Lernen geht. Man kann damit Realitätsnähe schaffen (vgl. Crisand 2002, S. 86f.). Rollenspiele wirken sich auf das Verhalten deswegen aus, weil die Menschen für kurze Zeit aus der gewohnten Wirklichkeits- und Sozialbeziehung herausgelöst sind und sie sich in völlig neue hineinstellen können (vgl. Peterßen 2001, S. 255). Der Vorteil von Rollenspielen liegt darin, dass alle Beteiligten zur Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Gesehenen gezwungen werden (vgl. Lenzen 1998,S. 100). Sie können helfen, das Einfühlungsvermögen des Einzelnen für andere zu verbessern (vgl. Mangels 1995, S. 63).
2.3.7. Beratungsorientierte Verfahren
Bei beratungsorientierten Verfahren wird die Person selbst in den Mittelpunkt gestellt. Bei diesem klassischen Beratungsansatz geht man von der Einzelfallanalyse aus. Dabei bekommt man einen Berater oder Coach zur Seite gestellt, der bei der Bewältigung von problematischen Interaktionssituationen
[...]
- Quote paper
- Mag. Robert Hupfer, MSc (Author), 2010, Soziale Kompetenzen von Bachelor-Studierenden an der Wirtschaftsuniversität Wien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267945