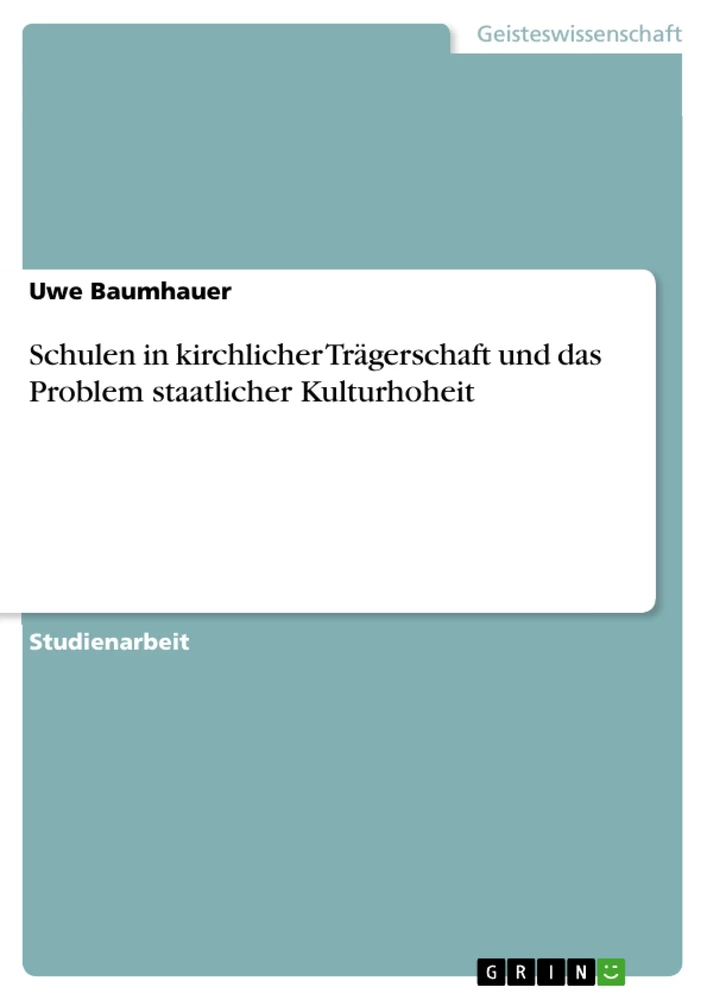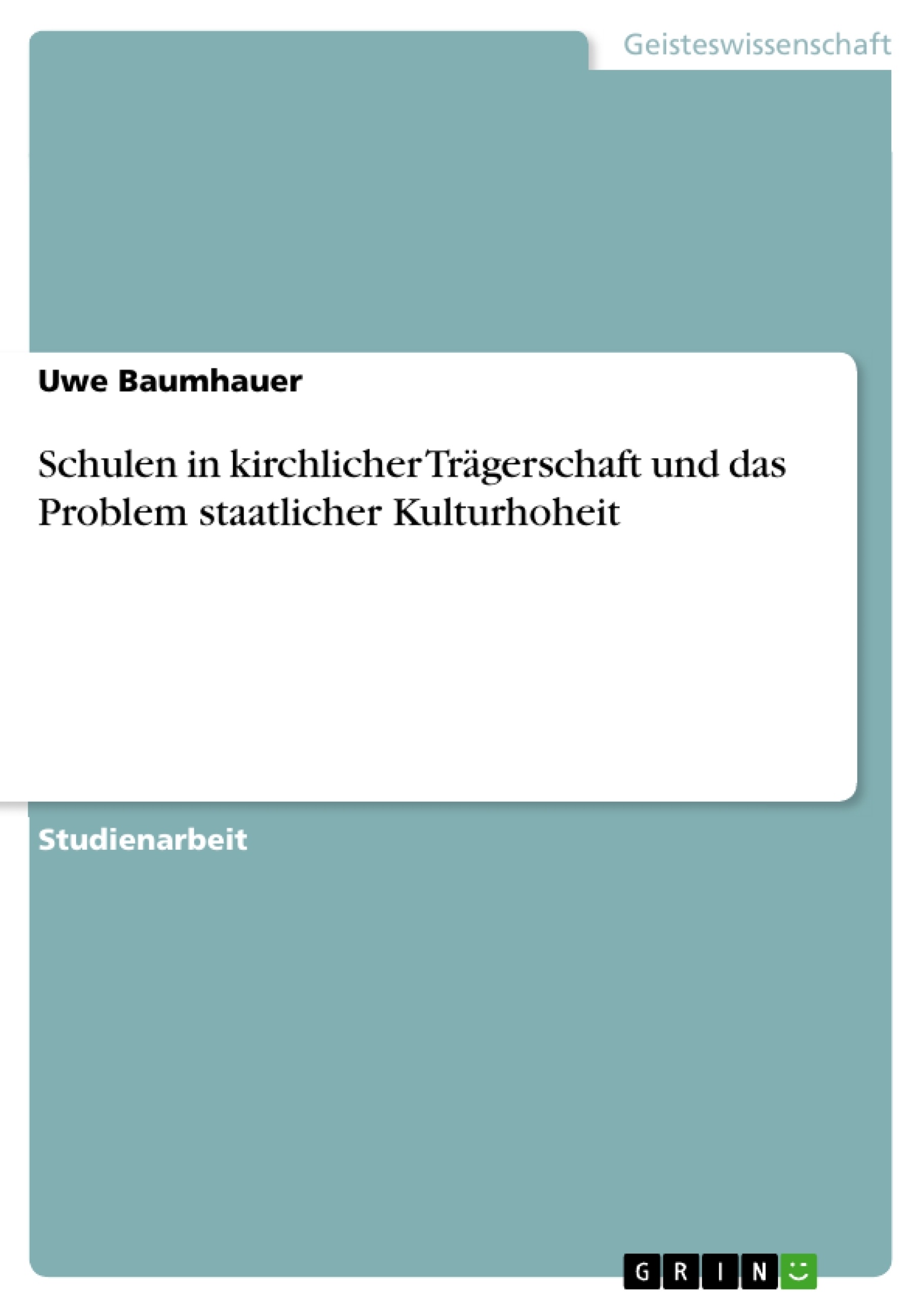In Deutschland - und besonders in den Neuen Bundesländern wird in einem nicht geringen Maße die Ansicht vertreten, daß es Werte und Normen gebe, die unabhängig von jeder Weltanschauung und für alle Menschen gleichermaßen von sich aus Geltung besäßen. Diese Ansicht führt zu der falschen Meinung, daß der Unterricht in staatlichen Schulen weltanschauungsneutral sei. Dieses Hausarbeit arbeitet heraus, warum Bildungs- und Erziehungsziele niemals weltanschauungsneutral sein können, und welche Probleme sich aus der Mißachtung dieser Tatsache ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Das der Betrachtung zugrundeliegende Menschenbild und Staatsverständnis
- Das Problem staatlicher Kulturhoheit
- Die gängige Interpretation der in der Verfassung verlangten Verantwortung des Staates für das öffentliche Schulwesen
- Die Idee der „Zivilreligion“
- „Zivilreligion“ als Universalkonsens im Widerstreit zu einem demokratisch-pluralistischen Staatsverständnis
- Der Widerspruch zwischen weltanschaulich-religiöser Neutralität und der Festlegung staatlicher Erziehungsziele
- Problemlösung durch Schulen in privater Trägerschaft
- Schulen in kirchlicher Trägerschaft
- Der Bildungsauftrag der Kirchen
- Der äußere Bildungsauftrag der Kirchen
- Der innere Bildungsauftrag der Kirchen
- Die Wahrnehmung des Bildungsauftrages der evangelischen Kirchen im allgemeinen
- Schulen in kirchlicher Trägerschaft als Wahrnehmung des kirchlichen Bildungsauftrages
- Der Bildungsauftrag der Kirchen
- Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Problem staatlicher Kulturhoheit in Bezug auf das öffentliche Schulwesen. Sie beleuchtet die Frage, inwieweit das derzeitige staatliche Schulsystem in Deutschland dem Anspruch auf weltanschaulich-religiöse Neutralität gerecht wird, und stellt die Idee der „Zivilreligion“ in den Kontext dieses Problems.
- Die Wahrnehmung der Kulturhoheit durch den Staat im Schulwesen
- Die Rolle der „Zivilreligion“ im Staatsverständnis
- Der Konflikt zwischen weltanschaulich-religiöser Neutralität und staatlichen Erziehungszielen
- Die Bedeutung von Schulen in privater Trägerschaft als Alternative
- Der Bildungsauftrag der evangelischen Kirchen und seine Implementierung in Schulen in kirchlicher Trägerschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die Problemstellung, die sich aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 16. Mai 1995 zur Anbringung eines Kreuzes in staatlichen Schulen ergibt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit das staatliche Schulsystem die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit tatsächlich gewährleistet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Problem der staatlichen Kulturhoheit im Schulwesen. Die gängige Interpretation der Staatsverantwortung für das öffentliche Schulwesen wird untersucht, wobei der Konflikt zwischen dem Anspruch auf weltanschaulich-religiöse Neutralität und der Festlegung staatlicher Erziehungsziele im Vordergrund steht. Die Idee der „Zivilreligion“ und ihre Auswirkungen auf das Staatsverständnis werden analysiert.
Das dritte Kapitel widmet sich den Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Der Bildungsauftrag der Kirchen wird vorgestellt, wobei zwischen dem äußeren und dem inneren Bildungsauftrag unterschieden wird. Anschließend wird die Wahrnehmung des Bildungsauftrages der evangelischen Kirchen im allgemeinen und die Rolle von Schulen in kirchlicher Trägerschaft als Ausdruck dieses Auftrages dargestellt.
Schlüsselwörter
Staatliche Kulturhoheit, Zivilreligion, weltanschaulich-religiöse Neutralität, Schulwesen, Religionsfreiheit, Bildungsauftrag der Kirchen, Schulen in kirchlicher Trägerschaft, staatliche Erziehungsziele.
Häufig gestellte Fragen
Sind staatliche Schulen wirklich weltanschauungsneutral?
Die Arbeit argumentiert, dass Bildungsziele niemals völlig neutral sein können, da sie immer auf bestimmten Werten und Normen basieren.
Was versteht man unter „Zivilreligion“?
Zivilreligion bezeichnet einen gesellschaftlichen Grundkonsens an Werten, der oft fälschlicherweise als neutraler Ersatz für religiöse Weltanschauungen angesehen wird.
Welchen Bildungsauftrag haben die Kirchen?
Man unterscheidet zwischen dem äußeren Auftrag (Teilhabe am Bildungswesen) und dem inneren Auftrag (Vermittlung christlicher Werte und Orientierung).
Warum sind Schulen in privater Trägerschaft wichtig?
Sie bieten eine Lösung für den Widerspruch zwischen staatlicher Erziehungshoheit und der im Grundgesetz verankerten Religionsfreiheit der Eltern.
Was war der Hintergrund des Kruzifix-Urteils von 1995?
Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Anbringung von Kreuzen in staatlichen Schulen gegen die Pflicht des Staates zur religiösen Neutralität verstoßen kann.
- Arbeit zitieren
- Uwe Baumhauer (Autor:in), 1997, Schulen in kirchlicher Trägerschaft und das Problem staatlicher Kulturhoheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2679